Views: 108
UPDATE 9.8.2021: Meldung zum SENTIX-Konjunkturindex ergänzt unter „INTERNATIONALES“
Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – ganz ähnlich wie in den letzten Wochen hier festgehalten: – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball noch immer “supertoll” geht – allerdings ist dieses Noch ein zunehmend schwergewichtiges: neben kurzfristigen und nach Bundesbankpräsidend Weidmann auch auf längere Sicht zunehmenden Inflationsgefahren dämmert seit einigen Wochen mit wachsender Zudringlichkeit eine andere, in ihrem Ausmaß nun zunehmend deutlicher werdende Gefahr in Form des Delta-Virus herauf: weiter deutlich wachsende Unruhe herrscht deshalb nicht nur bei Gesundheitsexperten, sondern sie nimmt auch bei Finanzanlegern, Unternehmen und vor allem in der Politik zu: ihre Stimmen werden lauter, ihre Mahnungen eindringlicher.
Im Fokus steht die Debatte um die Einführung einer Impfpflicht. Zur Frage der Verpflichtetheit der Staatsbürger*innen gegenüber dem Staat und damit füreinander nimmt Richard David Precht Stellung (=> Kommentare aus fremder Feder).
Inwieweit hat das etwas mit zeitgeschichtlichen Entwicklungen seit 1977 zu tun? Dazu veröffentlicht der Historiker Philipp Sarasin im Juni ein umfangreiches Werk titels „1977“ und legt einen „Schnitt durch den Strom der Zeit“, um die Veränderungen, die das Jahr 1977 brachte, aufzuzeigen. Gemeinsam ist diesen Veränderungen der Beginn einer Bewegung, die „vom modernen Ideal der Allgemeinheit und Universalität in eine zunehmende Pluralisierung und einen Primat der Singularitäten führt“ (=> Buchbesprechungen aus fremder Feder).
Gibt es da nicht eine gemeinsame Sicht zwischen Prechts unsolidarisch Kunden*innen ohne Verantwortungsgefühl für das Allgemeine, für das allen gemeinsame Staatswesen einerseits und Sarasins im Rahmen einer rasanten Entwicklung seit 1977 zahllos vereinzelten, in ihre Kokons eingesponnenen Menschen andererseits?
Zurück zu Wirtschaftlichem: weiter treten geringere Störungen im Wirtschaftsablauf auf: die Weltwirtschaft und die der großen Wirtschaftsnationen befinden sich auf hohem Niveau in weiterhin noch guter Fahrt, aber da und dort flackern schwache Warnzeichen auf. Sie müssen à la longue nichts bedeuten. Sorge bereiten weiterhin die gestörten Lieferketten und die auch dadurch steigenden Preise über Import und Produktion.
Von den Börsen gibt es zunehmend deutlicher vernehmbare Warnzeichen, so vermitteln die SENTIX-Sentimente. Nach dem Blitz und Donner am chinesischen Aktienmarkt in der vorletzten Woche ist dieser angeschlagen: geht es noch weiter nach Süden? Falls ja: wird das nicht andere Märkte mit nach unten ziehen?
Auch für Anleihen hat die Zukunft möglicherweise nichts Gutes im Köcher: wird die FED die Zinsen angesichts guter US-Arbeitsmarktdaten früher als geplant höher schrauben? Nichts Genaues weiß man nicht, aber für Unruhe an den Finanzmärkten ist der Stoff jedenfalls vorhanden. Dazu kommen – wie letzte Woche schon vermerkt – saisonale Faktoren: August und September sind (fast) sicher keine Hausse-Monate. Allerdings: der Anlagenotstand ist groß. Ein Balanceakt zwischen Zentralbank-getriebener Niedrigzinspolitik und überlicherweise markbeeinflussenden Wirtschaftsdaten ist die Folge.
IN DEN VORDERGRUND rückten auf die Bühne des großen Welttheaters in der zurückliegenden Woche: eine cyberkriminelle Attacke auf eine italienische Impfplattform; die italienische Regierung reagierte prompt mit Worten: eine Agentur für Cybersicherheit sei geplant, seien doch 95 Prozent aller Server gefährdet. Zudem sei eine Cloud zur Aufnahme aller Daten der öffentlichen Verwaltung geplant. Nun denn.
Apropos Cybersicherheit: Wer Dystopien mag, lese Harlanders Thriller „Systemfehler“: Cyberattacken stürzen Europa ins Chaos (=> Buchbesprechungen aus fremder Feder).
China schickt Internet-Trolle aus, die den Westen dank gefälschter Profile attackieren. China ist brav und gut, heißt es da: Schönrederei vom Feinsten, wer etwas anderes behauptet, wird zum Erzfeind. Erinnert das nicht an George Orwells „1984“ (=> Film von 1956) und neben anderem an das dort beschriebene Wahrheitsministerium?
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wirft ein Auge auf die protektionistische Handelspolitik der USA und ihre negativen Folgen.
Kontrollierend verhält sich China, das nun Händlern von Auto-Chips unter die Lupe nimmt: gab es Preisabsprachen, die Chips teurer machten als nötig?
Der Bundesbank-Präsident redet den EU-Mitgliedsstaaten ins Gewissen: bei anwachsender Teuerung werde die EZB die Zinsschraube anziehen. Angesichts der hohen Staatsverschuldungen ist das ein unangenehmer Ausblick für die Schuldnerländer. Die guten europäischen und deutschen Arbeitsmarkdaten sprechen für einen Inflationsanstieg. Einstweilen aber geht es ums Öffnen der Geldschleusen: nur nicht das PEPP zu früh beenden, meint ein EZB-Ratsmitglied. Auch dies ein – allerdings nach offizieller Lesart gewünschter – Inflationsfaktor.
Der Rückgang der US-Arbeitslosenzahlen, der Aufschwung der Beschäftigungsverhältnisse, die steigenden Privateinkommen und privaten Kreditaufnahmen sprechen für steigende US-Zinsen, denn Konsum ist offenbar momentan die Devise.
Große Unzufriedenheit mit der Europäischen Union will eine Umfrage von Euroskopia ausgemacht haben. Wie geht das mit den Ergebnissen des letzten Eurobarometers vom Frühjahr 2021 zusammen?
In Deutschland macht sich der Chipmangel weiter bemerkbar: die Einkaufsmanager klagen darüber, die Industrie jammert. Besonders die Autoindustrie leidet unter dem Chipmangel, aber deren Stimmung ist gut: ein Paradoxon (=> Kommentare aus fremder Feder).
In Österreich fasst der Tourismus wieder Fuß, vor allem der Inlandstourismus. Ausländische Gäste bleiben im Vergleich zu 2019 noch aus, und die Nächtigungszahlen liegen ein gutes Stück hinter denen des Rekordjahres 2019, sind aber so hoch wie im Vorjahr.
ÜBERSICHT
- CYBERCRIME
- Chinas Internet-Trolle attackieren den Westen – Bericht des Centre for Information Resilience enthüllt verdächtiges Netzwerk gefälschter Profile
- Italien: Nach Hackerangriff: Italien bekommt Agentur für Cybersicherheit – Agentur soll 300 Informatikexpert*innen beschäftigen, später 1000 – Landesweite Cloud zur Aufnahme aller Daten der öffentlichen Verwaltung geplant – Nachholbedarf in Sachen Cybersicherheit: „95 Prozent der Server gefährdet“
- Italien: Impfportal Latiums gehackt – Spur nach Deutschland
INTERNATIONAL - SENTIX-Konjunkturindex August 2021: Dritter Rückgang in Folge: Europa, Deutschland: Lagewerte OK, Erwartungen weniger – Konjunkturwarnung für Euroland – USA-Lage noch gut, Erwartungen weniger: ein Signal für die NYSE – Weltwirtschaft: Lagewerte und Erwartungen geraten auf die schiefe Bahn – Österreich: Lagewert und Erwartungen mit Rückgängen, Gesamtindex auf Mai-2021-Niveau – SENTIX, 9.8.2021
- IWF teilt Sonderziehungsrechte für 650 Mrd US-Dollar zu – Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft soll gefördert werden – Alle Länder erhalten gemäß ihrer IWF-Quote einen Anteil – Im Kampf gegen die Pandemie sollen wohlhabende Länder freiwllig SZR an ärmere Länder weitergeben – Unterstützung des Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) des IWF durch reiche Länder – PRGT-Darlehen sind derzeit zinsfrei – Neue Möglichkeit eines „Resilience and Sustainability Trust“ in Erwägung
- Julie Steinberg: Fintechs stärker wie Banken regulieren – BIZ-Papier
- DIW: Protektionistische US-Handelspolitik schadet Wirtschaft weltweit
BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Erstaunlich wenig Jubel, erstaunlich wenig Angst – Chinas Aktienmarkt angeschlagen – Feuer von der Zinsfront: US-Anlleihen geraten bei Professionellen in Argwohn – Edelmetalle im Abwärtstrend bei hochpositivem Sentiment
- USA: Martin Lüscher: Anleger zeigen sich unbeeindruckt
- USA – Sylvia Walter: Gefährlicher August
ZENTRALBANKEN
– GROSSBRITANNIEN / BoE - Bank of England lässt Geldpolitik unverändert
– EUROPÄISCHE UNION / EZB
EZB-Rat Kazaks gegen schnelle Entscheidung über Zukunft des Pepp-Programms – Warnung vor zu frühem Austritt aus PEPP – Steigende Infektionszahlen werden Entscheidung im September über PEPP wahrscheinlich beeinflussen
– DEUTSCHLAND / DBB - Bundesbank-Präsident Weidmann warnt Finanzminister der Euro-Zone: bei steigender Inflation kann EZB nicht auf Finanzierungskosten der Staaten Rücksicht nehmen – Pandemie vorbei, PEPP vorbei – Nicht ewig: bei steigender Teuerung wird APP beendet werden – Weidmann: aktuell erscheint Inflation mit 3,8 Prozent nur vorübergehend überhöht, längerfristig ist aber mit Steigerung der Teuerung zu rechnen
- Bundesbank veröffentlicht Target2-Monatsdurchschnittswerte
– ÖSTERREICH / OeNB - Österreichische Banken mit solidem Ergebnis beim europäischen Stresstest – Kapitalaufbau der letzten Jahre zeigte Wirkung und erhöhte die Krisenresistenz des Bankensektors – Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld – Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider – Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit
USA - Defizit in der US-Handelsbilanz gestiegen
- EIA meldet gestiegene US-Rohöllagerbestände
- API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände
- Ölpreise geraten unter Druck – Ausbreitung der Delta-Variante belastet
- ISM-Index für US-Industrie fällt im Juli
- USA: Industrie erhält im Juni mehr Aufträge als erwartet
- USA: Bauausgaben steigen im Juni weniger als erwartet
- ISM-Index Dienstleistungen im Juli deutlich höher als erwartet
- Markit: US-Dienstleister wachsen im Juli schwächer
- USA: Ein-Personen-Firmen leiden unter Corona – 81 Prozent hatten 2020 laut aktueller FED-Untersuchung wegen Pandemie finanzielle Probleme
- USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet
- USA: Stundenlöhne steigen stärker als erwartet
- ADP: US-Privatsektor schafft weitaus weniger Stellen als erwartet
- US-Beschäftigtenzahl höher als erwartet – Arbeitslosigkeit sinkt
- USA: Arbeitslosenquote fällt im Juli auf tiefsten Stand seit März 2020
- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wie erwartet leicht gesunken
CHINA - ‚Caixin‘-Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit Frühjahr 2020
- China nimmt Händler von Auto-Chips ins Visier – Chinesische Händler von Auto-Chips als Preistreiber: Maßnahmen gegen das Horten und gegen Absprachen
GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich wie erwartet ein – Solides Wachstum, aber Materialmangel und Mangerl an Arbeitskräften bremst
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Eine Umfrage in sechs europäischen Ländern zeigt: Die Unzufriedenheit mit der EU ist enorm – Deutsche und Polen sind sich oft fremd, nicht überall ist Klimaschutz das wichtigste Anliegen, Greta Thunberg spaltet, und das Judentum hat ein Imageproblem. Die Ergebnisse der ersten «Euroskopia»-Befragung überraschen an vielen Stellen – Deutsche sind in vielerlei Hinsicht EU-Skeptiker – In Polen findet eine nationale Migrationspolitik Zustimmung – Österreicher und Deutsche für einen stärkeren Grenzschutz – Kritische Einstellung gegenüber Islam und Judentum, Vorbehalte gegenüber dem Islam in Polen am grössten – Klimawandel und Rechtsextremismus treiben um, aber nicht allzu stark
- Euroraum-Erzeugerpreise steigen im Rahmen der Erwartungen – Erzeugerpreise verteuern sich auf Jahressicht um 10,3 Prozent – Deutlich weiterer Anstieg der Energiepreise
- Euroraum-Industrie-PMI im Juli leicht höher als erwartet
- Industrie und Dienstleistungsgewerbe treiben: Euroraum-Wirtschaft wächst im Juli so stark wie zuletzt 2006 – Abgeschwächte Wachstumsdynamik – Inflationsdruck lässt nach
- European Labour Market Barometer sinkt um 0,4 Punkte – Arbeitsmärkte in Europa scheinen trotz Barometer-Rückgang weiter im Aufwind zu sein, aber Sorge über neue Pandemie-Welle wächst
ITALIEN - Italien: Industrieproduktion legt wieder zu
DEUTSCHLAND - Ifo-Institut: Volkswirte für mehr Klimaschutz – Keine Einigkeit über das Wie einer künftigen Klimapolitik – Im Fokus u.a. der CO2-Preis
- Deutscher Industrie-PMI signalisiert Produktionsbehinderungen im Juli
- VDMA: Auftragseingang Maschinenbau im Juni um 53 Prozent über Vorjahr
- VDMA bestätigt Produktionsprognose 2021 trotz Materialmangel
- Ifo: Industrie klagt massiv über Materialmangel
- Hans Bentzien: Deutscher Auftragseingang im Juni deutlich höher als erwartet
- Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juni um 1,4 Prozent
- Deutsche Produktion sinkt im Juni um 1,3 Prozent
- Produzierendes Gewerbe rutscht 1,3 Prozent ab – Produktion in Deutschland fällt im Juni saison- und kalenderbereinigt um 6,8 Prozent niedriger aus
- Pkw-Neuzulassungen sinken im Juli um ein Viertel – Weiter starke Nachfrage nach Eletromobilen und Hybridfahrzeugen – Einbruch der Nachfrage bei Benzin- und Diesel-PKW
- Deutschlands Autoindustrie fordert einen rascheren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos.
- Ifo: Lage der Autoindustrie verbessert
- Markit: Deutsche Dienstleister im Juli mit Rekordgeschäft
- Deutscher Einzelhandel im Juni viel höher als erwartet
- KfW-Mittelstandsbarometer sinkt im Juli trotz guter Geschäftslage
- Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeiter im Juli deutlich gesunken
ÖSTERREICH
– STATISTIK - Außenhandel im Mai 2021: mehr als 30% mehr Importe und Exporte im Vergleich zum schwachen Vorjahresmonat; Einfuhren +34,1%, Ausfuhren +31,5%
- Großhandelspreise legten im Juli 2021 um 12,1% zu
- Einzelhandel mit Umsatzplus von 6,4% im 1. Halbjahr 2021; Absatzvolumen bei Nicht-Nahrungsmitteln fast auf Vorkrisenniveau
– MELDUNGEN - Österreich: Nächtigungen im Juli auf Vorjahresniveau, aber noch unter Rekordwert aus dem Jahr 2019 – Vorjahreswerte übertroffen: Deutsche, ungarische und polnische Gäste sorgen im Juli für hohe Zahlungskartenumsätze – Vorjahreswerte der Zahlungskartenumsätze im Juli mit Plus von 50 Prozent bei inländischen Gästen – Kein sicherer Schluss auf Nächtigungen möglich: Inländer verwenden heuer häufiger Zahlungskarten als bares Geld, daher Nächtigungen geschätzt auf Vorjahresniveau – Insgesamt geschätzt 17 Prozent Rückstand im Vergleich zum Nächtigungsrekordjahr 2019, im Vergleich zu 2020 geschätzt gleichgeblieben – 2021 im Vergleich zu 2019: Plus 17 Prozent mehr inländische Gäste, minus 29 Prozent weniger ausländische Gäste
- PVA-Generaldirektor gegen sozial gestaffelte Pensionsanpassung – Pensionistenvertreter nicht einig: Pensionistenverbandspräsident (SPÖ) dafür, Seniorenbundpräsidentin (ÖVP) dagegen – Kein eigener Pensionistenwarenkorb – Massiver“ Einbruch bei Beiträgen: steigende Bundeszuschüsse in Milliardenhöhe vorprogrammiert
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Bert Rürup: Wunderliche Töne aus der Autoindustrie – Autoindustrie spürt Chipmangel, aber Stimmung der Autobauer steigt
- Philosoph Precht gibt eine hörenswerte Zeitanalyse: Es geht um das Problem, dass der liberale Staat seine eigenen Existenzbedingungen nicht einfordern kann
BUCHBESRPECHUNGEN AUS FREMDER FEDER - Philipp Sarasin: „1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ – Das Ende der Moderne, Berlin: Suhrkamp, 2021 – Sarasin legt einen „Schnitt durch den Strom der Zeit“, um die Veränderungen, die das Jahr 1977 brachte, aufzuzeigen – Gemeinsamkeit dieser Veränderungen ist der Anfang einer Bewegung, die vom modernen Ideal der Allgemeinheit und Universalität in eine zunehmende Pluralisierung und einen Primat der Singularitäten führt
- Thomas Badtke: Neuer Thriller von Harlander: Ein „Systemfehler“ legt Europa lahm – Es braucht nicht viel, um Europa lahm zu legen, nur einen gezielten Cyberangriff mit einem Computervirus
CYBERCRIME
CHINA: Chinas Internet-Trolle attackieren den Westen – Bericht des Centre for Information Resilience enthüllt verdächtiges Netzwerk gefälschter Profile – Pressetext, 6.8.2021
Über ein Netzwerk von über 350 gefälschten Social-Media-Profilen wird China in einem guten Licht dargestellt und es werden diejenigen diskreditiert, die als Gegner der Staatsführung gelten, so ein Bericht des Centre for Information Resilience (CIR) http://info-res.org . Laut der Institution, die sich der Identifizierung, Bekämpfung und Aufdeckung von Einflussnahmen im Internet widmet, soll der Westen delegitimiert und Chinas Einfluss und Image im Ausland gestärkt werden.
*** Karikaturen gegen China-Kritiker ***
Laut dem Bericht soll das Netzwerk unter anderem schrille Karikaturen verbreitet haben, die unter anderem den im Exil lebenden chinesischen Tycoon Guo Wengui zeigen, einen ausgesprochenen Kritiker der kommunistischen Führung. Andere sind die chinesische Virologin Li-Meng Yan, die sagt, das Coronavirus stamme aus einem Labor der chinesischen Regierung. Ebenfalls Ziel ist Steve Bannon, ehemaliger politischer Stratege von Donald Trump. Alle wurden beschuldigt, ihrerseits Desinformationen zu verbreiten, einschließlich falscher Infos über die Pandemie.
Einige der Konten – verteilt auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube – verwenden mithilfe von Künstlicher Intelligenz generierte Profilbilder, heißt es weiter in dem CIR-Bericht. Zwar gebe es keine konkreten Beweise dafür, dass das Netzwerk mit der chinesischen Regierung verbunden ist, aber laut CIR ähnelt es pro-chinesischen Netzwerken, die zuvor von Twitter und Facebook gelöscht wurden.
*** Vor allem die USA sind im Visier ***
Ein Großteil der von dem Netzwerk geteilten Inhalte konzentriert sich auf die USA und insbesondere auf umstrittene Themen wie Waffengesetze und Rassenpolitik. Eines der Narrative, die laut CIR vom Netzwerk vorangetrieben werden, stellt die USA als Menschenrechtsverletzer dar. Als Beispiele dienen der Mord an dem Afroamerikaner George Floyd durch einen Polizisten sowie die angebliche Diskriminierung von Asiaten.
Einige Berichte des im Social Web agierenden chinesischen Netzwerks leugnen laut CIR-Studie Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang, in der die Regierung angeblich mindestens eine Mio. Muslime gegen ihren Willen festhält und nennen die Anschuldigungen „Lügen, die von den Vereinigten Staaten und dem Westen erfunden wurden“.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210806003
Nach Hackerangriff: Italien bekommt Agentur für Cybersicherheit – Agentur soll 300 Informatikexpert*innen beschäftigen, später 1000 – Landesweite Cloud zur Aufnahme aller Daten der öffentlichen Verwaltung geplant – Nachholbedarf in Sachen Cybersicherheit: „95 Prozent der Server gefährdet“ – ORF, 7.8.2021
Die Regierung von Premier Mario Draghi will Italiens Cybersicherheit stärken. So entsteht die Nationale Agentur für Cybersicherheit (NCA), an deren Spitze der Informatikexperte Roberto Baldoni stehen wird, wie die römische Tageszeitung „La Repubblica“ heute berichtete. Das Gesetz zur Schaffung der Agentur wurde bereits diese Woche einstimmig von der Abgeordnetenkammer verabschiedet und kann nach dem grünen Licht des Senats in den nächsten Tagen in Kraft treten.
Die neue Agentur soll aus 300 Informatikexpertinnen und -experten bestehen, in fünf Jahren sollen es 1.000 sein.
Digitalisierung und Cybersicherheit sind ein Eckpfeiler des mit 200 Milliarden Euro aus Brüssel finanzierten Wiederaufbauprogramms „Recovery Plan“, mit dessen Umsetzung die Regierung im Juli begonnen hat. So ist eine landesweite „Cloud“ geplant – eine große Plattform, auf der alle Daten der öffentlichen Verwaltung (insgesamt 180 Institutionen) gespeichert werden sollen.
*** „95 Prozent der Server gefährdet“ ***
Das Projekt wird von Innovationsminister Vittorio Colao vorangetrieben. Er plant eine Ausschreibung, um interessierte Unternehmen anzuregen, sich am Wettbewerb für die Einrichtung der „Cloud“ zu beteiligen.
Italien hat in Sachen Cybersicherheit Nachholbedarf. „95 Prozent der Server der öffentlichen Verwaltung sind gefährdet“, warnte Staatssekretär Franco Gabrielli. „Die neue Agentur muss dafür sorgen, dass die öffentliche Verwaltung weniger angreifbar wird“, erklärte er.
Die Schaffung der neuen Agentur für die Cybersicherheit erfolgt kurz nach einem Hackerangriff auf das IT-System der mittelitalienischen Region Latium mit der Hauptstadt Rom, der unter anderem das Buchungsportal für Impfungen lahmgelegt hat.
QUELLE: https://orf.at/stories/3223986/
ITALIEN: Impfportal Latiums gehackt – Spur nach Deutschland – dpa-AFX, 3.8.2021
Nach einem Hackerangriff auf das Internet-Portal der italienischen Region Latium führt die Spur nach Deutschland. Das bestätigte die italienische Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Die Zeitung „La Repubblica“ berichtete in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf die Ermittlungen, die Cyberattacke sei von Deutschland ausgegangen. Dass die Kriminellen damit in Deutschland sitzen, muss allerdings nicht unbedingt der Fall sein. Wie die Zeitung weiter schrieb, könnten die Täter so versucht haben, ihren eigentlichen Aufenthaltsort zu verschleiern. Am Dienstagnachmittag war die Internetseite weiter offline.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag war das Portal der Region nicht mehr erreichbar. Das sorgte zunächst für große Aufregung, denn über die Internetseite können Menschen auch ihre Corona-Impftermine und Reservierungen bei Fachärzten buchen. Die Impfungen liefen jedoch weiter, erklärte die Region. Terminbuchungen bei Fachärzten waren allerdings zunächst nicht möglich.
„Wir wissen nicht, wer die Verantwortlichen und was ihre Ziele sind“, schrieb Regionalpräsident Nicola Zingaretti auf Facebook. Ihm zufolge blockierte der Hackerangriff viele wichtige Daten. Wer schon einen Impftermin habe, könne diesen auch wahrnehmen.
Die Hacker verschafften sich mit einem Trojaner Zugang in das System der Region Latium, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Ermittler schrieben. Eine solche Attacke wird auch als Ransomware-Angriff bezeichnet. Die Kriminellen sorgten so dafür, dass die Region keinen Zugriff mehr auf ihre Seite hatte und Internetnutzer nicht mehr auf die Portale zugreifen konnten. Den Berichten nach gibt es eine Zahlungsaufforderung in der Kryptowährung Bitcoin, damit die Hacker die Seite entsperren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53581565-italien-impfportal-latiums-gehackt-spur-nach-deutschland-016.htm
INTERNATIONAL
SENTIX-Konjunkturindex August 2021: Dritter Rückgang in Folge: Europa, Deutschland: Lagewerte OK, Erwartungen weniger – Konjunkturwarnung für Euroland – USA-Lage noch gut, Erwartungen weniger: ein Signal für die NYSE – Weltwirtschaft: Lagewerte und Erwartungen geraten auf die schiefe Bahn – Österreich: Lagewert und Erwartungen mit Rückgängen, Gesamtindex auf Mai-2021-Niveau – SENTIX, 9.8.2021
Die globale Konjunktur läuft auf Hochtouren, doch die Dynamik wird schwächer. Hierzu trägt auch die Abkühlung in der Region Asien ex Japan bei.
In der Eurozone schreitet die Erholung der Lagewerte weiter voran. Die Bewertung erreicht mit 30,8 Punkten das höchste Niveau seit Oktober 2018. Jedoch verliert auch hier die Erwartungskomponente deutlich um 15,8 Punkte und markiert damit den dritten Rückgang in Folge. Die Regel eines dreimaligen Rückgangs sollte ernst genommen werden.
Der Gesamtindex für die Eurozone gibt folglich um 7,6 Punkte ab.
Volkswirte erkennen traditionell in einem dreimaligen Rückgang eine Trendwende. Demnach sollte dieser Rückgang
nicht als bloßer Momentum-Verlust abgetan werden, sondern als Warnhinweis verstanden werden. Als „first mover“
unter den Frühindikatoren kündigt diese Entwicklungen deutliche Rückgänge in weiteren Frühindikatoren an. Die Entwicklung dürfte daher zu einer erhöhten Marktvolatilität in den kommenden Wochen beitragen.
Deutschlands Wirtschaft präsentiert sich weiter in einer boom-artigen Verfassung. Die Lage steigt zum 15mal in Folge auf 38,5 Punkte. Die Erwartungskomponente halbiert sich.
Die US-Wirtschaft zeigt auf hohem Niveau Ermüdungserscheinungen, mehr aber noch in den Erwartungen. Diese sinken zum vierten Mal in Folge: der US-Konjunkturboom hat seinen Zenit bereits überschritten.
Die Weltwirtschaft schaltet im laufenden Boom ebenfalls einen Gang zurück. Hier sind es nicht nur die Erwartungswerte, die den Dynamik-Verlust prägen, sondern auch die Lagewerte, die sich deutlicher auf dem Rückzug befinden. Hierzu trägt auch die ausgeprägte Schwäche in der Region Asien ex Japan bei.
Österreich erleidet sowohl in der Lagebeurteilung als auch bei den Erwartungen Rückschläge, letztere zum dritten Mal in Folge. Der Gesamtindex geht deutlich auf den Wert von Mai 2021 zurück.
QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Economic-News/dritter-rueckgang-in-folge.html
Hans Bentzien: IWF teilt Sonderziehungsrechte für 650 Mrd US-Dollar zu – Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft soll gefördert werden – Alle Länder erhalten gemäß ihrer IWF-Quote einen Anteil – Im Kampf gegen die Pandemie sollen wohlhabende Länder freiwllig SZR an ärmere Länder weitergeben – Unterstützung des Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) des IWF durch reiche Länder – PRGT-Darlehen sind derzeit zinsfrei – Neue Möglichkeit eines „Resilience and Sustainability Trust“ in Erwägung – DJN, 3.8.2021
Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am 23. August 456 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR) zuteilen, um die von der Corona-Pandemie getroffene Weltwirtschaft besser mit Liquidität zu versorgen. Das hat der Gouverneursrat des IWF am Montagabend (Ortszeit) in Washington beschlossen.
„Die SZR-Zuteilung wird allen Mitgliedern zugutekommen, den langfristigen globalen Bedarf an Reserven decken, Vertrauen schaffen und die Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft fördern. Sie wird insbesondere unseren schwächsten Ländern helfen, die mit den Auswirkungen der Covid-19-Krise zu kämpfen haben“, erklärte die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva.
SZR sind eine vom IWF emittierte Reservewährung, die von den Mitgliedstaaten frei verwendet werden kann. Der zugeteilte Betrag entspricht 650 Milliarden US-Dollar. Alle Länder erhalten ihren Anteil an den SZR entsprechend ihrer IWF-Quote. Etwa 275 Milliarden US-Dollar der neuen Zuteilung gehen an Schwellen- und Entwicklungsländer, einschließlich einkommensschwacher Länder.
„Wir werden auch weiterhin aktiv mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten, um praktikable Wege für die freiwillige Weiterleitung von SZR von wohlhabenderen an ärmere und anfälligere Mitgliedsländer zu finden, um deren Erholung von der Pandemie zu unterstützen und ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Wachstum zu erreichen“, erklärte Georgieva.
Eine wichtige Möglichkeit besteht laut IWF darin, dass Mitglieder, die über eine starke Auslandsposition verfügen, freiwillig einen Teil ihrer SZR für die Ausweitung der Kreditvergabe an einkommensschwache Länder über den Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) des IWF bereitstellen.
Die Unterstützung durch den PRGT ist derzeit zinsfrei. Der IWF prüft nach eigenen Angaben auch andere Wege, um ärmere und anfälligere Ländern bei der Erholung zu unterstützen. Ein neuer „Resilience and Sustainability Trust“ könnte in Betracht gezogen werden, um mittelfristig ein widerstandsfähigeres und nachhaltigeres Wachstum zu ermöglichen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53576993-iwf-teilt-sonderziehungsrechte-fuer-650-mrd-us-dollar-zu-015.htm
Julie Steinberg: Fintechs stärker wie Banken regulieren – BIZ-Papier – DJN, 1.8.2021
Die Rufe nach einer strengeren Regulierung großer Technologieunternehmen, die in den Bereich der Finanzdienstleistungen vordringen, werden immer lauter. In einem von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlichten Papier heißt es, dass Technologieunternehmen, die eine wichtige Rolle im Zahlungsverkehr und in anderen Bereichen des Finanzsektors spielten, einer strengeren aufsichtsrechtlichen Prüfung unterzogen werden sollten, die über die traditionellen Marktrisiken hinausgeht.
Banken und Versicherer können nach den geltenden Regeln als systemrelevant eingestuft werden. Doch die Vorschriften in den meisten Ländern berücksichtigen nicht „die potenziellen und möglicherweise globalen systemischen Auswirkungen von Big-Tech-Aktivitäten und mögliche Spillover-Effekte für den Finanzsektor“, heißt es in dem Bericht. Die Zentralbanken sollten die Notwendigkeit „spezifischer Schutzmaßnahmen“ für Big-Tech-Unternehmen untersuchen, so das Papier.
Finanztechnologieunternehmen haben in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung genommen und sind zu wichtigen Akteuren in Bereichen geworden, die traditionell von Banken wahrgenommen werden, darunter die Abwicklung von Zahlungen über das Finanzsystem und die Bereitstellung von Krediten für Verbraucher und Unternehmen.
Das Zahlungsunternehmen Square Inc kündigte am Sonntag seine bisher größte Übernahme an: Es will für rund 29 Milliarden Dollar Afterpay Ltd. übernehmen. Welchen Wert Investoren solchen Unternehmen beimessen, zeigt, dass Paypal mit rund 325 Milliarden Dollar einen fast so großen Marktwert wie die Bank of America Corp hat, die zweitgrößte Bank der USA nach Vermögenswerten.
Fintechs ziehen damit auch die Aufmerksamkeit der nationalen Behörden auf sich, die damit beschäftigt sind, die regulatorischen Rahmenbedingungen in Echtzeit neu zu gestalten. So wurde der Börsengang des chinesischen Finanztechnologiekonzerns Ant Group Co. im vergangenen November von Peking untersagt.
Abgesehen von den finanziellen Risiken und dem Verbraucherschutz wirft die Präsenz von Big-Tech-Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich Fragen zur Datenverwaltung und zu kartellrechtlichen Angelegenheiten auf, so das Papier, was zu einem „systemischen Fußabdruck im Finanzsystem“ führen könnte.
Die aktuellen Regeln, die zur Bewältigung von Problemen wie Kredit- und Liquiditätsrisiken gelten, könnten bei der Regulierung von Fintechs zu kurz greifen, so die Organisation, die die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit der Zentralbanken mit den Behörden für Wettbewerb und Datenschutz hervorhebt.
Die BIZ, die oft als die Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet wird, koordiniert die Entwicklung einheitlicher Finanzvorschriften auf der ganzen Welt. Obwohl sie keine direkte Befugnis hat, Vorschriften zu erlassen, gilt die BIZ als einflussreicher Schiedsrichter in Fragen der Finanzregulierung auf globaler Ebene. Das am Montag veröffentlichte Papier wurde von BIZ-Mitarbeitern verfasst, stellt aber keine spezifische politische Position der Organisation dar.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte im vergangenen November in einer Rede, dass der Aufstieg der Fintechs die Regulierungsbehörden dazu zwingen werde, „eine ganzheitlichere Mischung aus Finanzregulierung, Kartellpolitik und Datenschutzregulierung“ anzustreben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53569399-fintechs-staerker-wie-banken-regulieren-biz-papier-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): DIW: Protektionistische US-Handelspolitik schadet Wirtschaft weltweit – DJN, 4.8.2021

GRAPHIK: https://www.diw.de/html/wb/21-31/article1/image/figure1-single.png
Die protektionistische Handelspolitik der USA hat nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nicht nur der US-Wirtschaft, sondern fast allen Handelspartnern geschadet. Demnach haben die Finanzmärkte auf Zollerhöhungen und andere restriktive Maßnahmen der Trump-Administration bis zu 100 Handelstage, also rund fünf Monate lang, signifikant negativ reagiert. Das DIW betonte, erst Ende Juli habe US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der „Buy America“-Politik angekündigt und führe damit die protektionistische Handelspolitik seines Amtsvorgängers Donald Trump fort.
Für die Studie haben die DIW-Ökonomen Lukas Boer, Lukas Menkhoff und Malte Rieth die einzelnen US-handelspolitischen Ankündigungen und Umsetzungen von 2017 bis 2020 identifiziert und in Beziehung zu den Entwicklungen der Finanzmärkte gesetzt. „An den Reaktionen der Finanzmärkte lässt sich die Erwartung der Marktteilnehmer auch auf längere Sicht ablesen“, erklärte Rieth. „Nach neuen handelspolitischen Ankündigungen der US-Regierung gaben die Aktien- und Anleihemärkte deutlich nach.“ Nur der Dollar werte als sicherer Hafen auf, was aber dem US-Export nicht förderlich sei.
Vor allem in China engagierte US-Firmen haben die Restriktionen beeinträchtigt, zeigt laut den Angaben ein speziell für diese Auswertung zusammengestellter Index. Ihre Aktienkurse gaben nach neuen Ankündigungen von Zollerhöhungen im Schnitt um 1 Prozent nach. Nur wenige US-Branchen wie die exportunabhängigen Versorger oder Immobilienunternehmen ließ die protektionistische Handelspolitik demnach weitestgehend unbeeindruckt, die übrigen neun US-Branchen mussten aber nach neuen Maßnahmen signifikante Einbußen hinnehmen, insbesondere der Technologiesektor und die Industrie.

GRAPHIK: https://www.diw.de/sixcms/media.php/37/thumbnails/WB31-2021-US-Handelspolitik-Infografik.png.592363.png
Chinas Vergeltungsmaßnahmen wirkten noch einmal zusätzlich negativ, die US-Realwirtschaft sei somit doppelt getroffen. Die Restriktionen schadeten nicht nur der US-Wirtschaft: Die Maßnahmen gegen China hätten darüber hinaus auch die Aktienleitindizes sehr vieler US-Handelspartner belastet, vor allem in Lateinamerika und Europa. „Da nur wenige Unternehmen und Länder vom US-Protektionismus profitiert haben, liegt die Rationalität dieser Politik offensichtlich nicht in ökonomischen Gewinnen“, konstatierte Menkhoff. Mit der jüngst verschärften „Buy America“-Strategie scheine Biden vor allem innenpolitisch beruhigen zu wollen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53590708-diw-protektionistische-us-handelspolitik-schadet-wirtschaft-weltweit-015.htm
SIEHE DAZU:
=> Protektionistische US-Handelspolitik schadet der Wirtschaft weltweit – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, 4.8.2021
QUELLE: https://www.diw.de/de/diw_01.c.822678.de/protektionistische_us-handelspolitik_schadet_der_wirtschaft_weltweit.html
=> Studie im DIW-Wochenbericht 31/2021
QUELLE (inkl. instruktiver Schaubilder: https://www.diw.de/de/diw_01.c.822699.de/publikationen/wochenberichte/2021_31_1/restriktive_us-handelspolitik_wirkt_signifikant_negativ_auf_finanzmaerkte.html
BÖRSE
SENTIX-Sentimente: Erstaunlich wenig Jubel, erstaunlich wenig Angst – Chinas Aktienmarkt angeschlagen – Feuer von der Zinsfront: US-Anleihen geraten bei Professionellen in Argwohn – DAX geniesst ungebrochenes Anlegervertrauen – Sentix, 8.8.2021
Der chinesische Aktienmarkt bleibt angeschlagen, den übrigen großen Aktienmärkten scheint dies bislang nichts anhaben zu können. Nun gibt es mit den Zinsen das nächste potentielle Störfeuer. Die Institutionellen nehmen von der Problematik stärkere Witterung auf, viel stärker als die Privatanleger. Der Insti-Bias zu Euro-Langfristanleihen fällt auf ein neues Verlaufstief. Im gleichen Zug stehen Edelmetalle mächtig unter Druck. Die Anleger-Reaktion ist von erstaunlicher Gelassenheit gekennzeichnet.
Weitere Ergebnisse: * Aktien: Erstaunlich wenig Jubel * Renten: Erstaunlich wenig Ängste * Edelmetalle: Erstaunlich wenig Ängste
Keine Jubelstimmung für US-Aktien trotz Indexanstieg, aber eine für den Frankfurter Aktienmarkt; dort herrscht übermäßiges Vertrauen in die (bisherige und künftige) Kursentwicklung.
Wird angesichts des starken US-Arbeitsmarktes die FED die Zinsen früher als erwartet erhöhen? Ein Schuß ins Knie US-amerikanischer Anleihen droht; davon wären dann auch deutsche Bundesanleihen negativ betroffen.
Edelmetalle im Abwärtstrend – trotz positivem Sentiment.
QUELLE (REGISTRIERPFLICHT): https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-32-2021.html
USA: Martin Lüscher: Anleger zeigen sich unbeeindruckt – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 5.8.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/08/20210803-beats-640×423.png
Erfolgreicher könnte die US-Berichtssaison kaum sein. Von mehr als der Hälfte der Unternehmen aus dem marktbreiten Aktienindex S&P 500, die bis vergangene Woche ihre Zahlen präsentiert hatten, übertrafen laut Factset 88% die Erwartungen beim Gewinn oder beim Umsatz – so viele wie seit der Finanzkrise nicht mehr.
So hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr ist auch das Gewinnwachstum von 85%. Vor dem Beginn der Berichtssaison wurde ein Wachstum von 63% erwartet. Ein Rekord, seit 2012 die Daten erhoben werden, ist zudem mit 78% der Anteil der Unternehmen, die laut der Grossbank JPMorgan ihre Prognose für das Gesamtjahr erhöht haben.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2112/
USA – Sylvia Walter: Gefährlicher August – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 2.8.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/08/seasonality-aktien-640×330.png
Bis Ende Juli hat der S&P 500 in diesem Jahr bereits sechs Monate in Folge mit Kursgewinnen geglänzt. Das ist die längste Erfolgssträhne des US-Leitindex seit dem Jahr 2018.
Analysten beschäftigen sich immer wieder gerne damit, die Saisonalitäten von Aktienindizes aufzuspüren, indem sie deren Performance Monat für Monat über einen langen Zeithorizont ermitteln. Die Experten der Deutschen Bank haben sich die Jahre von 2010 bis 2020 vorgeknöpft, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ist für Aktienanlagen im gerade angebrochenen Monat Vorsicht geboten. Der August weist die höchste Zahl mit negativer Monatsperformance aus – in sechs der elf analysierten Jahre schloss der S&P 500 mit Kursverlusten ab.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2109/
ZENTRALBANKEN
– GROSSBRITANNIEN / BoE
Hans Bentzien: Bank of England lässt Geldpolitik unverändert – DJN, 5.8.2021
Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie weithin erwartet unverändert gelassen. Wie die BoE nach der Sitzung ihres geldpolitischen Ausschusses mitteilte, bleiben der Leitzins auf seinem Rekordtief von 0,10 Prozent und das Zielvolumen der Anleihekäufe bei 895 Milliarden Pfund, wobei 875 Milliarden auf Gilts entfallen.
Die Zinsentscheidung fiel mit acht zu null Stimmen, die zu den Anleihekäufen mit 7 zu eins Stimmen. Michael Saunders votierte dafür, das Volumen der Gilts-Käufe auf 830 Milliarden Pfund zu reduzieren. An der Sitzung nahmen nur acht Mitglieder teil.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53605309-bank-of-england-laesst-geldpolitik-unveraendert-015.htm
– EUROPÄISCHE UNION / EZB
EZB-Rat Kazaks gegen schnelle Entscheidung über Zukunft des Pepp-Programms – Warnung vor zu frühem Austritt aus PEPP – Mit Blick auf die Septembersitzung der EZB: steigende Infektionszahlen werden Entscheidung über PEPP wahrscheinlich beeinflussen – dpa-AFX, 4.8.2021
Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Martins Kazaks, hat sich gegen eine schnelle Entscheidung über die Zukunft des Krisenprogramms Pepp zum Kauf von Anleihen ausgesprochen. Es sei noch zu früh für eine Entscheidung, ob und wie das Pepp-Programm verändert werden könne, sagte Kazaks am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies auf die wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise. Es würden neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie drohen, die eine Gefahr für die konjunkturelle Erholung darstellen.
Es gebe derzeit keine Notwendigkeit für eine Entscheidung über den weiteren Verlauf des Pepp-Programms, sagte Kazaks, der auch der Notenbank von Lettland vorsteht. „Die Zukunft des Programms wird diskutiert werden, aber eine Entscheidung wäre derzeit verfrüht“, sagte der Notenbanker.
Am Markt wurde zuletzt eine Entscheidung zur weiteren Entwicklung des Pepp-Programms auf der Zinssitzung des EZB-Rates im September nicht ausgeschlossen. Auf der September-Sitzung werden neue Projektionen zur weiteren Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone vorliegen. Das Krisenprogramm Pepp zur Stützung der Wirtschaft im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise soll noch bis zum März 2022 laufen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53590732-ezb-rat-kazaks-gegen-schnelle-entscheidung-ueber-zukunft-des-pepp-programms-016.htm
– DEUTSCHLAND / DBB
Bundesbank-Präsident Weidmann warnt Finanzminister der Euro-Zone: bei steigender Inflation kann EZB nicht auf Finanzierungskosten der Staaten Rücksicht nehmen – Pandemie vorbei, PEPP vorbei – Nicht ewig: bei steigender Teuerung wird APP beendet werden . Weidmann: aktuell erscheint Inflation mit 3,8 Prozent nur vorübergehend überhöht, längerfristig ist aber mit Steigerung der Teuerung zu rechnen – DJN, 8.8.2021
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die Mitgliedstaaten des Euro-Raums davor gewarnt, bei der Finanzierung ihrer wachsenden Staatsschulden auf die Schützenhilfe der Europäischen Zentralbank zu setzen. „Die EZB ist nicht dazu da, sich um die Solvenzsicherung der Staaten zu kümmern“, sagte Weidmann in einem Welt am Sonntag-Interview. Sollten die Inflationsaussichten nachhaltig ansteigen, müsste die EZB die Geldpolitik straffen. „Wir können dann auf die Finanzierungskosten der Staaten keine Rücksicht nehmen“, so Weidmann.
Die aktuelle Inflationsrate von 3,8 Prozent in Deutschland sei derzeit durch vorübergehende Sonderfaktoren getrieben und werde sich anschließend wieder normalisieren, sagte der Bundesbankchef weiter. Langfristig rechnet er allerdings damit, dass sich der Preisauftrieb im gesamten Euro-Raum beschleunigt. „Ich halte auch höhere Inflationsraten nicht für ausgeschlossen“, sagte er und betonte: „Ich werde jedenfalls darauf drängen, auch das Risiko einer zu hohen Inflationsrate genau im Blick zu behalten und nicht nur auf das Risiko einer zu niedrigen Inflationsrate zu schauen.“
Nach der Sommerpause soll im EZB-Rat über die Modalitäten der Anleihekaufprogramme diskutiert werden. Weidmann machte deutlich, wo er die Grenzen dieser monetären Hilfen sieht: „Das Notfall-Kaufprogramm PEPP muss beendet werden, wenn die Krise zu Ende ist. Das erste P steht schließlich für pandemisch und nicht für permanent“, sagte er. „Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.“ Auch das Kaufprogramm APP könne nicht unendlich fortgeführt werden. „Auch das werden wir einstellen, sobald es der Preisausblick hergibt“, sagte Weidmann.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53624215-bundesbank-praesident-weidmann-warnt-finanzminister-der-euro-zone-015.htm
Hans Bentzien: Bundesbank veröffentlicht Target2-Monatsdurchschnittswerte – DJN, 6.8.2021
Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht ab August 2021 zusätzlich zu den Monatsendwerten auch die Monatsdurchschnittswerte des deutschen Saldos des Großbetragzahlungssystems Target2 auf ihrer Website. Das ermöglicht eine genauere Einschätzung der Saldoentwicklung. Bislang werden von der Bundesbank lediglich Monatsendwerte ausgewiesen. Die Monatsendwerte und insbesondere die Quartals- und Jahresendwerte seien häufig von Stichtagseffekten beeinflusst, die mit stärkeren Ausschlägen verbunden sein könnten, teilte die Bundesbank mit.
Darin schlügen sich oft Verlagerungen von Einlagen nieder, die Anleger und Kreditinstitute mit Blick auf Bilanzstichtage aus Portfolio- und Liquiditätsüberlegungen vornehmen. Nicht selten komme es dabei kurzfristig zu größeren grenzüberschreitenden Liquiditätsströmen. Eine Darstellung des Target2-Saldos anhand von Monatsdurchschnittswerten glättet laut Bundesbank solche Stichtagseffekte, so dass der von längerfristigen Faktoren bestimmte Trend der Saldoentwicklung besser erkennbar wird.
Die Nettoforderungen bzw. -verbindlichkeiten der nationalen Zentralbanken des Eurosystems bestehen gegenüber der Europäischen Zentralbank (EZB).
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618513-bundesbank-veroeffentlicht-target2-monatsdurchschnittswerte-015.htm
– ÖSTERREICH / OeNB
Österreichische Banken mit solidem Ergebnis beim europäischen Stresstest – Kapitalaufbau der letzten Jahre zeigte Wirkung und erhöhte die Krisenresistenz des Bankensektors – Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld – Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider – Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit – OeNB, 30.7.2021
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäischen Zentralbank (EZB), in Kooperation mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie den anderen nationalen Aufsichtsbehörden, haben 89 europäische Banken einem Stresstest unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen dem europäischen Bankensektor eine gute Krisenresistenz. Durch Reduktion von Problemkrediten und Kostenreduktionen konnte ein deutlich härteres Szenario als beim Stresstest 2018 bewältigt werden.
*** Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld ***
Auch die sechs österreichischen Banken, die am Stresstest teilgenommen haben, zeigten sich widerstandsfähig, insgesamt landeten sie im europäischen Mittelfeld. Die Performance der einzelnen Banken ist dabei durchaus heterogen, was auch an ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen liegt. Nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sind die Aktivitäten der Banken in einigen Ländern (u. a. auch in Österreich) weniger stark betroffen als in anderen. Zusammen mit der Ausgangskapitalisierung, mit der die Banken in den Stresstest starten, ist dies ein wesentlicher Treiber der Ergebnisse. Alle österreichischen Banken erfüllen auch nach Anwendung des harten Stress-Szenarios die gesetzlichen Kapitalanforderungen.
„Die Pandemie hat gezeigt, dass der von der Aufsicht vorgezeichnete Weg zur Verbesserung der Kapitalbasis der österreichischen Banken ein richtiger war. Somit sind sie in der Lage, der Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner zur Verfügung zu stehen. Um auch für künftige Krisen gewappnet zu sein, muss dieser Weg fortgesetzt werden“, sagte FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse.
„Das Ergebnis entspricht unseren Erwartungen, es ist aber auch kein Grund zum Feiern“, ergänzte OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. „Die Banken müssen weiter an ihrer Kosteneffizienz arbeiten, die Profitabilität verbessern und bei Gewinnausschüttungen Zurückhaltung üben, um Kapital aufzubauen“, so Haber weiter.
*** Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider ***
Der Stresstest untersuchte die Auswirkungen eines hypothetischen dreijährigen Schocks auf die Bilanzen der Banken. Aufgrund der Prognoseunsicherheit durch die COVID-19-Pandemie wurde ein härteres Szenario als beim letzten europäischen Stresstest 2018 gewählt. Die Aufsicht unterstellte für den Stresstest eine länger andauernde Pandemie mit einem starken Wirtschaftseinbruch und höherer Arbeitslosigkeit. Negative Wechselkursentwicklungen, sinkende Immobilienpreise und steigende Kreditausfälle führen im Szenario zu Verlusten, die die Kapitalquoten der Banken schmelzen lässt.
*** Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit ***
Für die Bankenaufsicht liefert der Stresstest wichtige Ergebnisse. Es gibt jedoch keine definierte Schwelle, ab der eine Bank als „durchgefallen“ gilt. Vielmehr werden aus dem gesamten Prozess qualitative und quantitative Erkenntnisse gewonnen, die in die Beurteilung der Banken einfließen und zur Bestimmung von Kapitalsicherheitspuffern verwendet werden. Je nach Risikoprofil der einzelnen Bank können diese höher oder niedriger ausfallen.
*** Hintergrundinformation ***
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) führt gemeinsam mit dem Europäischen Rat für Systemrisiken (ESRB), der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Behörden alle zwei Jahre einen EU-weiten Stresstest für größere Banken durch. Der letzte derartige Stresstest fand 2018 statt, der ursprünglich für 2020 geplante wurde aufgrund der Pandemiesituation auf 2021 verschoben. In den Stresstest einbezogen waren 89 Banken aus dem Euroraum, die zusammen etwa 75 % der Total Assets des Sektors ausmachen. Für 38 Banken (aus Österreich: Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der Stresstest unter der Führung der EBA ab. Bei den restlichen Banken (aus Österreich: Bawag, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Volksbanken und Sberbank) ist die EZB im Lead. Die Ergebnisse aller Banken werden veröffentlicht. Für die erste Gruppe veröffentlicht die EZB detaillierte Ergebnisse auf ihrer Website. Für die zweite Gruppe (mit tendenziell etwas kleineren Banken) veröffentlicht die EZB wichtige Kennzahlen und beschränkt sich, was die Auswirkung auf die Kapitalquote betrifft, auf Größenordnungen.
Parallel führen auch OeNB und FMA einen Stresstest für jene österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Ende November im Financial Stability Report veröffentlicht.
QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20210730.html
USA
Defizit in der US-Handelsbilanz gestiegen – DJN/dpa-AFX, 5.8.2021
Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juni geringer als erwartet gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 75,75 Milliarden Dollar nach revidiert 70,99 (vorläufig: 71,24) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 74,20 Milliarden Dollar gerechnet. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Defizit von 74,2 Milliarden Dollar gerechnet.
Ausschlaggebend für die Entwicklung war, dass die Importe stärker stiegen als die Exporte. Die Einfuhren legten um 2,1 Prozent zum Vormonat zu, während die Ausfuhren um 0,6 Prozent stiegen.
Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 207,67 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 283,421 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 2,1 Prozent.
Das Handelsdefizit der USA ist chronisch. Die Importe sind anhaltend höher als die Exporte. Die Vereinigten Staaten sind ein typisches Nettoimportland. Sie finanzieren das Defizit durch Auslandskredite. Die Kapitalmärkte der USA sind attraktiv, auch weil die Vereinigten Staaten mit dem Dollar über die Weltleitwährung verfügen. Die größten ausländischen Kreditgeber der USA sind China und Japan. Sie halten die größten Bestände an US-Staatsanleihen – abgesehen von der amerikanischen Notenbank Fed
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606493-defizit-in-der-us-handelsbilanz-gestiegen-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606344-usa-handelsbilanzdefizit-steigt-staerker-als-erwartet-016.htm
EIA meldet gestiegene US-Rohöllagerbestände – DJN, 4.8.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Juli ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,637 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,089 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 0,879 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,291 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,253 Millionen gesunken waren. Die API-Daten hatten einen Rückgang von 5,8 Millionen Barrel angezeigt. Die Ölproduktion in den USA blieb in der Woche mit 11,2 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53595913-us-rohoellagerbestaende-gestiegen-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände – DJN, 4.8.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,8 Millionen Barrel nach minus 6,2 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,6 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53588005-api-daten-zeigen-rueckgang-der-us-rohoellagerbestaende-015.htm
Ölpreise geraten unter Druck – Ausbreitung der Delta-Variante belastet – dpa-AFX, 3.8.2021
Die Ölpreise sind am Dienstag erneut unter Druck geraten. Sie knüpften so an ihre Vortagesverluste an. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,37 US-Dollar. Das waren 53 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 80 Cent auf 70,46 Dollar.
Bereits am Montag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus führenden Volkswirtschaften der Welt die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. Es waren die stärksten Tagesverluste seit zwei Wochen. In den USA und in China waren Indikatoren für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie jeweils gesunken. Das schürte am Ölmarkt die Sorge vor einer schwächeren Nachfrage.
Vor allem aber bleibt die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eine Belastung. In China haben die jüngsten Ausbrüche die Hälfte der 32 Provinzen getroffen. So wurde erneut der Flugverkehr beschränkt. Einschränkungen der Mobilität dämpfen auch die Nachfrage nach Rohöl. Zuletzt hatte beispielsweise die australische Fluggesellschaft Qantas auf Corona-Maßnahmen reagiert und 2500 Mitarbeiter vorübergehend freigestellt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53584085-oelpreise-geraten-unter-druck-ausbreitung-der-delta-variante-belastet-016.htm
Murat Sahin u.a.: ISM-Index für US-Industrie fällt im Juli – DJN/dpa-AFX, 2.8.2021
Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Juli verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 59,5 (Vormonat: 60,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 60,8 prognostiziert.
Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 64,9 (Vormonat: 66,0), jener für die Beschäftigung legte zu auf 52,9 (Vormonat: 49,9).
Der Index für die Produktion gab nach auf 58,4 (Vormonat: 60,8), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 85,7 (Vormonat: 92,1) auswies.
Deutlich gesunken ist der Indikator für die erhaltenen Preise, der sich allerdings immer noch auf einem hohen Niveau befindet. Gegen den Trend verbessert hat sich der Beschäftigungsindikator.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53571964-ism-index-fuer-us-industrie-faellt-im-juli-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53571589-usa-industriestimmung-truebt-sich-ueberraschend-ein-016.htm
USA: Industrie erhält im Juni mehr Aufträge als erwartet – dpa-AFX, 3.8.2021
Die US-Industrieunternehmen haben im Juni mehr Aufträge erhalten als erwartet. Die Bestellungen seien um 1,5 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet. Im Mai waren die Aufträge um revidiert 2,3 Prozent (zunächst 1,7 Prozent) gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Juni um 1,4 Prozent.
Die Auftragseingänge für langlebige Güter stiegen im Juni laut einer zweiten Schätzung etwas stärker als zunächst ermittelt. Sie legten um 0,9 Prozent zum Vormonat zu. In einer ersten Schätzung war noch eine Anstieg von 0,8 Prozent ermittelt worden. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge für langlebige Güter um 0,5 Prozent. Hier war zunächst ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53583182-usa-industrie-erhaelt-mehr-auftraege-als-erwartet-016.htm
USA: Bauausgaben steigen im Juni weniger als erwartet – dpa-AFX, 2.8.2021
In den USA sind die Bauausgaben im Juni weniger als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet.
Allerdings ist der Rückgang im Vormonat nicht ganz so stark wie erwartet ausgefallen. Demnach sind die Bauinvestitionen im Mai nur um 0,2 Prozent gefallen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,3 Prozent gemeldet worden war.
In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren die Ausgaben kurzzeitig deutlich zurückgegangen. Der Rückgang ist aber inzwischen aufgeholt. Die Bauwirtschaft erholte sich seit Mitte des vergangenen Jahres von der Corona-Krise. Zuletzt leidet die Branche jedoch unter Materialengpässen und Preissteigerungen für Baustoffe.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53571716-usa-bauausgaben-steigen-weniger-als-erwartet-016.htm
Hans Bentzien: ISM-Index Dienstleistungen im Juli deutlich höher als erwartet – DJN, 4.8.2021
Das Wachstum im Dienstleistungssektor der USA ist im Juli deutlich höher als erwartet gewesen, wobei auch die Beschäftigung deutlicher als zuvor zunahm. Der von Institute für Supply Management (ISM) erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 64,1 (Juni: 60,1) Punkte, während Volkswirte einen Anstieg auf nur 60,5 Punkte prognostiziert hatten. Der Aktivitätsindex legte auf 67,0 (60,4) zu, der Index der Auftragseingänge auf 63,7 (62,1) und der Beschäftigungsindex auf 53,8 (49,3) Punkte. Der Preisindex kletterte auf 82,3 (79,5) Punkte.
Der von IHS Markit kurz zuvor veröffentlichte Einkaufsmanagerindex hatte dagegen eine Wachstumsverringerung angezeigt. Zudem hatte ADP hatte einen unerwartet schwachen Anstieg der Beschäftigung im privaten Sektor gemeldet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53595040-ism-index-dienstleistungen-im-juli-deutlich-hoeher-als-erwartet-015.htm
Markit: US-Dienstleister wachsen im Juli schwächer – DJN, 4.8.2021
Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im Juli schwächer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank auf 59,9 von 64,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 59,8 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 59,8 ermittelt worden. Insgesamt hat sich auch das Wachstum der US-Wirtschaft im Juli verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel auf 59,9 von 63,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.
„Das Tempo des US-Wirtschaftswachstums hat sich im Juli abgekühlt, es bleibt aber nach den endgültigen PMI-Daten beeindruckend stark und deutet darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal wieder kräftig steigen wird“, erklärte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Umfrage zeige allerdings erneut, dass die Kapazitäten durch einen Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften eingeschränkt werde, so dass der Inflationsdruck auch in den kommenden Monaten anhalten werde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53594891-markit-us-dienstleister-wachsen-im-juli-schwaecher-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en
USA: Ein-Personen-Firmen leiden unter Corona – 81 Prozent hatten 2020 laut aktueller FED-Untersuchung wegen Pandemie finanzielle Probleme – Pressetext, 4.8.2021
Ein-Personen-Firmen in den USA haben unter den Folgen der Corona-Pandemie am stärksten gelitten. 76 Prozent beklagen einen Umsatzrückgang im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage der regionalen Federal-Reserve-Banken (FED), Ableger der US-Notenbank http://federalreserve.gov , zeigt. Nur 13 Prozent verzeichneten ein Umsatzwachstum, so die Cleveland Fed, die die Umfrage geleitet hat. Das Ergebnis zeige, dass die kleinsten Unternehmen stärker gelitten haben als große Unternehmen.
*** Hilfsfonds sehr gefragt ***
32 Prozent der Befragten bezeichneten ihre wirtschaftliche Situation als schlecht. Sogar 81 Prozent kämpften 2020 mit finanziellen Problemen. Verglichen mit größeren Unternehmen wandten sich die Inhaber der Ein-Personen-Betriebe häufiger an Hilfsfonds, um Überbrückungsgelder zu bekommen.
Trotz steigender Inflationsraten in den USA und einem deutlichen Aufschwung der Wirtschaft belässt die FED die Anleihekäufe im Rahmen des Hilfsprogramms PEPP auf hohem Niveau, schreibt das „Handelsblatt“. Doch Notenbankchef Jerome Powell hat diese Woche signalisiert, dass die FED künftig bei den Anleihekäufen auf die Bremse treten könnte.
*** FED: Weniger Anleihekäufe ***
Die Anleihekäufe über 120 Mrd. Dollar pro Monat sollten so lange beibehalten werden, bis „erhebliche Fortschritte“ bei Preisstabilität und Arbeitslosigkeit erreicht seien. Dieses Ziel sei zwar in greifbare Nähe gerückt, betont die FED, jedoch noch nicht erreicht. In den kommenden Sitzungen würden Powell und Kollegen den Fortschritt prüfen. Der starke Anstieg der Inflation ist laut dem Notenbankchef ein vorübergehendes Phänomen.
Ökonomen zeigen sich indes wenig überrascht über die FED-Politik. „Die US-Notenbanker haben heute keine wesentlichen neuen geldpolitischen Pflöcke eingerammt, aber sie signalisieren, dass ein Zurückfahren des Anleihekaufprogramms langsam, aber sicher näher rückt“, unterstreicht Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg http://lbbw.de .
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210804003
USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet – dpa-AFX, 6.8.2021
In den USA sind die Verbraucherkredite im Juni stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat habe die Kreditvergabe um 37,69 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Mittel einen Anstieg um 23,00 Milliarden Dollar erwartet. Im Mai hatte die Kreditvergabe um revidierte 36,69 Milliarden Dollar (zuvor: 35,28) zugelegt.
USA: Stundenlöhne steigen stärker als erwartet – dpa-AFX, 6.8.2021
In den USA sind die Löhne im Juli erneut gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten nur einen Lohnzuwachs um 0,3 Prozent erwartet.
Wie das Ministerium weiter mitteilte, war der Anstieg der Stundenlöhne im Juni stärker als bisher bekannt ausgefallen. Der Zuwachs wurde im Monatsvergleich von 0,3 Prozent auf 0,4 Prozent nach oben revidiert.
Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne weiter deutlich und legten im Juli um 4,0 Prozent zu.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618284-usa-stundenloehne-steigen-staerker-als-erwartet-016.htm
ADP: US-Privatsektor schafft im Juli weitaus weniger Stellen als erwartet – DJN, 4.8.2021
Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft hat im Juli weitaus weniger als erwartet zugenommen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden nur 330.000 zusätzliche Stellen. Analysten hatten ein Plus von 653.000 vorausgesagt. Im Juni waren nach endgültigen Zahlen 680.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 12.000 weniger als ursprünglich gemeldet.
„Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt verläuft weiterhin uneinheitlich, aber er hält an“, erklärte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. Das Beschäftigungswachstum habe sich gegenüber dem zweiten Quartal stark verlangsamt. Am schnellsten nehme die Beschäftigung weiterhin im Freizeitsektor und in der Gastronomie zu.
Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 460.000 US-Unternehmen mit etwa 26 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.
Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen bisher damit, dass im Juli auf der Basis des offiziellen Jobreports 845.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 5,7 (zuvor: 5,9) Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53593788-adp-us-privatsektor-schafft-weitaus-weniger-stellen-als-erwartet-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.adpemploymentreport.com/
Hans Bentzien u.a.: US-Beschäftigtenzahl höher als erwartet – Arbeitslosigkeit sinkt – DJN/dpa-AFX, 6.8.2021
Die US-Wirtschaft hat im Juli mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist im Juli besser als erwartet gewesen. Die Stellenzahl stieg stärker als prognostiziert, zudem fielen der Rückgang der Arbeitslosigkeit und der Anstieg der Stundenlöhne unerwartet deutlich aus. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 943.000. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 845.000 prognostiziert. Von dpa-AFX befragte Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von im Schnitt 870 000 Stellen gerechnet.
Den für Juni ursprünglich gemeldeten Anstieg von 850.000 revidierten die Statistiker auf 938.000, für Mai wurde ein revidiertes Plus von 614.000 (vorläufig: 583.000) angegeben. Zusammengenommen war der Beschäftigungszuwachs damit um 19.000 höher als bisher angenommen.
Die Arbeitslosenquote sank auf 5,4 (Juni: 5,9) Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 5,7 Prozent prognostiziert. Zugleich erhöhte sich die Erwerbsquote, der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, auf 61,7 (61,6) Prozent.
Die Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,36 Prozent bzw. 0,11 US-Dollar auf 30,54 Dollar. Ökonomen hatten ein Plus von nur 0,30 Prozent erwartet.
Zu Beginn der Corona-Krise war die Beschäftigung im Frühjahr 2020 mit Rekordtempo eingebrochen. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt. Allerdings sind immer noch viele Millionen Amerikaner ohne Job.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618584-us-beschaeftigtenzahl-hoeher-als-erwartet-arbeitslosigkeit-sinkt-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618287-usa-beschaeftigung-steigt-staerker-als-erwartet-016.htm
USA: Arbeitslosenquote fällt im Juli auf tiefsten Stand seit März 2020 – dpa-AFX, 6.8.2021
In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend stark gesunken und auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise gefallen. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einen Rückgang auf 5,7 Prozent gerechnet.
Damit erreichte die Arbeitslosenquote den tiefsten Stand seit März 2020. Damals wurden harte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt, und die Arbeitslosenquote war im April 2020 stark auf 14,8 Prozent angestiegen.
In der zweiten Jahreshälfte 2020 war die Quote dann wieder deutlich gesunken. Seit März stockte allerdings die Erholung am Arbeitsmarkt und die Arbeitslosenquote hielt sich in der Nähe der Marke von sechs Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618285-usa-arbeitslosenquote-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-maerz-2020-016.htm
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wie erwartet leicht gesunken – DJN/dpa-AFX, 5.8.2021
Die Erholung des US-Arbeitsmarkts vom Corona-Einbruch hat sich mit moderatem Tempo fortgesetzt.Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 31. Juli abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 14.000 auf 385.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 385.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach unten revidiert, auf 399.000 von ursprünglich 400.000.
Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 250 auf 394.000. In der Woche zum 24. Juli erhielten 2,93 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 366.000 weniger als in der Vorwoche.
Tendenziell geht die Zahl der Erstanträge seit Beginn des Jahres zurück. Seit Anfang Juni ist die Erholung aber ins Stocken geraten, und mehrfach gab es in den vergangenen Wochen Rückschläge. Generell verbessert sich aber die Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt dank eines robusten Aufschwungs wegen enormer Staatshilfen und Lockerungen der Corona-Maßnahmen.
Die Hilfsanträge liegen trotz des Rückgangs über dem Niveau, das vor der Corona-Krise üblich war. In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606481-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-wie-erwartet-leicht-gesunken-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606345-usa-erstantraege-auf-arbeitslosenhilfe-sinken-leicht-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
CHINA
‚Caixin‘-Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit Frühjahr 2020 – dpa-AFX, 2.8.2021
In China hat sich die Stimmung in kleineren und mittelgroßen Industriebetrieben erneut eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel überraschend stark auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2020. Der „Caixin“-Index rutschte im Juli zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 50,3 Punkte, wie das Magazin am Montag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 51,0 Zähler erwartet.
Der Indexwert erreichte damit den tiefsten Stand seit Mai 2020. Damals stand er bei 50,7 Zählern. Mit dem zweiten Rückgang in Folge steht der Stimmungsindikator für Juli nur noch knapp über der sogenannten „Expansionsschwelle“ von 50 Punkten. Werte über dieser Marke deuten auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Werte unter der Marke signalisieren eine Schrumpfung.
Bereits am Samstag hatte die Regierung in Peking ihren Stimmungsindikator für die großen und staatlich dominierten Industrieunternehmen veröffentlicht. Dieser ging um 0,5 Punkte auf 50,4 Zähler zurück. Er hielt sich damit ebenfalls nur noch knapp über der Expansionsschwelle.
Ökonomen der Commerzbank sehen in den jüngsten Stimmungsdaten einen Hinweis, dass die Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt an Fahrt verlieren dürfte. Sie befürchten in den kommenden Monaten weitere Abwärtsrisiken für Chinas Wirtschaft.
Nach einem starken Jahresauftakt hat das chinesische Wirtschaftswachstum im Frühjahr an Schwung verloren. In den Monaten April bis Juni wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur um 7,9 Prozent im Jahresvergleich, nachdem im ersten Quartal noch ein Rekordwachstum um 18,3 Prozent verzeichnet wurde. Ein starker Anstieg der Rohstoffpreise und ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie gelten als Ursachen für die sich abschwächende Konjunktur.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53565707-china-caixin-industriestimmung-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-fruehjahr-2020-016.htm
Stephanie Yang: China nimmt Händler von Auto-Chips ins Visier – Chinesische Händler von Auto-Chips als Preistreiber: Maßnahmen gegen das Horten und gegen Absprachen – DJN, 3.8.2021
Chinas oberste Marktaufsichtsbehörde will gegen Händler von Auto-Chips ermitteln. Diese würden verdächtigt, die Preise während der weltweiten Chip-Knappheit in die Höhe zu treiben, wie die staatliche Behörde für Marktregulierung mitteilte.
Die Behörde will die Marktüberwachung verstärken und gegen illegale Praktiken wie Horten, und Absprachen vorgehen. Die Regulierungsbehörde nannte keine Namen von Unternehmen, gegen die ermittelt wird.
Die Automobilhersteller gehörten zu den ersten und am stärksten von der anhaltenden Chip-Knappheit der letzten Monate betroffenen Unternehmen. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern nach dem Ende der Sperrungen von Covid-19 in vielen Regionen fiel mit weit verbreiteten Unterbrechungen der Chip-Produktion zusammen. Unter anderem schlossen Ford, General Motors und die Volkswagen AG daraufhin einige Produktionslinien.
Der chinesische Automarkt wurde zwar weniger stark in Mitleidenschaft gezogen, aber die Verantwortlichen der chinesischen Automobilindustrie haben in letzter Zeit den Halbleitermangel für die rückläufigen Verkaufszahlen verantwortlich gemacht. Im Juni beendeten Chinas Autoverkäufe eine 11-monatige Wachstumsserie mit einem Rückgang von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Halbleiter sind für die Stromversorgung verschiedener elektronischer Systeme in Autos unerlässlich.
Der weltweite Wettlauf um Chips im Automobilsektor und darüber hinaus hat zu Preissteigerungen und einem boomenden Geschäft für die Zwischenhändler geführt, die elektronische Komponenten vertreiben. Nach Ansicht verschiedener Experten, darunter Branchenverbände, Chip-Broker und Fälschungsforscher, hat dies auch ein ideales Umfeld für Betrug und bösartige Akteure geschaffen.
Die chinesischen Behörden haben versprochen, Halbleiter-Lieferketten aufzubauen, die weniger von Importen abhängig sind, und haben erklärt, dass sie mit Automobilherstellern und Chipherstellern zusammenarbeiten, um Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53580497-china-nimmt-haendler-von-auto-chips-ins-visier-015.htm
GROSSBRITANNIEN
Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich wie erwartet ein – Solides Wachstum, aber Materialmangel und Mangerl an Arbeitskräften bremst – dpa-AFX, 2.8.2021
Die Industriestimmung in Großbritannien hat sich im Juli wie erwartet eingetrübt. Der Markit-Einkaufsmanagerindex fiel auf 60,4 Punkte nach 63,9 Zählern im Monat zuvor, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt.
Im Mai hatte der Stimmungsindikator noch ein Rekordhoch bei 65,6 Punkten erreicht. Seitdem ist er zwei Monate in Folge gesunken. Trotz des Dämpfers deutet der Indikator weiter auf Wachstum in der britischen Industrie hin. Der Indexwert liegt nach wie vor deutlich über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
IHS-Markit-Direktor Rob Dobson sieht das Ergebnis der Umfrage im Juli als Beleg für ein weiter solides Wachstum in der britischen Industrie. Allerdings werde auch deutlich, dass viele Unternehmen unter einer Materialknappheit und einem Mangel an Arbeitskräften leiden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53567407-grossbritannien-stimmung-in-der-industrie-truebt-sich-wie-erwartet-ein-016.htm
Großbritannien: Dienstleistungsstimmung trübt sich weniger ein als erwartet – Personalknappheit und Lieferengpässe behindern Unternehmen – dpa-AFX, 4.8.2021
Die Stimmung im Dienstleistungssektor in Großbritannien hat sich im Juli weniger stark eingetrübt als zunächst ermittelt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex der Marktforscher von IHS Markit fiel um 2,8 Punkte auf 59,6 Punkte, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 57,8 Punkte ermittelt worden. Es wird weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum angezeigt, da der Indikator deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten liegt.
„Personalknappheit und Lieferengpässe schränkten die Kapazitäten der Unternehmen stark ein, was zu einem weiteren starken Anstieg der Arbeitsrückstände führte“, erklärte IHS Markit den Rückgang. So mussten sich viele Briten zwischenzeitlich in Quarantäne begeben, weil sie Kontrakt zu Infizierten hatten.
Angesichts der fehlenden Arbeitskräfte stieg auch der Lohndruck. Zudem habe die Erholung der Nachfrage ihren Höhepunkt überschritten, schreibt Markit. Allerdings helfe die vollständige Aufhebung der Corona-Beschränkungen dem Dienstleistungssektor.
Der Gesamtindikator für die britische Wirtschaft fiel im Juli von 62,2 Punkten auf 59,2 Punkte. Auch hier war in der ersten Schätzung ein stärkerer Rückgang auf 57,8 Punkte ermittelt worden. In der Industrie hatte sich die Stimmung im Juli wie erwartet eingetrübt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53591165-grossbritannien-dienstleistungsstimmung-truebt-sich-weniger-ein-als-erwartet-016.htm
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
Alexander Kissler: Eine Umfrage in sechs europäischen Ländern zeigt: Die Unzufriedenheit mit der EU ist enorm – Deutsche und Polen sind sich oft fremd, nicht überall ist Klimaschutz das wichtigste Anliegen, Greta Thunberg spaltet, und das Judentum hat ein Imageproblem. Die Ergebnisse der ersten «Euroskopia»-Befragung überraschen an vielen Stellen – Deutsche sind in vielerlei Hinsicht EU-Skeptiker – In Polen findet eine nationale Migrationspolitik Zustimmung – Österreicher und Deutsche für einen stärkeren Grenzschutz – Kritische Einstellung gegenüber Islam und Judentum, Vorbehalte gegenüber dem Islam in Polen am grössten – Klimawandel und Rechtsextremismus treiben um, aber nicht allzu stark – Neue Zürcher Zeitung, 6.8.2021
Wenn die Europäische Union eine Wertegemeinschaft wäre, müssten ihre Bürger die mehr oder minder selben Werte teilen. Tun sie das? Oder ist bei den vielen Konfliktfeldern, aus denen die Europapolitik besteht, den meisten Menschen das nationale Hemd näher als der europäische Rock? Ein vorläufiges Licht in diese Frage bringt eine länderübergreifende Umfrage, zu der sich sechs Meinungsforschungsinstitute unter dem Namen «Euroskopia» zusammengeschlossen haben. Die Ergebnisse liegen der NZZ exklusiv in Deutschland vor. Besonders sticht aus den vielen Zahlen eine hervor: Nirgends ist die Überzeugung, die EU habe in der Corona-Krise beim Impfstoffmanagement versagt, so gross wie in der Bundesrepublik.
Einschränkend ist hinzuzufügen, dass die Institute, darunter Insa-Consulere aus Erfurt, die repräsentative Befragung von jeweils rund tausend erwachsenen Personen auf ihre sechs Heimatländer beschränkt haben. Insofern wird nicht die gesamte EU abgebildet. Mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Österreich sind aber sechs bevölkerungsreiche Staaten vertreten.
*** Die Deutschen sind in vielerlei Hinsicht EU-Skeptiker ***
Die Resultate gliedern sich in neun Themenblöcke, deren brisanteste den unterschiedlichen Blick der Bürger auf die Corona- und auf die Migrationspolitik ermittelt haben. Aber auch das Kapitel zur Wirtschaftspolitik lässt aufhorchen. Die Auffassung, einen Weg aus der ökonomischen Covid-19-Krise sollten die Länder lieber allein und jedes für sich finden, wird am stärksten in Deutschland vertreten und am geringsten in Polen – mit 47,3 contra 22,3 Prozent. Die Deutschen sind in vielerlei Hinsicht EU-Skeptiker.
Nicht nur auf diesem Feld liegen politisch wie mental Welten zwischen den Nachbarstaaten. Eine ähnliche Spreizung zeigt sich bei der Bewertung des europäischen Impfstoffmanagements. Insgesamt geben 44,4 Prozent der Befragten der EU eine gute oder sehr gute und 54 Prozent eine schlechte oder sehr schlechte Note. Die Unzufriedenheit mit der EU-Impfpolitik ist in Deutschland mit 70,7 Prozent am grössten, in Polen mit 36 Prozent am geringsten.
Bei den Deutschen findet auch die These, bei einem nationalen Alleingang hätte es mehr Impfstoff für das eigene Land gegeben, eine rekordhohe Zustimmung von 56,6 Prozent. In Spanien hielten lediglich 20,2 und in Polen sogar nur 13,1 Prozent einen einzelstaatlichen Einkauf der Vakzine rückblickend für effektiver.
Die Deutschen misstrauen dem Impfmanagment der EU
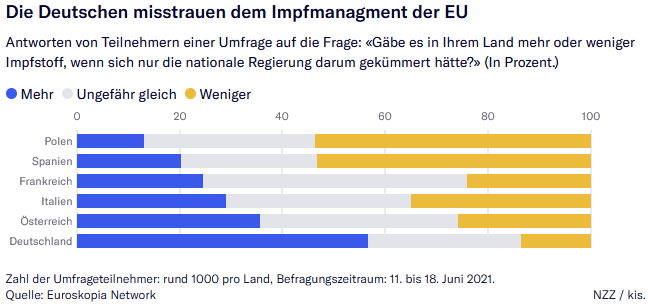
Aus der Reihe tanzt Deutschland auch, wenn sich die geografische Perspektive weitet. Immerhin rund 35 Prozent der Bundesbürger sind der Überzeugung, die EU habe eine schlechtere Impfstoffpolitik betrieben als Russland. In Spanien und Frankreich erweisen nur jeweils 27 Prozent dem Reich Putins eine solche Reverenz. Womöglich findet die alte preussische Bewunderung für den russischen Bären hier einen späten Ausläufer – AfD und Linkspartei werden es mit Wohlgefallen hören.
Die Sozialdemokratie und die Grünen wiederum könnte es freuen, dass in Deutschland die Türkei mit immerhin 6 Prozent als wichtigster Verbündeter der EU eingestuft wird; in Spanien sind es 0,8 Prozent. Als grösste Bedrohung für die EU gilt für eine Mehrheit von 31,2 Prozent China, vor Russland mit 27,3 Prozent. Am wenigsten fürchten sich die Italiener, am meisten die Polen vor der ehemaligen Sowjetunion.
*** In Polen findet eine nationale Migrationspolitik Zustimmung ***
Ein Dauerstreitfall unter den europäischen Partnern ist die Zuwanderungspolitik. Spätestens seit der einsamen Entscheidung der Bundesregierung, im Herbst 2015 die Grenzen nicht zu schliessen und Abertausende Flüchtlinge und Migranten willkommen zu heissen, gilt Deutschland als unsicherer Kantonist. Bei der Frage, ob die Migrationskrise vor allem auf nationaler oder nur auf europäischer Ebene oder durch ein Zusammenspiel gelöst werden solle, ziehen heute lediglich 22,1 Prozent der Befragten eine hauptsächlich nationale Herangehensweise vor. Satte 49,1 Prozent präferieren ein koordiniertes Vorgehen. Die meisten Verfechter einer nationalen Lösung befinden sich mit 31,9 Prozent in Polen, die wenigsten, mit 9,9 Prozent, in Spanien.
Italien und Spanien halten zugleich am heftigsten das Engagement der EU in der Migrationsfrage für ungenügend. Die Iberer erwarten demnach besonders viel von der Union und wurden stark enttäuscht. Erstaunlicherweise urteilen in diesem Punkt die Deutschen am mildesten. Nur 47,1 Prozent kritisieren die EU für ihre Migrationspolitik, in den beiden Südstaaten sind es über drei Viertel.
*** Österreicher und Deutsche für einen stärkeren Grenzschutz ***
Ein anderes Bild ergibt sich bei der Forderung, illegal in die EU eingewanderte Afrikaner abzuschieben, selbst wenn sie minderjährig sind. Hier zeigen sich Österreicher und Deutsche mit einer Zustimmung zur raschen Ausschaffung von 40,3 beziehungsweise 38,9 Prozent als besonders drakonische Grenzpolizisten. Dieselbe nachbarschaftliche Freundschaft herrscht bei der Frage, ob generell die Aussengrenzen der EU strenger überwacht werden sollten. Hier liegt die Zustimmung bei 43 Prozent in Österreich und 42,3 Prozent in Deutschland. Der Schnitt beträgt in den sechs untersuchten Ländern nur 26,9 Prozent.
Will man ein identifizierendes Merkmal ausmachen, das die EU-Bürger eint, ist es die Skepsis gegenüber dem Islam. Auf einer Skala von 1 bis 10, mit der die Kompatibilität von fünf Weltreligionen mit den europäischen Werten eingeordnet wird, erreicht der Islam magere 3,67 Punkte. Noch am wenigsten wird er in Deutschland als fremd abgelehnt, wo der Wert 4,48 beträgt. Frankreich, das unter vielen islamistischen Anschlägen litt, billigt dem Islam nur 2,69 Punkte zu. An der Spitzenposition des Christentums in allen sechs Ländern gibt es nichts zu rütteln.
*** Kritische Einstellung gegenüber Islam und Judentum ***
Stoff zum Grübeln liefert die relativ schlechte Position des Judentums. Es rangiert hinter Buddhismus und Hinduismus auf dem vorletzten Rang – mit gehörigem Vorsprung vor dem Islam. Dennoch gibt es zu denken, wenn beispielsweise in Polen die Vereinbarkeit des Judentums mit den europäischen Werten derart umstritten ist, dass die Stammreligion Jesu dort nur einen Wert von 4,44 erreicht; in Österreich liegt er bei 6,42, in Deutschland bei 6,13.
*** Vorbehalte gegenüber dem Islam in Polen am grössten ***
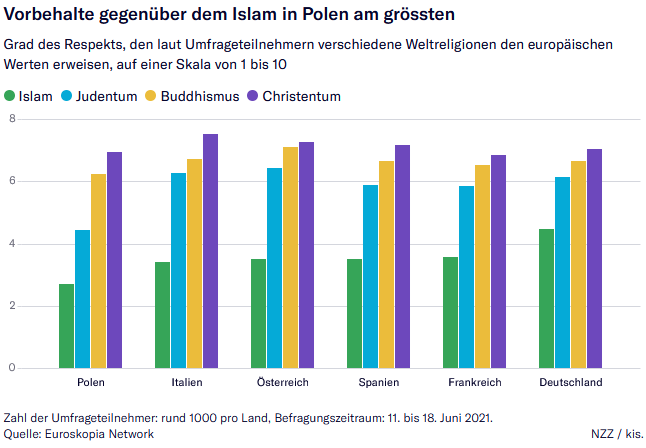
Die Wertschätzung des Buddhismus spiegelt sich in der Beliebtheit des Dalai Lama wider. Er ist in den sechs Ländern fast so bekannt wie Greta Thunberg – 79,4 contra 78,6 Prozent –, kommt aber auf deutlich bessere Zustimmungswerte: Auf einer Skala von 1 bis 10 erringt er 7,14 statt nur 4,84 Punkte. Die Klimaaktivistin spaltet, der Buddhist versöhnt – und das sogar mehr als Papst Franziskus, der sich mit 6,27 Punkten begnügen muss. Ob es den beiden geistlichen Führern freilich gelingen kann, den EU-Bürgern ihre Sorgen zu nehmen, ist fraglich. Deren gibt es viele.
*** Klimawandel und Rechtsextremismus treiben um, aber nicht allzu stark ***
Laut «Euroskopia» beschäftigt die Menschen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Österreich zwar mit 26,7 Prozent besonders der Klimawandel, aber auch die extreme Rechte und der Nationalismus treiben als künftig mutmasslich besonders mächtige Ideologien je 19,4 Prozent um. Nach Linksextremismus wurde nicht gefragt, und die Grenzen zwischen der extremen Rechten und dem Nationalismus scheinen fliessend zu sein.
Klar ist das Bild bei den ökonomischen Präferenzen, und wieder zeigt sich der vertraute deutsch-polnische Antagonismus. In Polen sehen 40,4 Prozent in der Garantie wirtschaftlicher Stärke die wichtigste Aufgabe der EU, in Deutschland lediglich 19,8 Prozent. Zwischen Kiel und Berchtesgaden erwartet man von der Europäischen Union in erster Linie und mit einem Votum von 37,4 Prozent, dass sie den Klimawandel stoppt. Dafür haben die Italiener bei einer Quote von bescheidenen 25,3 Prozent für den Klimaschutz als europäische Priorität wenig Verständnis. Und den Franzosen geht ein Leben in innen- wie aussenpolitischer Sicherheit über alles.
So mag Deutschland in der EU zwar von Freunden umgeben sein. Aber mit der Freundschaft ist das Verständnis nicht unbedingt gewachsen. Die Europäische Union bleibt die Summe ihrer nationalen Unterschiede.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/international/umfrage-zur-europaeischen-union-die-unzufriedenheit-ist-enorm-ld.1638981
SIEHE DAZU:
=> Euroskopia
QUELLE: https://euroscopia.com/
=> Euroskopia – Studies and Surveys
QUELLE: https://euroscopia.com/studies-and-surveys/
=> Eurobarometer Februar – März 2021 (englisch)
QUELLE: https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=75101
=> Eurobarometer Februar – März 2021; nationaler Bericht Österreich (deutsch)
QUELLE: https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=75290
=> Eurobarometer – Übersicht über letzte Veröffentlichungen (englisch)
QUELLE: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/latest
=> Eurobarometer – Standardumfragen (englisch)
QUELLE: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/browse/all/series/4961
Hans Bentzien: Euroraum-Erzeugerpreise steigen im Rahmen der Erwartungen – Erzeugerpreise verteuern sich auf Jahressicht um 10,3 Prozent – Deutlich weiterer Anstieg der Energiepreise – DJN, 3.8.2021
Der Anstieg der Euroraum-Erzeugerpreise ist im Juni im Rahmen der Erwartungen geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lagen um 10,2 (Mai: 9,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 1,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 10,3 Prozent prognostiziert.
Im Energiesektor stiegen die Erzeugerpreise auf Monatssicht um 3,3 Prozent. Die Erzeugerpreise von Vorleistungsgütern erhöhten sich um 1,3 Prozent, die von Investitionsgütern um 0,4 Prozent und die von Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern um jeweils 0,3 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53579134-euroraum-erzeugerpreise-steigen-im-rahmen-der-erwartungen-015.htm
Hans Bentzien: Euroraum-Industrie-PMI im Juli leicht höher als erwartet – DJN, 2.8.2021
Das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat sich im Juli etwas weniger als erwartet verlangsamt. Wie IHS Markit in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) dieses Sektors auf 62,8 (Juni: 63,4) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (62,6 Punkte) prognostiziert. Indexstände oberhalb von 50 Punkten zeigen ein Wachstum des Sektors an. „Auch diesmal legten sämtliche von der Umfrage erfassten Industriebereiche wieder kräftig zu, allen voran erneut der Investitionsgüterbereich“, heißt es in der Veröffentlichung.
Chefvolkswirt Chris Williamson äußert sich dennoch besorgt. „Die Juli-Umfrage lieferte weitere Anzeichen dafür, dass die Unternehmen und ihre Zulieferer Schwierigkeiten haben, die Produktion schnell genug zu steigern, um die Nachfrage zu befriedigen, was die Preise immer weiter in die Höhe treibt“, schrieb er. Obwohl sich die Nachfrage analog zur leicht nachlassenden Konjunkturerholung abgeschwächt habe, zeigten die Juli-Daten, dass die Auftragseingänge die Produktion in einem Ausmaß überstiegen, wie es in der 24-jährigen Umfragegeschichte noch nie vorgekommen sei.
Die Produktionssteigerungsrate schwächte sich ab und war die niedrigste seit Februar, die Auftragsbestände stiegen kräftig, und der Stellenaufbau war so stark wie nie zuvor in der 24-jährigen Umfragegeschichte. Am stärksten war der Jobaufbau in Deutschland und Österreich. Weit verbreitete Materialengpässe und die mangelnde Verfügbarkeit von Transportmöglichkeiten trieben allerdings die Einkaufspreise auf neue Höchststände, vor allem in Österreich, Deutschland und in den Niederlanden.
Da die Firmen bestrebt waren, den Kostenanstieg teilweise an ihre Kunden weiterzugeben, wurden die Verkaufspreise mit neuer Rekordrate angehoben. Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist wurden als ausgesprochen positiv bewertet.
Unter den großen Euro-Ländern verzeichnete nur Deutschland einen Indexanstieg, und zwar auf 65,9 (65,1) Punkte. Die erste Veröffentlichung hatte einen Stand von 65,6 Punkte ergeben. Frankreichs Industrie-PMI sank auf 58,0 (59,0), erwartet worden war die Bestätigung der ersten Veröffentlichung (58,1). Italiens Industrie-PMI ging auf 60,3 (62,2) Punkte zurück. Prognostiziert waren 61,5 Punkte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53567316-euroraum-industrie-pmi-im-juli-leicht-hoeher-als-erwartet-015.htm
Hans Bentzien: Industrie und Dienstleistungsgewerbe treiben: Euroraum-Wirtschaft wächst im Juli so stark wie zuletzt 2006 – Abgeschwächte Wachstumsdynamik – Inflationsdruck lässt nach – DJN, 4.8.2021
Das Wirtschaftswachstum des Euroraums hat sich im Juli etwas weniger als erwartet beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 60,2 (Juni: 59,5), wie aus den Daten der zweiten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Das war der höchste Stand seit 15 Jahren. Volkswirte hatten jedoch eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung von 60,6 Punkten prognostiziert. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des nicht-verarbeitenden Gewerbes stieg in zweiter Veröffentlichung auf 59,8 (58,3) Punkte. Volkswirte hatten erwartet, das IHS Markit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung (60,4) bestätigen würde.
„Dank der kräftigen Produktionssteigerung in der Industrie und des beschleunigten Geschäftswachstums im Service-Sektor expandierte die Eurozone im Juli so stark wie seit über 15 Jahren nicht mehr“, konstatierte IHS Markit. Die entscheidenden Wachstumsimpulse habe der Service-Sektor geliefert, wo die Geschäfte so gut wie zuletzt Mitte 2006 gelaufen seien. „Die Produktionssteigerungsrate in der Industrie schwächte sich zwar auf ein Fünfmonatstief ab, der entsprechende Index notiert allerdings noch immer höher als der Service-Index“, so IHS Markit.
Frankreichs Service-PMI ging auf 56,8 (57,8) Punkte zurück, während Italiens auf 58,0 (56,7) Punkte stieg. Erwartet worden waren Stände von 57,0 und 58,2 Punkten. Der deutsche Sammelindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 62,4 (60,1) Punkte, Frankreichs sank auf 56,6 (57,4) Punkte und Italiens legte auf 58,6 (58,3) Punkte zu.
Der Inflationsdruck stabilisierte sich im Juli nahezu. Der Anstieg der Einkaufspreise beschleunigte sich gegenüber dem Vormonat nur noch minimal, er fiel allerdings so kräftig aus wie zuletzt im September 2000. Die Verkaufspreise wurden genauso stark angehoben wie zum Rekordhoch im Juni. Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist blieben zwar ausgesprochen positiv, der Optimismus schwächte sich gegenüber dem Allzeithoch im Juni jedoch auf ein Viermonatstief ab.
„Neben dem anhaltend starken Wachstum in der Industrie bedeutet die beeindruckende Stärke der Expansion des Dienstleistungssektors im Juli, dass sich das Wachstum in der Eurozone im dritten Quartal 2021 beschleunigen dürfte“, kommentierte Chefvolkswirt Chris Williamson die Zahlen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53590649-euroraum-wirtschaft-waechst-so-stark-wie-zuletzt-2006-015.htm
Hans Bentzien: European Labour Market Barometer sinkt um 0,4 Punkte – Arbeitsmärkte in Europa scheinen trotz Barometer-Rückgang weiter im Aufwind zu sein, aber Sorge über neue Pandemie-Welle wächst – DJN, 3.8.2021
Das European Labour Market Barometer ist im Juli um 0,4 auf 104,8 Punkte gesunken. „Die europäischen Arbeitsverwaltungen sehen die Arbeitsmärkte in Europa weiter im Aufwind. Aber die Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen einer neuen Corona-Welle nimmt zu“, berichtet Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.
In allen teilnehmenden Ländern lägen die Werte des Arbeitsmarkt-Frühindikators im positiven Bereich bei 100 Punkten oder höher. Allerdings seien die Werte auch in fast allen Ländern im Vergleich zum Juni zurückgegangen oder stagnieren. Lediglich in Tschechien, Österreich und Flandern gab es demnach leichte Anstiege.
Sowohl die Komponente für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit als auch die der Beschäftigung zeigen sich leicht gedämpft. Der Teilindikator für die künftige Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist im Juli um 0,1 auf 105,6 Punkte kaum gesunken. Damit steht er über dem Teilindikator für die Entwicklung der Beschäftigung, der deutlicher um 0,8 auf 104,0 Punkte zurückging.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53577923-european-labour-market-barometer-sinkt-um-0-4-punkte-015.htm
ITALIEN
Italien: Industrieproduktion legt wieder zu – dpa-AFX, 6.8.2021
In Italien ist die Industrieproduktion im Juni nach einem schwachen Vormonat wieder gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Produktion um 1,0 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Analysten hatten diesen Zuwachs in etwa erwartet.
Im Mai war die italienische Industrieproduktion noch um 1,6 Prozent im Monatsvergleich gesunken. Während sich die Fertigung in Italien im Juni ein Stück weit erholen konnte, war sie in Deutschland und Spanien hingegen jeweils weiter gesunken, wie ebenfalls aus Daten vom Freitag hervorgeht. In Deutschland wurde der erneute Rückschlag im Juni vor allem mit einem Materialmangel erklärt.
Im Jahresvergleich stieg die italienische Industrieproduktion um 13,9 Prozent und damit ebenfalls nahezu wie erwartet. Der Anstieg im Jahresvergleich fällt vergleichsweise stark aus, weil die Fertigung im Juni 2020 wegen der Corona-Beschränkungen in der ersten Welle der Pandemie noch stark belastet war.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53615018-italien-industrieproduktion-legt-wieder-zu-016.htm
DEUTSCHLAND
Andreas Kißler (WSJ): Ifo-Institut: Volkswirte für mehr Klimaschutz – Keine Einigkeit über das Wie einer künftigen Klimapolitik – Im Fokus u.a. der CO2-Preis – DJN, 4.8.2021
Deutsche Ökonomen haben sich für mehr Klimaschutz durch die Europäische Union (EU) ausgesprochen. Das geht nach Angaben des Ifo-Instituts aus dem aktuellen Ifo-Ökonomenpanel hervor, das mit der FAZ erarbeitet werde. Danach halten es laut der jüngsten Umfrage 41 Prozent der Befragten für notwendig, dass die EU mehr für den Klimaschutz tut. 27 Prozent halten die EU-Politik für angemessen. Nur 20 Prozent fordern, es sollte weniger getan werden. Befragt wurden 171 Professoren an Universitäten.
„Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Bundesregierung auf die neue Klimapolitik der EU reagieren muss. Wenn das neue EU-Emissionshandelssystem eingeführt wird, sollte der nationale CO2-Preis abgeschafft oder zumindest grundlegend reformiert werden“, sagte die Leiterin des Ifo-Zentrums für Klima und Ressourcen, Karen Pittel.
Über die künftige Ausgestaltung der Klimapolitik sind sich die Ökonomen demnach aber nicht einig: So fordern 68 Prozent, den bestehenden EU-Emissionshandel auf Wärme und Verkehr auszuweiten. Nur 17 Prozent befürworten die gegenwärtigen EU-Pläne, zunächst ein Parallelsystem auf europäischer Ebene für Emissionen aus Wärme und Verkehr zu errichten. 60 Prozent der Professoren lehnen genaue Branchenziele für die Minderung von CO2 ab, wie sie das im Juni verabschiedete Klimaschutzgesetz vorsieht. „Die Bundesregierung hat das deutsche Klimaschutzgesetz überarbeitet, ohne das neue EU-Klima- und Energiepaket abzuwarten“, kritisierte Pittel. „Die Branchenziele sind insbesondere wenig sinnvoll, wenn ein zweites EU-Emissionshandelssystem eingeführt wird.“
54 Prozent plädieren laut den Angaben dafür, den nationalen CO2-Preis abzuschaffen, wenn CO2-Preise auf europäischer Ebene eingeführt werden. 21 Prozent wollen den nationalen CO2-Preis beibehalten. Er solle aber anrechenbar sein und sollte erhöht werden, um ambitioniertere nationale Klimaziele zu erreichen. Weitgehend einig sind sich die Ökonomen in der Ablehnung, den Auftrag der Europäischen Zentralbank auszudehnen auf das Ziel der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Nur 14 Prozent sind dafür.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53589862-ifo-institut-volkswirte-fuer-mehr-klimaschutz-015.htm
Hans Bentzien: Deutscher Industrie-PMI signalisiert Produktionsbehinderungen im Juli – DJN, 2.8.2021
Das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im Juli deutlicher als erwartet verstärkt, obwohl Materialmangel erneut die Produktion beeinträchtigte. Wie IHS Markit in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) dieses Sektors auf 65,9 (Juni: 65,1) Punkte. Das war der dritthöchste Wert seit Beginn der Datenreihe 1996. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (65,6 Punkte) prognostiziert.
Laut IHS Markit erhöhten sich auch die Neuaufträge mit der drittstärksten jemals gemessenen Rate. Dies wiederum führte trotz eines beispiellosen Beschäftigungszuwachses zu einem annähernden Rekord-Anstieg der Auftragsbestände. Die Produktionssteigerungsrate fiel erneut kräftig aus, gab gegenüber Juni aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe allerdings leicht nach. „Dies spiegelt in erster Linie die anhaltenden Unterbrechungen der Lieferketten wider, hervorgerufen durch den Mangel an Rohstoffen und Verzögerungen im Frachtverkehr“, heißt es weiter. Nach Aussage von Volkswirt Trevor Balchin gibt es aber Anzeichen dafür, dass die Lieferengpässe ihren Höhepunkt erreicht haben.
Wegen der zunehmenden Nachfrage erhöhten sich auch die Einkaufspreise ein weiteres Mal. „Mehr noch, die Inflationsrate erreichte zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten ein neues Allzeithoch“, konstatiert IHS Markit. Viele Hersteller hätten die höheren Kosten erneut an ihre Kunden weitergegeben. In der Folge stiegen auch die Verkaufspreise mit neuem Rekordtempo.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53567182-deutscher-industrie-pmi-signalisiert-produktionsbehinderungen-im-juli-015.htm
Hans Bentzien: VDMA: Auftragseingang Maschinenbau im Juni um 53 Prozent über Vorjahr – DJN, 5.8.2021
Der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau ist im Juni im Zuge der Erholung vom pandemiebedingten Einbruch im Vorjahr kräftig gestiegen. Nach Mitteilung des Branchenverbands VDMA lag er um 53 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Auslandsorders expandierten um 57 Prozent, darunter die aus den Nicht-Euro-Ländern mit 57 Prozent und die aus dem Euro-Raum mit 58 Prozent. Die Inlandsbestellungen überstiegen das Niveau des Vorjahresmonats um 45 Prozent.
„Die Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau verzeichnen insgesamt eine weiterhin sehr erfreuliche Entwicklung bei den Auftragseingängen“, kommentierte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers die Daten. Die Zurückhaltung der Kunden während der Corona-Hochphase sei eindeutig überwunden, Investitionen in Ausrüstung, Maschinen und Services stünden weltweit oben auf der Agenda.
Für das erste Halbjahr 2021 meldete der VDMA einen Auftragszuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Nach den herben Order-Einbrüchen im letzten Jahr ist die jetzige Auftragslage ein Segen – dabei konnte nicht nur die Kerbe im zweiten Quartal 2020 wettgemacht werden, das Wachstum geht oft darüber hinaus“, konstatierte Wiechers.
Im Drei-Monats-Zeitraum April bis Juni stiegen die Aufträge im Vergleich zum Vorjahr um 57 Prozent. Die Inlandsbestellungen expandierten um 46 Prozent, die Auslandsorders legten um 63 Prozent zu. Die Aufträge aus den Euro-Ländern stiegen um 64 Prozent, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 63 Prozent mehr Bestellungen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53602744-vdma-auftragseingang-maschinenbau-um-53-prozent-ueber-vorjahr-015.htm
Hans Bentzien: VDMA bestätigt Produktionsprognose 2021 trotz Materialmangel – DJN, 2.8.2021
Der Branchenverband VDMA hat seine Prognose für das Produktionswachstum im Maschinen- und Anlagenbau im laufenden Jahr trotz eines sich verschärfenden Materialmangels bestätigt. Wie der VDMA am Montag mitteilte, rechnet er weiterhin mit einem Produktionszuwachs von 10 Prozent.
„Die Unternehmen bewerteten nicht nur ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser als im Vormonat (plus 48,9 Prozent im Saldo nach plus 45,6 Prozent). Auch die Kapazitätsauslastung stieg im Juli im Vergleich zum April nochmals an und liegt mit 88,3 Prozent nun deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 85,9 Prozent“, heißt es in einer Mitteilung unter Verweis auf die jüngste Ifo-Umfrage.
Laut VDMA konnte bisher ein Anstieg der Kurzarbeit beispielsweise in Folge ausfallender Zulieferungen vermieden werden. Im Juni lag die Kurzarbeit bei etwa 52.000 Beschäftigten – und damit nur noch geringfügig über dem Vor-Corona-Niveau. Vielmehr planten zahlreiche Unternehmen Neueinstellungen und berichten über zunehmende Besetzungsprobleme in Folge von Fachkräftemangel.
„Das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Maschinen- und Anlagenbauer trotz aller Hindernisse und Herausforderungen engagiert und Willens sind, ihre Produktion zu steigern und ihre Kunden wo immer möglich zeitnah zu bedienen“, erklärte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53567586-vdma-bestaetigt-produktionsprognose-2021-trotz-materialmangel-015.htm
Hans Bentzien: Ifo: Industrie klagt massiv über Materialmangel – DJN, 2.8.2021
Fast zwei Drittel der Industriefirmen in Deutschland klagen über Engpässe und Problemen bei Vorlieferungen als Hindernis für ihre Produktion. Das geht aus der vierteljährlichen Umfrage des Ifo Instituts hervor. Von April bis Juli stieg der Anteil von 45 auf 63,8 Prozent. „Bereits im Vorquartal meldeten die Unternehmen einen Rekordwert, dieser wurde nochmals deutlich übertroffen. Das könnte zu einer Gefahr für den Aufschwung werden“, sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Zuvor lag der Spitzenwert einmal bei 20,2 Prozent im dritten Quartal 2018.
„Problematisch sind auch die teilweise stark gestiegenen Einkaufspreise“, ergänzt er. „Derzeit bedienen die Hersteller die Nachfrage noch aus ihren Lagern an Fertigwaren. Aber die leeren sich nun auch zusehends, wie sie uns mitgeteilt haben“, fügt Wohlrabe hinzu.
Die Knappheit bei Halbleitern und Chips macht sich insbesondere bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen bemerkbar (84,4 Prozent) sowie bei den Autoherstellern und ihren Zulieferern (83,4 Prozent). Die stark gestiegenen Preise für Kunststoff-Granulate machen den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren deutlich zu schaffen (79 Prozent). Bei den Herstellern elektronischer Geräte beklagen 72,2 Prozent Materialmangel, außerdem 70,3 Prozent der Maschinenbauer.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53565725-ifo-industrie-klagt-massiv-ueber-materialmangel-015.htm
Hans Bentzien: Deutscher Auftragseingang im Juni deutlich höher als erwartet – DJN, 5.8.2021
Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich um Juni deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 4,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 26,2 (Mai: 54,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von nur 1,5 Prozent prognostiziert.
Ohne Großaufträge ergab sich ein Zuwachs von 1,7 Prozent. Den für Mai gemeldeten Rückgang bei den gesamten Auftragseingängen von 3,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 3,2 Prozent.
Die Inlandsbestellungen erhöhten sich im Juni auf Monatssicht um 9,6 (plus 1,1) Prozent, während die Auslandsaufträge um nur 0,4 (minus 6,0) Prozent stiegen, darunter die aus dem Euroraum um 1,3 (minus 0,4) Prozent. Die Bestellungen von Vorleistungsgütern nahmen um 1,4 (minus 3,4) Prozent zu und die von Investitionsgütern um 6,8 (minus 3,9) Prozent. Die Auftragseingänge für Konsumgüter sanken um 2,2 (plus 5,7) Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53601065-deutscher-auftragseingang-im-juni-deutlich-hoeher-als-erwartet-015.htm
Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juni um 1,4 Prozent – DJN, 5.8.2021
Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Der für Mai zunächst gemeldete Rückgang von 0,5 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz um 6,7 niedriger.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53601067-deutscher-industrieumsatz-sinkt-im-juni-um-1-4-prozent-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche Produktion sinkt im Juni um 1,3 Prozent – DJN, 6.8.2021
Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juni schwächer als ursprünglich prognostiziert entwickelt und ist – wie nach schwachen Industrieumsatzzahlen zu erwarten war – gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent zurück und lag um 5,1 (Mai: 16,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert.
Allerdings war wegen des am Donnerstag gemeldeten Rückgangs des Industrieumsatzes um 1,4 Prozent bereits ein Produktionsrückgang angenommen worden. Das ursprünglich für Mai gemeldete Produktionsminus von 0,3 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,8 Prozent. Für das zweite Quartal meldete Destatis einen Produktionsrückgang um 0,6 Prozent.
Die Industrieproduktion im engeren Sinne verringerte sich im Juni auf Monatssicht um 0,9 (minus 0,7) Prozent. Die Erzeugung von Vorleistungsgütern nahm um ebenfalls 0,9 (plus 0,7) Prozent und die von Investitionsgütern um 2,9 (minus 3,5) Prozent ab. Dagegen stieg die Produktion von Konsumgütern um 3,4 (plus 3,1) Prozent. Die Bauproduktion verringerte sich um 2,6 (minus 0,8) Prozent und die Energieproduktion um 0,6 (minus 2,9) Prozent.
Nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) waren im zweiten Quartal Versorgungsengpässe bei Halbleitern vor allem im Automobilbereich maßgeblich für den Produktionsrückgang verantwortlich. „Im Baugewerbe ging die Bremswirkung von einer Knappheit von Bauholz aus, die allerdings bald überwunden sein könnte“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ohnehin liege der Ausstoß im Baugewerbe weiter auf hohem Niveau.
Der Ausblick für die Industriekonjunktur insgesamt bleibt laut BMWi angesichts einer nach wie vor hohen Nachfrage „verhalten optimistisch“. Auch die Exportaussichten würden von den Unternehmen weiterhin positiv eingeschätzt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53613701-deutsche-produktion-sinkt-im-juni-um-1-3-prozent-015.htm
Produzierendes Gewerbe rutscht 1,3 Prozent ab – Produktion in Deutschland fällt im Juni saison- und kalenderbereinigt um 6,8 Prozent niedriger aus – Pressetext, 6.8.2021
Die preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe ist im Juni dieses Jahres saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent niedriger als im Mai ausgefallen. Aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes http://destatis.de nach lag die Produktion binnen Jahresfrist kalenderbereinigt 5,1 Prozent höher als im Juni 2020. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, lag die Produktion im Juni 2021 saison- und kalenderbereinigt 6,8 Prozent niedriger.
*** Mehr Konsumgüter hergestellt ***
Laut den Wiesbadener Statistikern ist die Industrieproduktion, also das Produzierende Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe, im Juni dieses Jahres gegenüber dem Vormonat Mai um 0,9 Prozent gesunken. Innerhalb der Industrie nahm die Produktion von Investitionsgütern um 2,9 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,9 Prozent ab.
Bei den Konsumgütern stieg die Produktion um 3,4 Prozent, wie aus den heute, Freitag, veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung 0,6 Prozent und die Bauproduktion 2,6 Prozent niedriger als im Vormonat. Für den Mai 2021 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse der Behörde ein Rückgang der Produktion von 0,8 Prozent gegenüber April 2021 (vorläufiger Wert: minus 0,3 Prozent).
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210806022
Pkw-Neuzulassungen sinken im Juli um ein Viertel – Weiter starke Nachfrage nach Eletromobilen und Hybridfahrzeugen – Einbruch der Nachfrage bei Benzin- und Diesel-PKW – DJN, 4.8.2021
Der deutsche Automarkt ist im Juli wieder geschrumpft. Nach dem starken Wachstum im Juni sank die Zahl der Neuzulassungen im vergangenen Monat um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 236.393 Pkw, wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mitteilte. In den ersten sieben Monaten ist die Bilanz mit einem Plus von 6,7 Prozent auf 1,63 Millionen Fahrzeuge dagegen positiv.
Unter den deutschen Marken wies allein die zum Stellantis-Konzern gehörende Marke Opel ein Wachstum auf, und zwar von 16 Prozent. Die übrigen deutschen Marken mussten Abstriche machen. So sanken die Neuzulassungen von Volkswagen um 16,6 Prozent. Bei BMW betrug das Minus 27,7 Prozent, bei Mercedes 37,6 Prozent.
Die alternativen Antriebe wiesen eine weiterhin positive Entwicklung auf. So legte die Zahl der Elektro-Pkw um 51,6 Prozent auf 25.464 zu. Auch bei Hybridfahrzeugen wurde ein Anstieg verzeichnet. Dagegen brachen die Neuzulassungen bei Benzin- und Diesel-Pkw ein.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53592584-pkw-neuzulassungen-sinken-im-juli-um-ein-viertel-015.htm
LADESÄULEN (DJN Pressespiegel, 4.8.2021) – Deutschlands Autoindustrie fordert einen rascheren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos. „Die Ladeinfrastruktur in Deutschland wird generell zu langsam ausgebaut und wird dem Hochlauf bei den Neuzulassungen von Elektroautos nicht gerecht. Das gilt in Städten und im ländlichen Raum gleichermaßen“, sagte die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR). „Wir brauchen überall mehr Tempo.“ Von dem Ziel von einer Million Ladepunkten bis 2030 sei Deutschland noch weit entfernt, kritisierte Müller. Um das zu erreichen, müssten 2.000 Ladesäulen pro Woche errichtet werden. Derzeit seien es weniger als 300. Öffentliche Ladepunkte fehlen vor allem auf dem Land. (Welt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53588228-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Hans Bentzien: Ifo: Lage der Autoindustrie im Juli verbessert – DJN, 3.8.2021
Die Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer sind im Juli besser gelaufen als im Vormonat. Der Ifo-Indikator zur Geschäftslage stieg auf plus 56,8 Punkte, nach plus 44,9 im Juni. Das ist der beste Wert seit Juli 2018. Die Erwartungen stiegen leicht auf plus 6,3 Punkte, nach plus 3,6 im Juni. „Die Nachfrage in Asien und den USA ist weiter sehr stark, das Vorkrisenniveau ist in Reichweite. In Europa sind wir hingegen ein ganzes Stück davon entfernt“, sagt Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.
83,4 Prozent der Unternehmen spürten im Juli einen Mangel an Vorprodukten, nach 64,7 im April. Das ist der höchste Wert seit dem Jahr 1991. „Die Automobilhersteller und ihre Zulieferer sind vom Mangel bei Vorproduktion betroffen. Dies führt zu Produktionsstillständen. Insbesondere die Engpässe bei den Halbleitern werden wohl noch eine Weile anhalten“, sagt Falck. Die Zulieferer füllten deshalb ihre Lager bewusst, sagt Falck. Die Bestände fertiger Pkw bei den Herstellern seien hingegen gering.
Erstmals seit Dezember 2018 wollen die Autobauer ihren Personalbestand ausweiten. Der Indikator stieg auf plus 5,2 Punkte, nach minus 19,3 im Juni. Die Nachfrage nach Autos hat im Juli leicht zugenommen: Der Indikator stieg auf plus 27,5 Punkte, nach plus 16,8 im Juni. Der Auftragsbestand ist im Vergleich zum Vormonat leicht gewachsen. Der Wert stieg auf plus 53,7 Punkte, von plus 42,1.
Die Kapazitätsauslastung bleibt auf Vorkrisenniveau. Im Juli gaben die befragten Unternehmen eine Auslastung von 84,7 Prozent an. Im April 2020 lag der historische Tiefpunkt bei 44,1 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53576979-ifo-lage-der-autoindustrie-verbessert-015.htm
Markit: Deutsche Dienstleister im Juli mit Rekordgeschäft – DJN, 4.8.2021
Die Geschäftsaktivität im deutschen Service-Sektor hat im Juli ein Rekordniveau erreicht. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf ein Allzeithoch von 61,8 (Juni: 57,5) Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten entsprechend dem Ergebnis der vorläufigen Umfrage 62,2 Punkte vorhergesagt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – stieg auf 62,4 (60,1) Punkte. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, liegt es darunter, eine Schrumpfung.
Nach Aussage von Volkswirt Andrew Harker sorgten die Lockerung der Corona-Restriktionen und die sukzessive Wiedereröffnung der Wirtschaft dafür, dass das Wachstum den höchsten Wert in der 24-jährigen Indexhistorie verzeichnete. „Der Zuwachs bei der Geschäftstätigkeit entpuppte sich auch als positive Nachricht für den Arbeitsmarkt, denn viele Firmen stellten mit neuer Rekordrate zusätzliche Mitarbeiter ein“, erläuterte Harker.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53590506-markit-deutsche-dienstleister-im-juli-mit-rekordgeschaeft-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de
Hans Bentzien: Deutscher Einzelhandel im Juni viel höher als erwartet – DJN, 2.8.2021
Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich um Juni weitaus besser als erwartet entwickelt. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die preisbereinigten Umsätze gegenüber dem Vormonat um 4,2 Prozent und lagen um 6,2 (Mai: minus 1,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen monatlichen Zuwachs von 1,8 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 war der Umsatz im Juni 2021 kalender- und saisonbereinigt real 9,1 Prozent höher.
„Diese Entwicklung dürfte mit der bundesweit weiter sinkenden Corona-Inzidenz und den damit verbundenen Lockerungen der Bundes-Notbremse zusammenhängen, die bis 30. Juni 2021 in Kraft war“, heißt es in der Destatis-Mitteilung.
Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig größeren Revisionen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53565629-deutscher-einzelhandel-im-juni-viel-hoeher-als-erwartet-015.htm
KfW-Mittelstandsbarometer sinkt im Juli trotz guter Geschäftslage – DJN, 2.8.2021
Das Geschäftsklima im deutschen Mittelstand hat sich im Juli trotz einer besseren Beurteilung der Geschäftslage etwas eingetrübt. „Grund für den Rückgang um 2,6 Zähler auf 9,5 Saldenpunkte sind vor allem Sorgen über die rasante Ausbreitung der Delta-Variante und die wieder deutlich steigenden Neuinfektionszahlen“, heißt es in einer Mitteilung der KfW.
Die Beurteilung der Geschäftslage stieg zum sechsten Mal in Folge, und zwar um 0,6 Punkte. „Die Lagebeurteilung liegt aber mit 11,2 Punkten mittlerweile klar über dem langfristigen Durchschnitt“, merkt die KfW an. Gleichzeitig korrigieren die Mittelständler ihre Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten deutlich um 5,6 Zähler nach unten. „Mit jetzt 7,6 Saldenpunkten überwiegt zwar weiterhin der Optimismus, die Euphorie des Vormonats ist aber verflogen.“
Überdurchschnittlich gut ist das Geschäftsklima in den Großunternehmen, gesunken ist es vor allem in den Dienstleistungsunternehmen. „Da zu diesem großen Segment viele Wirtschaftszweige zählen, die in der Vergangenheit besonders von Eindämmungsmaßnahmen betroffen waren, wie zum Beispiel das Gastgewerbe oder die Reisebranche, dürften hinter dem Stimmungsrückgang vor allem die Sorgen über die wieder rasant ansteigenden Neuinfektionszahlen in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern stehen“, erläutert die KfW.
Im verarbeitenden Gewerbe, dessen Geschäftsklima stieg, belasteten Materialknappheiten die Geschäftserwartungen. „Wichtiger für die Lagebeurteilung sind aber offenbar die prallgefüllten Auftragsbücher“, kommentierte Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib diese Entwicklung. Mit Blick auf den Dienstleistungssektor mahnte sie Wirtschaft und Gesellschaft: „Impfen, Impfen, Impfen.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53567918-kfw-mittelstandsbarometer-sinkt-im-juli-trotz-guter-geschaeftslage-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeiter im Juli deutlich gesunken – DJN, 5.8.2021
Die Zahl der Kurzarbeiter ist nach Schätzungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung im Juli deutlich gesunken, von korrigiert 1,39 Millionen auf 1,06 Millionen Menschen. Das sei die niedrigste Zahl seit Beginn der Corona-Krise im Februar 2020, teilte das Institut mit. Im Juli 2021 waren demnach noch 3,1 Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit, nach korrigiert 4,1 Prozent im Vormonat, schätzte das Institut auf der Grundlage seiner Konjunkturumfrage und von Daten der Bundesagentur für Arbeit.
„Vor allem in den Branchen mit Corona-Lockerungen ging die Kurzarbeit erneut kräftig zurück“, sagte Ifo-Umfrageexperte Stefan Sauer. „In der Industrie jedoch sehen wir erste Auswirkungen der Engpässe bei Vorprodukten und Rohmaterialien auf den Umfang der Kurzarbeit.“
In der Autobranche stieg die Zahl der Kurzarbeiter demnach von 14.500 auf 32.100 – und damit 3,4 Prozent nach 1,5 Prozent. Sehr hoch liege der Anteil weiter bei den Druckereien mit 13,8 nach 14,1 Prozent. Insgesamt stieg der Anteil in der Industrie von 3,1 auf 3,6 Prozent. Das sind 249.000 nach 214.000 Beschäftigten.
Im Gastgewerbe sank die Zahl der Menschen in Kurzarbeit aber merklich von korrigiert 295.000 auf 183.000. Das entspricht noch 17,2 Prozent der Beschäftigten nach revidiert 27,8 Prozent im Juni. Im Einzelhandel verringerte sich die Zahl von 92.600 auf 41.700 oder 1,7 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53601111-ifo-institut-zahl-der-kurzarbeiter-im-juli-deutlich-gesunken-015.htm
Zwei Drittel der Deutschen für Vermögensteuer – Deutschland ist OECD-Spitzenreiter bei der Konzentration von Reichtum. Seit rund zwei Jahrzehnten profitiert das reichste eine Prozent von starken Steuerentlastungen. Umfragen zeigen, dass sich eine klare Mehrheit der Bevölkerung für höhere Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen ausspricht – RT-DE (TV-Novosti, Moskau), 6.8.2021
Seit Jahren driften weltweit die Vermögen jener, die es erarbeiten, und derer, die bereits viel haben, diametral auseinander. So ist laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Anteil der Arbeiter am globalen Einkommen in den letzten zwei Jahrzehnten „erheblich“ gesunken, wie ein im Jahr 2019 erschienener Bericht aufzeigte. Die in 189 Ländern erhobenen Daten zeigten zudem, dass ein Anstieg der Spitzenarbeitseinkommen mit Verlusten für alle anderen verbunden ist.
Dass die soziale Spaltung in Deutschland „immer krasser“ wird, zeigte sich schon vor Jahren, so beispielsweise im Jahr 2015, in dem das reichste Tausendstel ein Bruttoeinkommen von über 140.000 Euro im Monat erzielte, überwiegend, mit gut 117.000 Euro, durch Gewinne und Kapitaleinkommen. Doch die eklatanten Unterschiede spiegeln sich bisher nicht in einer ebenso unterschiedlichen Besteuerung wieder.
Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist bereits seit längerem offen für Maßnahmen gegen die Tendenz der stetig wachsenden Ungleichheit und befürwortet entsprechend angepasste Steuern. Schon 2019 waren 72 Prozent der Bundesbürger für eine von der SPD geforderte Abgabe auf Vermögen ab zwei Millionen Euro, nur 25 Prozent waren dagegen.
Mit der Corona-Krise kommen noch einmal immense Kosten auf Deutschland zu, auch durch die großzügigen Rettungspakete, welche Unternehmen erhielten, während die Hauptleidtragenden der Corona-Krise die Geringverdiener sind, die auch bereits an der Tendenz zum konzentrierteren Reichtum verloren haben, wie Ökonomen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in ihrem Bericht darlegten. Demnach gab es auch in Deutschland seit etwa 2004 erhebliche Ertragseinbußen in der mittleren und unteren Mittelklasse und hohe Gewinne an der Spitze.
Und bei der Konzentration von Reichtum ist Deutschland selbst innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit 38 einkommensstarken Mitgliedsländern aktuell der Spitzenreiter. OECD-Ökonomin Sarah Perret betonte Anfang Juli bei der Vorstellung einer Studie, die dies belegt, dass das reichste Zehntel der Bevölkerung rund 60 Prozent des gesamten Vermögens hält, während das reichste ein Prozent noch über 20 Prozent des gesamtgesellschaftlichen Reichtums auf sich vereint, welches dann minimal besteuert an Erben weitergegeben wird.
Das vermeintliche „Schreckgespenst“ Vermögensteuer ist keineswegs mehr ein abwegiges Nischenthema. Die sozio-ökonomische Spaltung hat immerhin Folgen für die gesamte Bevölkerung, während große Teile der Mittelschicht – nicht unbegründet – Angst vor einem sozialen Abstieg und Altersarmut haben.
Aktuell sind rund zwei Drittel der Bundesbürger für höhere Steuern auf hohe Einkommen, wie eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des ARD-Politikmagazins Kontraste zeigt. Demnach fänden es 67 Prozent der Befragten richtig, wenn Personen mit höherem Einkommen mehr Steuern zahlen würden. Nur fünf Prozent der Befragten würden eine Steuersenkung für höhere Einkommen bevorzugen, 24 Prozent wollen, dass die Steuerbelastung für diese Gruppe gleich bleibt.
Zu der Frage nach der Steuerbelastung mittlerer Einkommen antwortete knapp ein Drittel (29 Prozent), dass diese entlastet werden sollten, 65 Prozent der Befragten gaben an, dass für diese Gruppe die Steuern so bleiben sollten, wie sie sind, und drei Prozent meinen, sie sollten höher besteuert werden.
Ebenfalls 67 Prozent der Befragten waren auch dafür, Menschen mit niedrigen Einkommen zu entlasten. 30 Prozent meinen, die Steuerbelastung sollte gleich bleiben und nur ein Prozent wäre für eine Erhöhung. Etwa ein Drittel der Befragten findet, dass der Staat nach einer Steuerreform mehr Geld zur Verfügung haben sollte.
Die bisher oft angeführten Argumente gegen eine Besteuerung von Vermögen seien nicht ehrlich, wie der Wirtschaftsexperte und Professor für Staatsfinanzen, Achim Truger, jüngst in einem Beitrag im Handelsblatt ausführte.
Auch Superreiche selbst verlangen zunehmend eine fairere Besteuerung. Erst in dieser Woche bekräftigten die „Millionaires for Humanity“ diese Forderung, ein Netzwerk von Multimillionären aus verschiedenen Ländern, welche eine systemische Veränderung durch gerechtere Besteuerung herbeiführen wollen, um so internationale Herausforderungen wie die wirtschaftliche Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie zu meistern. Zuvor hatten Journalisten von Pro Publica anhand von Steuerdokumenten enthüllt, dass ausgerechnet die Mega-Reichen in den USA verschwindend geringe Abgaben an den Staat leisten und mehrere Jahre auch mal gar keine Einkommenssteuern zahlten – darunter Namen wie Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg, Carl Icahn und George Soros.
Truger betont, dass insbesondere das reichste eine Prozent, das in der Einkommens- und Vermögensverteilung seit zwei Jahrzehnten „besonders starke Einkommensgewinne verzeichnet“ und dazu noch „erheblich von Steuersenkungen profitiert“, gezielt besteuert werden müsse, um die Ungleichverteilung wieder zu korrigieren. Die „Lobby der sogenannten Familienunternehmen – und ihre Fürsprecher“ würden sich mit dem Einfluss, welcher ihr ökonomisches und politisches Kapital biete, zwar dagegen wehren. Doch während ein Teil der Argumentation gegen eine Besteuerung der Allerreichsten reine Diffamierung sei und eine weitere Reihe von Punkten berechtigt wäre, wenn diese nicht bereits in den meisten Vermögensteuerkonzepten gelindert würden, seien oftmals präsentierte Scheinalternativen zu der Vermögenssteuer unehrlich, da damit sowohl das Ziel der Besteuerung eben der Allerreichsten, wie auch die Möglichkeit, auf einfache Weise die Erträge für den Fiskus signifikant zu erhöhen , verfehlt würden.
Die massive Ungleichverteilung von Vermögen hierzulande kritisiert auch der Unternehmer Ralph Suikat, der selbst davon profitiert, nachdem er durch den Verkauf seiner Firmenanteile am Softwareunternehmen STP Informationstechnologie zum Millionär wurde. Diese Entwicklung sei auch auf die historisch gesehen vergleichsweise geringe aktuelle Besteuerung von Vermögen zurückzuführen:
„Als ich zusammen mit meinem Geschäftspartner 1993 unser Unternehmen gegründet hatte, lag der Spitzensteuersatz bei 53 Prozent. Das war völlig okay und hat auch damals niemanden vom Gründen eines Unternehmens abgehalten.“
Suikat prangert im Interview mit dem Handelsblatt an:
„Menschen, die sich mit ihrer Hände Arbeit abrackern, zahlen dadurch prozentual deutlich höhere Steuern als Vermögende, die lediglich ihr Geld arbeiten lassen. Das ist doch nicht gerecht.“
Deswegen hat er den Appell „taxmenow“ (etwa: „Besteuere mich jetzt“) ins Leben gerufen, der sich 40 Millionäre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angeschlossen haben, um zusammen eine höhere Besteuerung für sehr Reiche zu fordern.
Derzeit greift hierzulande der Spitzensteuersatz von 42 Prozent des zu versteuernden Einkommens bei knapp 58.000 Euro für Ledige. Der Höchstsatz, die sogenannte „Reichensteuer“, von 45 Prozent setzt erst bei einem zu versteuernden Einkommen von knapp 275.000 Euro ein.
Am stärksten profitieren würden die Spitzenverdiener durch die Steuerpläne der AfD, wie eine Analyse aller Parteiprogramme durch das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) befand. Während eine Alleinverdiener-Familie mit zwei Kindern bei einem Haushaltseinkommen von 40.000 Euro mit der AfD höchstens 21 Euro an Steuerersparnissen zu erwarten hätte, könnten Einkommen ab 300.000 Euro gut 42.000 Euro weniger Steuern zahlen.
QUELLE (mit vielen weiterführenden Intrattext-Links): https://de.rt.com/inland/121928-uberfallig-mehrheit-deutschen-fur-vermogensteuer/
SIEHE DAZU:
Martin Greive: Nachgefragt – 30. Juli 2021: Steuern eines Millionärs: „Oh, das ist schon wenig“ – Der Millionär Ralph Suikat fordert höhere Steuern für Reiche. Geld geselle sich wie bei ihm zu Geld – während einfache Arbeiter höher besteuert würden als er – Der Chefökonom / HANDELSBLATT, 30.7.2021,
nachzulesen unter: https://www.news-and-comment.at/2021/08/02/nc-montagsblick-kw-30-31/
ÖSTERREICH
– STATISTIK
Außenhandel im Mai 2021: mehr als 30% mehr Importe und Exporte im Vergleich zum schwachen Vorjahresmonat; Einfuhren +34,1%, Ausfuhren +31,5%
Großhandelspreise legten im Juli 2021 um 12,1% zu
Einzelhandel mit Umsatzplus von 6,4% im 1. Halbjahr 2021; Absatzvolumen bei Nicht-Nahrungsmitteln fast auf Vorkrisenniveau
– MELDUNGEN
Österreich: Nächtigungen im Juli auf Vorjahresniveau, aber noch unter Rekordwert aus dem Jahr 2019 – Vorjahreswerte übertroffen: Deutsche, ungarische und polnische Gäste sorgen im Juli für hohe Zahlungskartenumsätze – Vorjahreswerte der Zahlungskartenumsätze im Juli mit Plus von 50 Prozent bei inländischen Gästen – Kein sicherer Schluss auf Nächtigungen möglich: Inländer verwenden heuer häufiger Zahlungskarten als bares Geld, daher Nächtigungen geschätzt auf Vorjahresniveau – Insgesamt geschätzt 17 Prozent Rückstand im Vergleich zum Nächtigungsrekordjahr 2019, im Vergleich zu 2020 geschätzt gleichgeblieben – 2021 im Vergleich zu 2019: Plus 17 Prozent mehr inländische Gäste, minus 29 Prozent weniger ausländische Gäste – OeNB, 6.8.2021
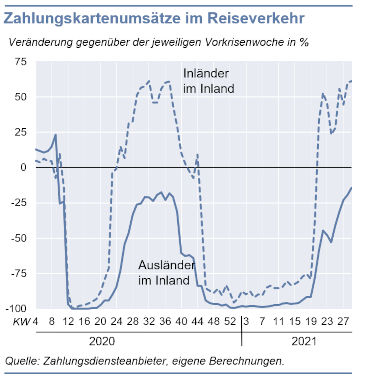
GRAPHIK: https://www.oenb.at/.imaging/mte/oenb/articleTextImageMedium/dam/oenb/Presse/Presseaussendungen_HTML/Bilder/2021/20210806_pa-tourismus-grafik.png/jcr:content/20210806_pa-tourismus-grafik.png
Die OeNB analysiert die Entwicklung im heimischen Tourismus zeitnah mit Hilfe von Zahlungskartenumsätzen. Nach der Öffnung der Hotellerie Ende Mai wurde bereits im Juni eine deutliche Zunahme der Umsätze verzeichnet. Im Juli hat sich dieser Trend weiter verstärkt. Die auf Basis der Umsätze geschätzten Nächtigungen lagen im Juli auf Vorjahresniveau; im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 beträgt der Rückgang aber noch 17 %. Im Vorkrisenvergleich ist weiterhin eine deutliche Verschiebung der Gästestruktur zu beobachten. Während die Nächtigungen inländischer Gäste 17 % über dem Wert im Juli 2019 lagen, sind die Übernachtungen ausländischer Gäste um 29 % niedriger.
Die kürzlich verzeichneten Anstiege der Infektionszahlen in vielen Staaten Europas und den USA zeigen, dass die Pandemie noch nicht beendet ist. Gerade der Tourismus ist ein Wirtschaftsbereich, der die negativen Auswirkungen unmittelbar zu spüren bekommt, sei es über Reisewarnungen, erneute Angebotseinschränkungen oder auch nur durch größere Vorsicht von Reisenden.
Die aktuellen Zahlungskartenumsätze zeigen, dass im Juli das Interesse ausländischer Gäste an Urlauben in Österreich sehr hoch war: Die Ausgaben deutscher, ungarischer und polnischer Touristen überstiegen die Vorjahreswerte deutlich. Ein Ausgabenrückgang im Vergleich zu 2020 wurde hingegen bei Touristen aus der Schweiz verzeichnet. In Summe stiegen die Zahlungskartenumsätze ausländischer Gäste im Juli um 15 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vorkrisenvergleich blieben die Zahlungskartenumsätze ausländischer Touristen im Juli zwar noch über 20 % unter dem Niveau des Rekordjahres 2019, die Rückgänge wurden zuletzt aber von Woche zu Woche geringer.
Deutliche Zuwächse wurden hingegen bei Zahlungskartenumsätzen inländischer Gäste verzeichnet. Obwohl auch Österreicherinnen und Österreicher wieder häufiger im Ausland Urlaub machen, lagen ihre Ausgaben mit Zahlungskarten im Juli um mehr als 50 % über dem Vorkrisenniveau (Juli 2019).
Aufgrund von Corona-bedingten Verschiebungen zwischen baren und unbaren Zahlungsmitteln lassen sich Zahlungskartenumsätze nicht unmittelbar auf Nächtigungszahlen übertragen. Insbesondere inländische Gäste verwenden Zahlungskarten deutlich häufiger als vor Ausbruch der COVID-19-Krise. Vor diesem Hintergrund schätzt die OeNB, dass die Gesamtzahl der Nächtigungen im Juli auf dem Niveau von Juli 2020 lag; dies korrespondiert mit einem Rückgang um 17 % im Vergleich zum Jahr 2019. Im Vorkrisenvergleich ist es weiters zu einer deutlichen Verschiebung in der Gästestruktur gekommen. Einem Plus von 17 % bei den inländischen Gästen steht ein Minus von 29 % bei den ausländischen Gästen gegenüber. Im Vergleich zum Juli 2020 blieb die Zahl der Nächtigungen in- und ausländischer Gäste weitgehend unverändert.
QUELLE (inkl. Tabelle): https://www.oenb.at/Presse/20210806.html
PVA-Generaldirektor gegen sozial gestaffelte Pensionsanpassung – Pensionistenvertreter nicht einig: Pensionistenverbandspräsident (SPÖ) dafür, Seniorenbundpräsidentin (ÖVP) dagegen – Kein eigener Pensionistenwarenkorb – Massiver“ Einbruch bei Beiträgen: steigende Bundeszuschüsse in Milliardenhöhe vorprogrammiert – Teilpension bei Berufswechsel? – ORF, 8.8.2021
Der Generaldirektor der Pensionsversicherungsanstalt, Winfried Pinggera, hat sich gegen die von der Politik in den letzten Jahren praktizierte soziale Staffelung bei der jährlichen Pensionserhöhung ausgesprochen. Er begründete seine Ablehnung gegenüber der APA damit, dass damit das Versicherungsprinzip ausgehebelt und letztendlich auch das Vertrauen in die Pensionen insgesamt untergraben werde.
Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat bereits angekündigt, dass eine solche soziale Staffelung wieder „Teil der Überlegungen“ sei. Als einmalige Sache kann sich Pinggera das vorstellen, aber nicht auf Dauer über mehrere Jahre hinweg. Dem Argument, dass man eine soziale Dimension berücksichtigen wolle, stimmt Pinggera schon zu. Das soll aber eher über die Ausgleichszulage erfolgen.
*** Pensionistenvertreter nicht einig: Pensionistenverbandspräsident (SPÖ) dafür, Seniorenbundpräsidentin (ÖVP) dagegen ***
Die Bekämpfung und Vermeidung von Altersarmut sei nach wie vor ein wichtiges Ziel mit hoher Priorität, sagte Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka (SPÖ), der keinen Widerspruch zum Versicherungsprinzip sieht. Es gelte, „Pensionen zu gewährleisten, von denen man leben kann“.
Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (ÖVP) sieht sehr wohl einen Widerspruch: „Wer mehr einbezahlt hat, muss auch mehr rausbekommen“, stellte sie fest – und trat dafür ein, dass die Pensionsanpassungen für 2022 für alle gleich hoch ausfallen. Die dafür durchaus nötigen Maßnahmen müssten etwa über die Ausgleichszulage erfolgen, meinte Korosec.
*** Kein eigener Pensionistenwarenkorb ***
Eine Absage erteilt der PVA-Generaldirektor im APA-Interview auch dem alten Wunsch von Seniorenvertretern nach einem eigenen Pensionistenwarenkorb für die Anpassung – die Gruppe der Pensionisten sei nicht homogen, und man müsse dann auch für andere Personengruppen wie etwa für Studenten einen eigenen Warenkorb erfinden.
*** „Massiver“ Einbruch bei Beiträgen: steigende Bundeszuschüsse in Milliardenhöhe vorprogrammiert ***
Die CoV-Krise hat auch die Pensionsversicherung schwer getroffen und im Vorjahr zu einem „massiven Einbruch“ der Beitragseinnahmen geführt. Deshalb ist der Bundeszuschuss zu den Pensionen von 3,7 Milliarden im Jahr 2019 auf 4,87 Mrd. Euro 2020 angestiegen, Tendenz weiter nach oben.
Für heuer sieht die Vorausschau 5,8 Mrd. vor, für nächstes Jahr 6,6 Mrd. und bis 2025 könnte der Bundesbeitrag sogar auf 8,8 Mrd. Euro steigen. Pinggera rechnet aber damit, dass die Zahlen im Endeffekt besser ausfallen. Er verwies darauf, dass derzeit eine Steigerung der Beitragseinnahmen von 16 Prozent verzeichnet werde.
*** Teilpension bei Berufswechsel? ***
Die Frage nach der Notwendigkeit einer Pensionsreform – etwa die Forderung einer automatischen Erhöhung des Antrittsalters mit steigender Lebenserwartung – wollte er nicht direkt beantworten. Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) sehe bei Ansteigen der Lebenserwartung eine Automatik schon vor, als „Handlungspflicht“ für die Politik. Das sei aber eine „offene Möglichkeit“, die bisher nicht genutzt wurde.
Sowohl das Auslaufen der „Hacklerreglung“ mit der abschlagsfreien Frühpension mit 45 Versicherungsjahren als auch das schrittweise Anheben des Frauenpensionsalters von 60 auf 65 von 2024 bis 2033 begrüßt der PVA-Generaldirektor. Beide Maßnahmen würden dazu beitragen, die im Vergleich zu den Männer um mehr als 40 Prozent niedrigeren Frauenpensionen anzuheben.
In diesem Zusammenhang plädiert Pinggera auch dafür, die Einführung einer Teilpension zu überlegen. Seiner Ansicht nach ist der bestehende Berufsschutz „nicht mehr zeitgemäß“. Als Beispiel nennt er einen Installateur, der in einem gewissen Alter diesen Job nicht mehr ausführen kann, aber jetzt als Installationsfachverkäufer in einem Baumarkt arbeiten könne. Der dadurch geringere Verdienst könnte durch eine Teilpension ausgeglichen werden.
QUELLE: https://orf.at/stories/3224097/
Immer mehr illegale Müllsammler unterwegs – Niederösterreich-ORF, 8.8.2021
In einzelnen Bezirken werde die Bevölkerung mithilfe von Flugzetteln oder „Kaufverträgen“ aufgefordert, alte Gegenstände zur Abholung bereitzustellen. Damit mache man sich strafbar, warnten die NÖ Umweltverbände am Sonntag in einer Aussendung. Können Materialien nicht recycelt werden, führe dies zudem zu „massiven Wertstoffverlusten“, so LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP).
Illegale Müllsammler verteilten in den vergangenen Wochen im Bezirk Gänserndorf Flugzettel mit einem beiliegenden „Kaufvertrag“. Mit einer Unterschrift stimme man zu, dass der Gegenstand um einen „Kaufpreis“ von null Euro den „Kleinmaschinenbrigaden“ überlassen wird.
*** Organisierte Müll-Kriminalität ***
Durch die illegale Müllsammlung werden den österreichischen Kommunen und Entsorgungsbetrieben rund 160.000 Tonnen an Wertstoffen – vor allem Altmetall – entwendet, hieß es. „Das führt zu einem Schaden von über zehn Millionen Euro“, rechneten Pernkopf und VP-LAbg. Anton Kasser, Präsident des Vereins „die NÖ Umweltverbände“, vor: „Hinter den illegalen Sammlern stehen große Organisationen, die gesammelte Waren um gutes Geld weiterverkaufen und die übrig gebliebenen Geräte und Waren dann auf billigste, und meist umweltschädliche Art und Weise, entsorgen.“ Man arbeite eng mit der Landespolizeidirektion zusammen, um dieser Illegalität Einhalt zu gebieten.
Bei illegalen Sammlern besonders beliebt sind der Aussendung zufolge Kühlschränke, Waschmaschinen, Computer und Bohrmaschinen. „In Elektroaltgeräten sind zahlreiche Stoffe und Materialien enthalten, die bei einer richtigen Entsorgung recycelt und damit wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgebracht werden können“, betonte Kasser. Deshalb sei es besonders wichtig, diese Produkte ordnungsgemäß in den 430 Sammelzentren in Niederösterreich zu entsorgen.
Strafen treffen nicht nur die „Kleinmaschinenbrigaden“ selbst, sondern auch jene, die Müll im Zuge dieser Sammlungen abgeben. Bei nicht gefährlichen Abfällen drohen Bußgelder bis zu 7.270 Euro, bei gefährlichen bis zu 36.340 Euro. Müllexport ohne entsprechende Genehmigung entspricht darüber hinaus einem Tatbestand nach dem österreichischen Strafgesetzbuch.
QUELLE: https://noe.orf.at/stories/3116060/
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER
Bert Rürup: Wunderliche Töne aus der Autoindustrie – Autoindustrie spürt Chipmangel, aber Stimmung der Autobauer steigt – Der Chefökonom / HANDELSBLATT, 6.8.2021
GRAPHIK:
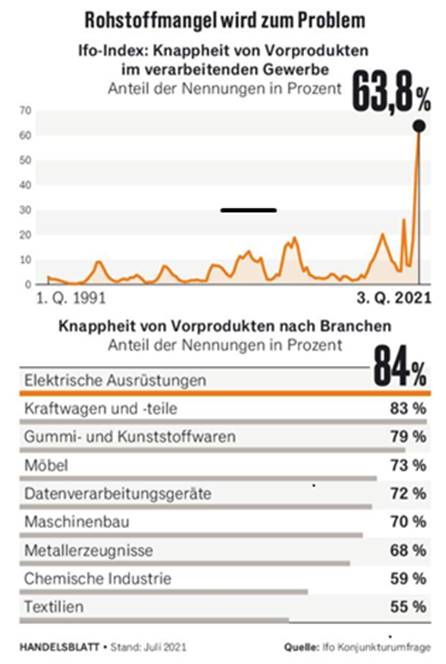
Nach allem, was man bisher weiß, lief das zweite Quartal für die deutsche Industrie allenfalls durchwachsen. Zwar legte das Bruttoinlandsprodukt insgesamt um 1,5 Prozent zu. Doch zu diesem Wachstum trug nach ersten Angaben wohl nur der private und staatliche Konsum bei, aber nicht der Außenhandel oder die Investitionen.
Verwunderlich ist, dass die deutsche Autoindustrie dennoch hohe Gewinne und üppige Margen verkündet – und im selben Atemzug über Chipmangel klagt. So sagte BMW-Chef Oliver Zipse: „Die weltweite Unterversorgung unserer Branche mit Mikrochips ist allgegenwärtig“.
*** Autoindustrie spürt Chipmangel ***
Seit kurzem seien die eigenen Werke betroffen, das zweite Halbjahr werde „etwas herausfordernder“ sein als das erste. Stellantis, der Mutterkonzern von Opel, Peugeot und Fiat Chrysler und weltweit der viertgrößte Automobilproduzent, gibt an, wegen fehlender Chips könnten 2021 voraussichtlich 1,4 Millionen Autos nicht gebaut werden.
Laut einer repräsentativen Ifo-Umfrage spürten im Juli 83,4 Prozent der Unternehmen der deutschen Automobilbranche einen Mangel an Vorprodukten, nach 64,7 Prozent im April.
*** Stimmung der Autobauer steigt ***
Merkwürdigerweise verbesserte sich die Stimmung in der Autoindustrie dennoch deutlich. Der Ifo-Indikator zur Geschäftslage stieg auf 56,8 Punkte, nach 44,9 im Juni. Das war der höchste Wert seit Juli 2018. Ebenso legten die Erwartungen zu, wenn auch nur leicht von 3,6 auf 6,3 Punkte.
Und erstmals seit Dezember 2018 wollen die Autobauer ihren Personalbestand erhöhen. Der Indikator stieg auf plus 5,2 Punkte, nach minus 19,3 im Juni. Totgesagte leben offenbar länger.
QUELLE: nicht verlinkbar.
Philosoph Precht gibt eine hörenswerte Zeitanalyse: Es geht um das Problem, dass der liberale Staat seine eigenen Existenzbedingungen nicht einfordern kann, so der von Precht zitierte Verfassungsrichter Böckenförde – ein bekanntes Wort. Zu diesen Bedingungen zählt u.a. Verantwortungsgefühl seiner Staatsbürger füreinander im Staatswesen; dies ist verlorengegangen, die Staatsbürger*innen benehmen sich wie Kunden in einem Laden: wir haben alle Rechte als Kunden, aber keine Pflichten. Die Sicht, das mit Rechten auch Pflichten übernommen werden, zählt nicht mehr. – TikTok, 2021
Quelle: Kurzvideo auf TikTok
SIEHE DAZU:
=> Richard David Precht (Wikipedia) und dort die Abschnitte zu seinem Buch „Die Kunst, kein Egoist zu sein“ (2010), zur neuen Bürgergesellschaft und ihrer soziale Verantwortung (Kommunitarismus), zu Digitalisierung und zur Europäische Union.
“ 2010 erschien Die Kunst, kein Egoist zu sein. Precht geht in dem Buch der Frage nach, „wie Menschen tatsächlich moralisch funktionieren.“ Dazu müsse sich der Philosoph heutzutage auch „in die Skizzen der Hirnforscher, Evolutionsbiologen, Verhaltensökonomen und Sozialpsychologen vertiefen.“ Die Bereitschaft zu persönlicher Verantwortungsübernahme sieht Precht in der modernen Gesellschaft durch die Pluralität der Rollen, in denen das Individuum agiert, geschwächt. „Bereits mein Wikipedia-Eintrag zergliedert mich in lauter verschiedene Kategorien […] Die Zugehörigkeit zu mehreren Rollen erleichtert es mir beträchtlich, für das Große und Ganze dieser Welt nicht verantwortlich zu sein. Verantwortlich – das sind immer die anderen. Die Politiker zum Beispiel oder die Wirtschaftsbosse. Bedauerlicherweise zerfallen auch sie in lauter kleine Rollen.“ Im dritten Teil der Untersuchung („Moral und Gesellschaft“) möchte Precht zu Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik anregen, mit denen sich „unser Engagement für andere fördern lässt – in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft auf dem Spiel steht wie seit Jahrzehnten nicht mehr.“ Um die langfristigen Probleme lösen zu können, bedürfe es eines Umbaus hin zu mehr Mitbestimmung und mehr direkter Demokratie. Gebraucht werde „mehr Verantwortung von oben und von unten.“ „
QUELLE: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_David_Precht
=> Richard David Precht: Von der Pflicht: Eine Betrachtung. München: Goldmann Verlag, 2021 – Ein dringend notwendiger Weckruf von Deutschlands bekanntestem Philosophen – Amazon, 29.3.2021
In den Jahren 2020 und 2021, der Zeit der Covid-19-Pandemie, ereignete sich ein bemerkenswertes Schauspiel. Während der weitaus größte Teil der Menschen Empathie mit den Schwachen und besonders Gefährdeten zeigte, entpflichtete sich eine Minderheit davon und rebellierte gegen die staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller Bürger.
Für Richard David Precht ein Anlass, darüber nachzudenken, was eigentlich die Pflicht des Fürsorge- und Vorsorgestaates gegenüber seinen Bürgern ist und was die Pflicht seiner Bürger. Was schulden wir dem Staat und was sind die Rechte der Anderen auf uns? Die Frage führt ein Dilemma vor Augen: Auf der einen Seite sind wir darauf konditioniert, egoistische Konsumenten zu sein. Und auf der anderen Seite braucht der Staat zu seinem Funktionieren genau das Gegenteil, nämlich solidarische Staatsbürger. Könnte es da nicht hilfreich sein, das Pflichtgefühl der Bürger in der liberalen Demokratie durch zwei Pflichtjahre zu stärken? Eines nach dem Schulabschluss und eines beim Eintritt in die Rente, um allen Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich selbst in der Pflicht gegenüber dem Staat und auch gegenüber anderen zu erfahren?
QUELLE: https://www.amazon.de/Von-Pflicht-Richard-David-Precht/dp/3442316391
BUCHBESRPECHUNGEN AUS FREMDER FEDER
Andrea Roedig: Rezension zu Philipp Sarasin: „1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ – Das Ende der Moderne, Berlin: Suhrkamp, 20.6.2021, 508 Seiten, 32 Euro – Sarasin legt einen „Schnitt durch den Strom der Zeit“, um die Veränderungen, die das Jahr 1977 brachte, aufzuzeigen – Gemeinsamkeit dieser Veränderungen ist der Anfang einer Bewegung, die vom modernen Ideal der Allgemeinheit und Universalität in eine zunehmende Pluralisierung und einen Primat der Singularitäten führt – Deutschlandfunk Kultur, 21.6.2021
Die 1970er-Jahre gelten als Dekade der Umbrüche und Krisen und als eine, in der vieles von dem begann, was uns heute umtreibt. Der Historiker Philip Sarasin nimmt ein Jahr als Schnittpunkt um herauszufinden, wann und warum die Moderne zu Ende ging.
Diese Aufzählung klingt tatsächlich nach heute: Bioenergie, Massage, Gesundheitsnahrung, Tai Chi, Mediation, Jogging und Yoga, Human Potential Bewegung – man spricht von „Me Decade“, ein Soziologe diagnostiziert die „narzisstische Gesellschaft“. Doch all das gehört in die 1970er Jahre, eine Dekade in der fast alles begann, was uns heute noch umtreibt: Globalisierung und Medienwandel, Individualisierung und Identitätspolitik. Die These vom Jahrzehnt der Umbrüche ist nicht neu, in die 1970er Jahre fallen Ölkrise und RAF-Terrorismus, die iranische Revolution und die beginnende Ökobewegung – oft schon wurde diese Zeit als eine Art Epochenschwelle beschrieben. Der Historiker Philipp Sarasin nimmt sich nun ein einziges Jahr vor, 1977, um einen „Schnitt durch den Strom der Zeit“ zu legen, und herauszufinden, worin genau die Veränderung bestand, die damals eintrat.
*** Was zu Ende geht – und was beginnt ***
Er tut dies anhand von fünf „Nekrologen“, also Nachrufen auf berühmte Persönlichkeiten, die im Jahr 1977 starben, und an denen sich exemplarisch zeigen lässt, was mit ihnen zu Ende ging; unter anderem sind das Ernst Bloch als Philosoph der Revolution, Anais Nin als Ikone der sexuellen Selbsterfahrung und Ludwig Erhard als Sinnbild sozialer Marktwirtschaft. Insgesamt zeigen die verschiedenen Nachrufe aber eine einzige Bewegung auf, die vom modernen Ideal der Allgemeinheit und Universalität in eine zunehmende Pluralisierung und einen Primat der Singularitäten führt.
Detailliert beschreibt Sarasin etwa, wie die Hoffnung auf gesellschaftliche Revolution am „deutschen Herbst“ und der Auseinandersetzung um die RAF zerbricht, die linke Szene zerfällt in immer mehr einzelne Bewegungen und viele ihrer Mitglieder wenden sich Zielen der Selbstfindung zu, woraus ein ganzer Psychoboom entsteht. Ausgehend vom Nekrolog auf die schwarze Bürgerrechtlerin Fannie Lou Hamer zeigt Sarasin, wie sich der Kampf für Menschenrechte langsam und zunächst feministisch motiviert zu „Identity Politics“ wandelt. Dieser Punkt ist für heutige Debatten wohl der interessanteste. Es entwickele sich in den 70er Jahren eine typische Doppelfigur „unschuldiges Opfer – postideologischer Helfer“, meint Sarasin und ein wahrer „Sehnsuchtssignifikant Identität.“
*** Medienwandel und Globalisierung ***
All diese politischen Entwicklungen waren begleitet von beginnender Globalisierung und Medienwandel. Denn ab 1977 setzten sich auch die ersten PCs, also Personal Computer durch. Damals, das zeigt das Buch von Philip Sarasin, war alles Zukünftige schon da, aber man konnte es noch nicht als solches erkennen.
1977 ging die Moderne zu Ende – die These ist plausibel entwickelt, wenn auch der Bezug auf die fünf Nekrologe etwas konstruiert erscheint und der Autor sie mit zu vielen Beispielen überfrachtet, was der Untersuchung mitunter den Charme eines gut erzählten Telefonbuchs verleiht. Es bedarf der Fülle, um einen „Schnitt durch den Strom der Zeit“ zu legen, ganz so viel Material allerdings, von zudem oft schon bekannten Geschichten, hätte die Leserin nicht gebraucht.
QUELLE: https://www.deutschlandfunkkultur.de/philipp-sarasin-1977-eine-kurze-geschichte-der-gegenwart.950.de.html?dram:article_id=499018
SIEHE DAZU:
=> Übersicht über Rezensionen zu Philipp Sarasins Buch „1977“ – Perlentaucher
QUELLE: https://www.perlentaucher.de/buch/philipp-sarasin/1977.html
Thomas Badtke: Neuer Thriller von Harlander: Ein „Systemfehler“ legt Europa lahm – Es braucht nicht viel, um Europa lahm zu legen – nur einen gezielten Cyberangriff mit einem Computervirus – n-tv, 1.8.2021
Es braucht nicht viel, um Europa lahm zu legen – nur einen gezielten Cyberangriff mit einem Computervirus.
Nach einem Cyberangriff geht es schnell: Ampeln fallen aus, Bahnen fahren nicht, Flugzeuge stürzen ab, Gesundheitssystem, Mobilfunknetz und Internet brechen zusammen. Nichts geht mehr, in Europa herrschen Chaos und Tod. Wer steckt dahinter, wer profitiert? Wolf Harlander weiß es.
Im vergangenen Jahr erlebt Deutschland erneut einen Dürresommer, es ist der dritte in Folge. Wolf Harlander liefert mit seinem Debütthriller „42 Grad“ dazu die perfekte Begleitmusik: Wassermangel europaweit, ein terroristischer Anschlag. Harlanders Buch rüttelt auf und wach. Menschliche Urängste werden geschürt und der jetzige Bestsellerautor spielt mit ihnen virtuos. Dieses Kunststück ist Harlander auch bei seinem zweiten Werk gelungen.
Mit „Systemfehler“ entführt der Autor die Leser erneut in ein Szenario, das sich durchaus eher heute als morgen direkt so abspielen könnte und das vor allem wegen dieser Aktualität hochbrisant ist: Ein Virus geht durch Europa. Nein, nicht Corona, das spielt in Harlanders Buch keine Rolle. Harlanders Virus ist greifbarer, nicht völlig neu, aber leise und schnell: Er legt Verkehrssysteme lahm, Weichen, Ampeln, Tower, Flugzeuge – und dann das Gesundheitssystem, das Mobilfunknetz sowie das gesamte Internet.
Und er tötet: In vielen europäischen Metropolen sterben Menschen durch ausgefallene Ampeln bei Verkehrsunfällen; sie kommen bei Flugzeugabstürzen ums Leben, weil die Computertechnik versagt; sie sterben auf Intensivstationen, weil die lebenserhaltenden und -rettenden Maschinen ihren computergesteuerten Geist aufgeben; sie werden bei Anschlägen extremistischer Gruppen ermordet.
Ein Computervirus, ursprünglich von der NSA für eigene Cyberangriffe entwickelt, geht dem US-Geheimdienst „verloren“. Er findet neue Meister in einer Hackergruppe, die ihn modifiziert und ohne jeden Skrupel auf Europa loslässt. Aber wer steckt hinter der ominösen Gruppe? Was sind deren Pläne? Kann man den Virus noch stoppen – oder ist Europa dem Untergang geweiht?
*** Erst das Virus, dann der Zusammenbruch ***
Diese Fragen sind es, mit denen Harlander den Leser fesselt, ihn im Plot vorantreibt, atemlos, angsterfüllt. Man erkennt schnell, wie abhängig man selbst, ja die ganze Gesellschaft, mittlerweile von der modernen Technik ist: Im Job geht nichts mehr ohne Computer, in der Bildung ebenso wenig. Kommunikation ohne Smartphone-Apps? Unvorstellbar. Klar, ein selbst auferlegtes, zeitlich begrenztes „digital Detox“ kann sich noch jeder vorstellen. Aber wenn das Handy nicht mehr funktioniert und das Internet tot ist, was dann?
Lieferketten brechen zusammen. Nahrungsmittel werden knapp. Wasseraufbereitung, Trinkwasserversorgung, Stromerzeugung und, und, und. Ohne moderne Technik dauert es nur Wochen und die heutige Web-Gesellschaft findet sich in der Steinzeit wieder. Die Technik macht die Menschen bequem: Navi per Karte? Nicht, wenn man ein mit dem Internet verbundenes, vor Staus und Radarfallen warnendes Gerät im Auto hat.
Kurz und auf den Punkt: Das Chaos regiert. Bei Harlander melden sich „Querdenker“ und rechte Hetzbrigaden. Sie vermuten hinter dem Internet-Shutdown die „politische Elite“, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgt. Erst der Computervirus, dann die politische Säuberung, dann eine „neue Gesellschaft“.
*** Agenten, Rechte, Terroristen ***
Bei Harlander wird zunächst ein Familienvater, Daniel Faber, verdächtigt, hinter all dem Ungemach zu stecken, der mittlerweile Dutzende Tote gefordert hat. Aber Faber, früher Spieleentwickler und Programmierer, versucht nur mit Reparatursoftware aus dem Darknet einen Fehler seines Teenie-Sohnes wieder auszubügeln und seinen Job zu retten. Der BND hat ihn dennoch auf dem Kieker. Ermittler Nelson Carius, ein Agentenneuling mit eigenen Interessen, merkt schnell, dass Faber der falsche Mann ist. Bis Carius und Faber aber zusammenarbeiten, dauert es – und das spielt den wirklichen Schurken in die Hände, deren irrwitziger Plan immer weiter fortschreitet.
Das bei Rowohlt erschienene „Systemfehler“ ist ein Pageturner wie „42 Grad“ mit fesselnder, brandaktueller Story und durchaus sympathischen Hauptfiguren. Bei den Nebenrollen hätten es aber durchaus ein bis zwei Charaktere weniger sein können: Da wäre etwa die nervige Nachbarin von Fabers Mutter oder auch Carius‘ Partnerin beim BND. Deren Schwächen liegen genau darin, dass der Leser sie so erwartet: eine typische Beamte, die zum Lachen in den Keller geht und offenbar einzig ihre Karriere im Blick hat, von Ehrgeiz zerfressen. Bis der Leser für sie Sympathien aufbringen kann, ist der Plot schon sehr weit fortgeschritten.
Aber das ist auch Jammern auf sehr hohem Niveau. Harlanders zweiter Thriller „Systemfehler“ hat wie bereits der erste das Zeug zum Hollywood-Blockbuster oder noch besser: für eine ausschweifende und in die Tiefe gehende Streamingserie. „Systemfehler“ birgt allerdings auch zwei Gefahren: Zum einen könnten radikale Rechte, „Reichsbürger“ oder Aluhut-„Querdenker“ den Plot als Blaupause für ihre feuchten Träume verwenden. Zum anderen hat der Bestsellerautor nun das Problem: Wie geht’s weiter, was kommt als Nächstes? Einen Fingerzeig gibt Harlander mit dem BND-Ermittler Carius und dessen Stochern in seiner eigenen Vergangenheit.
QUELLE (mit themenbezogenen Links): https://www.n-tv.de/leute/buecher/Ein-Systemfehler-legt-Europa-lahm-article22709787.html