Views: 97
UPDATE 2.8.2021: Hinweise auf die drei „Kommentare aus fremder Feder“ wurden in den Abschnitt „In den Vordergrund“ eingeflochten. Dort angebracht wurden auch Links auf den Klimawandel, die Saldenmechanik STÜTZEL und den Erdüberlastungstag.
Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – ähnlich wie in den letzten Wochen hier festgehalten: – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball “supertoll” geht – allerdings tritt hinzu ein schwergewichtiges noch: neben kurzfristigen – oder vielleicht doch: längerfristigen? – Inflationsgefahren dämmert seit einigen Wochen mit wachsender Zudringlichkeit eine andere, in ihrem Ausmaß noch immer nicht ganz klar zu umreißende Gefahr namens Delta-Virus herauf: deutlich wachsende Unruhe herrscht deshalb nicht nur bei Gesundheitsexperten, sondern sie nimmt auch bei Finanzanlegern, Unternehmen und vor allem in der Politik zu.
Hinzu treten Zeichen geringer Störungen im Wirtschaftsablauf: die Weltwirtschaft und die der großen Wirtschaftsnationen befinden sich auf hohem Niveau in weiterhin noch guter Fahrt, aber da und dort flackern schwache Warnzeichen auf. Sie müssen à la longue nichts bedeuten. Sorge bereiten die gestörten Lieferketten und die auch dadurch steigenden Preise über Import und Produktion.
Die Prognosen des Internationalen Währungsfonds, der Politiker und Wirtschaftsforschungsinstitute bleiben weiterhin optimistisch oder legen noch ein Stückchen auf die Optimismuswaage.
Von den Börsen gibt es erste, etwas deutlicher vernehmbare Warnzeichen, Blitz und Donner gar in China. Das gilt für Aktien wie auch für Anleihen an den großen Finanzmärkten. Nichts Genaues weiß man nicht, aber für Unruhe dort ist der Stoff jedenfalls vorhanden. Dazu kommen saisonale Faktoren: August und September sind (fast) sicher keine Hausse-Monate.
IN DEN VORDERGRUND rückten in der zurückliegenden Woche: neuerliche Verknappung am Ölmarkt – ein Inflationsindikator; Verknappung auch bei Doctor Copper: die Preise steigen infolge Nachfrageüberschuß und Warenmangel – gleichfalls ein Inflationsindikator. Kupfermarktkapriolen und weltweiter Aufschwung am Elektromarkt passen da sehr gut zusammen.
Der Internationale Währungsfonds pusht und treibt die Digitalisierung von Geld; er selbst – wie die Banken und Zentralbanken auch – wird getrieben von den Entwicklungen am „Bitcoin“-Markt und seinen Technologien.
Die Europäische Zentralbank (EZB) gefällt sich im Kleid ihres neuen Inflationsziels: die Wirtschaft solle ruhig überhitzen, dann erreichen wir eine angestrebte Inflation von 2 Prozent, so heißt es dort. Nun gut, wenn es gut geht; mehr dazu, zum Lieferketten-Problem und zum Wirtschaftswachstum von Bert Rürup und bei Daniel Gros, welche beide Gehör finden in „Kommentare aus fremder Feder“.
Aus der Ecke der Banken tönt es beruhigend: sie haben den Stresstest der EZB bestanden, etwas wackeliger sind dabei die Banken in Deutschland, Frankreich und Italien, Österreich liegt diesbezüglich im Mittelfeld.
Damit nicht genug: weniger einengende Schuldenregeln für die Staaten fordert der Vizepräsident der EZB: Schulden machen ist gut. Wirklich? Schon jetzt stöhnt das Weltklima unter dem stark angestiegenen CO2-Ausstoß des Wirtschaftsrebounds. Hat man noch immer nicht aus den alten Fehlern gelernt? Ein seit Jahrzehnten über anwachsende Schulden finanziertes Wirtschaftswachstum heizte Mutter Erde gehörig ein. Auf der anderen Seite wuchsen die Vermögen, der Salden-Mechanik STÜTZEL sei dank. Ja, aber die Arbeitslosen, die dann auf der Straße stehen, wenn man die Wirtschaft nicht mit (billigem) Geld bewässert? Eben das ist das Dilemma, in das sich Finanz- und Geldpolitik seit Jahrzehnten hineintheatert haben. Wann aber kommt die Rechnung?
Aber hoppla, es ist ja zuviel Geld da: in den Privathaushalten. Wie kommt man da heran? Das fragt sich der European Stability Mechanism.
Altenpflege als europaweiter Abzockmarkt – düstere Aussichten für künftige hochalte Pfleglinge. Motto: teuer und schlecht, ach nein: menschenverachtend. Küss‘ den Pfennig-Mentalität als Devise.
Österreichs Wirtschaft wieder in Schwung. SPÖ fordert Vermögenssteuer, um die seit Jahrzehnten verschleppte Pflege zu sichern. Nun ja, hatten wir davon nicht schon von einem SPÖ-Sozialminister vor Jahren gehört? Nicht Vermögen, Einkommen sind zu besteuern – und zwar progressiv. Auch die Kapitaleinkommen. Eine andere Sicht der Dinge entwickelt Martin Greive im Handelsblatt (=> Kommentare aus fremder Feder).
…oooOOOooo…
ÜBERSICHT
- CYBERCRIME
- Kaseya: Kein Lösegeld an Hacker für Generalschlüssel bezahlt
INTERNATIONAL - Kupfer zu Gold machen – Kupferpreis und Kupferangebot seit 2004
- Ölpreise sinken – Nachfragesorgen belasten
- IWF hebt BIP-Prognose 2022 an – Impfungen machen den Unterschied
- ZVEI: Welt-Elektromarkt erholt sich 2021 und 2022 deutlich – Zuwächse in China, Südkorea, Taiwan und Vietnam – dominieren – Gesamt-amerikanischer und europäischer Markt sind 2020 jeweils gleich stark geschrumpft
- IMF Executive Board Discusses the Rise of Public and Private Digital Money—A Strategy to Continue Delivering on the IMF’s Mandate
BÖRSEN - SENTIX-Sentimente: Skepsis geht, Overconfidence bleibt – China-Aktien-Unwetter droht auf andere Märkte überzugreifen – In Frankfurt lacht die Sonne vom Börsenhimmel: wie lange noch? – Deutscher Rentenmarkt zeigt Schwäche – Am Golde hängt, nach Golde drängt doch alles: längerfristig – Entspannung am Ölmarkt
- INTERNATIONAL: AAII Sentiment Survey: Optimistische US-Privatanleger – DAX-Anleger pessimistisch
- US-ANLEIHEMARKT: Seit Wochen stellt die Zinsentwicklung Anlageexperten vor ein grosses Rätsel – eine mögliche Erklärung
- CHINA – AKTIEN: Tech-Firmen bekommen Prügel: Warum Peking ein Börsenbeben auslöst
EUROPA – AKTIEN: Hat Europa die falschen Aktien? - EUROPA – MSCI: Verkehrte Welt: an Stelle forlaufender Gewinnkorrekturen nach unten heuer stetig bessere Gewinnprognosen
- DEUTSCHLAND – FONDS: Steigende Börsenkurse und ein solides Neugeschäft haben das verwaltete Vermögen der europäischen Fondsbranche in immer höhere Sphären gehoben
ZENTRALBANKEN
– EUROPÄISCHE UNION / EZB - EZB: Unternehmenskredite wachsen im Juni mit konstantem Tempo
- EZB/Panetta: Überhitzung der Wirtschaft notwendig
- EZB/De Guindos: Europas Banken sind robust – Keine Anzeichen, dass aus vorübergehender eine strukturelle Inflation wird – Inflationshöhepunkt für November mit 3 Prozent erwartet – Warnung vor „Klippeneffek“ bei Auslaufen des Anleihekaufprogramms PEPP 2022
- Eba: EU-Banken haben in Stress-Szenario über 10% Eigenkapital – CET1-Eigenkapitalquote der Banken sinkt im Test bis 2023 um 485 Basispunkte auf 10,2 (2020: 15,0) Prozent – Starke Unterschiede zwischen den Bankinstituten: größtes Kreditverlustrisiko bei Banken in Frankreich, Italien und Deutschland – Risikomix aus Kreditverlusten, Marktverlusten und Fehloperationen – Bei auslaufenden Zahlungsmoratorien steigt Anteil wertgeminderter Kredite
- EZB/Panetta will mehr Freiheiten für europäische Finanzpolitik – Gefordert: weniger Defizit- und Schuldenregelungen – Wiederaufbaufonds Next Generation (NGEU) als „Europäischer Sozialvertrag“ und Dauermodell – ESM mit neuer Nutzung – Bessere Optionen für antizyklische Finanzpolitik
– ÖSTERREICH / OeNB
OeNB unterstützt Vorarbeiten für einen digitalen Euro
USA - US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet
- API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände
- USA: Konsumklima Michigan trübt sich ein – Warnung vor Inflationsspirale – „Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein Inflationssturm aufziehen wird“
- Chicagoer Einkaufsmanagerindex überraschend auf auf 73,4 Punkte und liegt somit knapp unter jüngstem Höchststand im Mai 2021
- US-Wirtschaft wächst im 2Q schwächer als erwartet
- Stimmung der US-Verbraucher im Juli laut Michigan University eingetrübt – Einschätzung der aktuellen Lage gleichfalls, aber gering gesunken
- Stimmung der US-Verbraucher laut Conference Board im Juli unerwartet verbessert
- Konsum der US-Haushalte im Juni mit 1 Prozent im Plus etwas höher als erwartet, Einkommen sanken hingegen
- US-Auftragseingang für langlebige Güter schwächer gestiegen als erwartet
- USA: Stärkster Anstieg der Immobilienpreise seit 2004
- USA: Häuserpreise steigen etwas stärker als erwartet
- USA: Schwebende Hausverkäufe fallen überraschend
- USA: Neubauverkäufe geben weiter nach
- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet
- Unterhändler im US-Senat wohl einig über Infrastrukturprogramm
SCHWEIZ - Was, wenn die Asiaten nicht wiederkommen? – Schweizer Bergbahnen stecken tief in der Krise. Mitten in der Hochsaison bleiben die Terrassen leer
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - European Stability Mechanism: From savings to spending: Fast track to recovery
- Euroraum-Verbraucherpreise steigen auf Jahressicht etwas stärker als erwartet auf 2,2 (Juni: 1,9) Prozent, sind aber im Monatsvergleich um 0,1 Prozent gesunken – Kerninflation flacht ab auf 0,7 Prozent (Juni: 0,9) – Energiekosten stark angestiegen, nicht unerheblicher Anstieg bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln sowie weiteren Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol
- Wirtschaftsstimmung im Euroraum hellt sich wie erwartet auf
- Euroraum-Wirtschaft wächst preisbereinigt im 2. Quartal um 13,7 Prozent auf Jahressicht und damit stärker als erwartet – Auch das Quartalswachstum liegt mit 2 Prozent über den Erwartungen
- Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im Juni deutlich auf 7,7 Prozent
- IfW: Streben nach wirtschaftlicher Autonomie würde für EU-Länder teuer – China im Fokus: Abkoppeln der EU von internationalen Lieferketten würde EU-Staaten hunderte Milliarden Euro kosten – Einführung von Importzöllen ließe BIP deutlich weniger wachsen, bei Gegenmaßnahmen in die EU exportierender Länder noch stärker – Deutschland besonders betroffen – Isolation als falscher Weg, Alternativen: Lieferantennetz breiter aufzustellen, Recycling fördern, Lagerhaltung verbessern
- Graues Gold — Das Milliarden-Geschäft mit der Altenpflege
FRANKREICH - Frankreich: Inflation schwächt sich ab
- Frankreich: Verbraucherstimmung trübt sich ein
ITALIEN - Italien: Inflation geht überraschend deutlich zurück
BELGIEN - Belgiens Geschäftsklimaindex im Juli auf Rekordhoch
DEUTSCHLAND - Erneut starker Anstieg der deutschen Importpreise auf Jahressicht auf 13 Prozent, ohne Energieeinfuhren um 7 Prozent – Energieeinfuhren um 89 Prozent teurer – Basiseffekt als eine Ursache
- INFLATION – Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer rechnet nicht mit einer dauerhaften Erhöhung der Inflationsrate
- Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juli auf 3,1 Prozent, die nationale auf 3,8 Prozent – Jahresteuerungen: Nahrungsmittel 4,3 (Juni: 1,2) Prozent, Energie11,6 (9,4) Prozent, Dienstleistungs 2,2 Prozent (1,6) Prozent -Basiseffekte treiben: coronabedingte Mehrwertsteuersenkung im Vorjahr, CO2-Bepreisung u.a. – Änderung der Gütergewichte im HVPI sorgt für Auseinanderklaffen von HVPI und nationaler Inflationsrate
- DIW-Konjunkturbarometer sinkt für 3Q – BIP 2Q geschätzt +2,5 Prozent – Wirtschaftsplus in Q2 dank Erholung in vielen Dienstleistungsbranchen nun abgeschlossen – Industrie im zweiten Quartal durch fehlende Vorleistungsgüter ausgebremst – Anziehende Industriedynamik für späteren Jahresverlauf erwartet
- Deutsche Wirtschaft wächst im 2Q schwächer als erwartet
- Delta-Variante sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft – Einschätzung der künftigen Geschäfte belastet – Geschäftsklima im Dienstleistungssektor verschlechtert – Sommerhalbjahr dürfte hohes Wachstum bringen, das vierte Quartal eine „massive Verlangsamung des Wachstums“
- Kurzvideo – USA verlängert Einreisestopp: Beyer: Industrie „gerät immer mehr in Schieflage“
- Ifo-Exporterwartungen fallen im Juli leicht
- Ifo-Geschäftsklima sinkt im Juli unerwartet – Gestörte Lieferketten und steigende Infektionszahlen lassen Erwartungen und Einschätzung der aktuellen Lage sinken
- Ifo-Exporterwartungen fallen im Juli leicht
- Umsatz in gewerblicher Wirtschaft Deutschlands um 2,7 Prozent höher
- Immobiliengeschäft im Wandel : Genau hinsehen – Insider sehen keine Gefahr einer Überhitzung des Immobilienmarktes – Immobilieninvestoren: statt Büro- nun Wohnimmobilien im Blickpunkt
- GfK: Konsumklima stagniert entgegen den Erwartungen – Konjunkturerwartung weiter auf sehr hohem Niveau – Einkommenserwartung mit moderaten Einbußen
- Weniger Geld am Monatsende: Corona setzt Löhne unter Druck
- Pro-Kopf-Verschuldung steigt 2020 um gut 14 Prozent auf 26.141 Euro
- IG Metall warnt vor Arbeitsplatzverlagerung in Autoindustrie – Massiver Arbeitsplatzabbau im Rahmen des Klimaschutzes erwartet – Osteuropa profitiert: Verschiebung der Produktion in Best-Cost-Länder mit niedriger Kostenlast – Forderungen: Ausbau der Mitbestimmung, Recht auf mehr Qualifizierung, mehr staatliche Hilfen
- Ifo-Beschäftigungsbarometer gesunken
- Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im Juni um 0,2 Prozent
- BA-Stellenindex im Juli deutlich gestiegen
- Ifo: Homeoffice geht weiter zurück
- FIRMENPLEITEN – Der deutschen Wirtschaft droht nach Expertenmeinung nach dem Auslaufen staatlicher Hilfsleistungen ein deutlicher Anstieg bei den Firmenpleiten
ÖSTERREICH
– STATISTIK - Inflation im Juli 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 2,7%
- Erzeugerpreise des Produzierenden Bereichs im Juni 2021 um 6,9% gestiegen
- Konjunktur-Frühschätzung Juni 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich über Vorkrisenniveau; Transportaufkommen auf der Straße hat im 2. Quartal 2021 stark angezogen
- Zweiter Pandemie-Juni bringt ein Nächtigungsplus im Vergleich zum Juni 2020, liegt aber deutlich unter Vorkrisenniveau
- Kinder- und Jugendhilfe betreute 2020 38.489 Minderjährige in der Familie, 12.678 außerhalb der Familie
- Fast jeder zweite Verkehrstote im 1. Quartal 2021 bei Unfällen mit Lkw
- Zahl der Sterbefälle in den ersten Juli-Wochen deutlich niedriger als Ende Juni
– MELDUNGEN - Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB: BIP Ende Juli erstmals wieder knapp über dem Vorkrisenniveau
- BIP stieg im II. Quartal 2021 um 4,3% – Schnellschätzung des WIFO: Industrie und Lockerungen prägten Konjunkturerholung – Endgültiges Ergebnis wird Ende August veröffentlicht
- Politik: SPÖ: Pflege mit Vermögenssteuer finanzieren
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Daniel Gros: Wirtschaftspolitischer Graben zwischen EU und USA – Die EU und die USA driften wirtschaftspolitisch auseinander. Das dürfte den Dollar stärken und Europas Abhängigkeit steigern
- Bert Rürup: Wirtschaftswachstum Deutschlands 2021 bei erwarteten 2,7 Prozent – Die vierte Corona-Welle baut sich auf – Mangel an elektronischen Bauteilen wird immer schlimmer – Inflationsgefahr? Höchste Inflation seit 1993 – Teuerung bei Vorprodukten, doch kein markanter Lohnschub in Sicht!
- Martin Greive: Nachgefragt – 30. Juli 2021: Steuern eines Millionärs: „Oh, das ist schon wenig“ – Der Millionär Ralph Suikat fordert höhere Steuern für Reiche. Geld geselle sich wie bei ihm zu Geld – während einfache Arbeiter höher besteuert würden als er
…oooOOOooo…
CYBERCRIME
Kaseya: Kein Lösegeld an Hacker für Generalschlüssel bezahlt – dpa-AFX, 27.7.2021
Der jüngst von einem Hackerangriff betroffene IT-Dienstleister Kaseya hat Spekulationen zurückgewiesen, er könnte Lösegeld für den Generalschlüssel zur Freischaltung der betroffenen Computer seiner Kunden gezahlt haben. Weder direkt, noch über andere sei Geld an die Angreifer gegangen, betonte Kaseya in der Nacht zum Dienstag.
Eine Hackergruppe hatte Anfang Juli über eine Schwachstelle in der Kaseya-Software Rechner bei Dutzenden Kunden der Firma verschlüsselt. Vergangene Woche teilte Kaseya mit, man habe einen Generalschlüssel bekommen, mit dem man die blockierten Computer entsperren könne.
Die Hacker hatten für ein solches Entschlüsselungswerkzeug zuvor 70 Millionen Dollar gefordert. Da Kaseya keine Angaben zur Herkunft seines Generalschlüssels machte, wurde zum Teil auch spekuliert, das Unternehmen könne ihn bei den Hackern gekauft haben.
Die US-Firma betonte nun jedoch, dass man sich dafür entschieden habe, nicht mit den Angreifern zu verhandeln. Die Herkunft des Generalschlüssels blieb unterdessen weiter unklar. Kaseya versicherte aber, dass damit zu 100 Prozent bei der Attacke verschlüsselte Dateien gerettet werden könnten.
Da viele der betroffenen Kaseya-Kunden selbst IT-Dienstleister für andere sind, reichten die Auswirkungen der Attacke bis nach Schweden, wo die Supermarkt-Kette Coop Hunderte Läden wegen nicht funktionierender Kassensysteme nicht öffnen konnte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53509843-kaseya-kein-loesegeld-an-hacker-fuer-generalschluessel-bezahlt-016.htm
INTERNATIONAL
Sylvia Walter: Kupfer zu Gold machen – Kupferpreis und Kupferangebot seit 2004 – Finanz & Wirtschaft, 28.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/kupfer-supply-gap.png
Für die Rohstoffanalysten von Goldman Sachs scheint die Sachlage völlig klar zu sein: Der Kupferpreis wird weiter steigen. Und dies nicht nur in der kurzen Frist, sondern einige Faktoren sprächen dafür, dass sich mit dem rötlichen Halbedelmetall auch in der langen Frist gutes Geld verdienen lässt.
Vom derzeitigen Kursniveau von etwa 9700 $ pro Tonne könne der Preis bis Jahresende 10% steigen und in einem Jahr 20% höher liegen als aktuell, so die Prognosen der US-Investmentbank.
Der Markt werde dauerhaft in Unterversorgung bleiben, die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot auf dem Kupfermarkt werde in den kommenden zehn Jahren nur noch grösser werden (dunkelblaue Linie). Diese Lücke bestimmt auch die Richtung der Preisentwicklung von Kupfer mit einem Vorlauf von etwa einem Jahr (hellblaue Linie).
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2106/
Ölpreise sinken – Nachfragesorgen belasten – dpa-AFX, 26.7.2021
Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken und haben damit einen Teil ihrer Gewinne der vergangenen Handelstage eingebüßt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,66 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 71,58 Dollar. Zuvor waren die Ölpreise stärker unter Druck geraten, so dass die Notierungen am Vormittag zeitweise jeweils mehr als einen Dollar abrutschten.
Der Rückgang der Ölpreise zum Wochenauftakt folgte einem starken Anstieg der Notierungen in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche. Marktbeobachter verwiesen auf wachsende Sorgen vor neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, nachdem die ansteckendere Delta-Variante des Virus für steigende Infektionszahlen sorgt. Vor diesem Hintergrund wird am Markt ein Rückgang der Nachfrage nach Treibstoffen befürchtet, was die Ölpreise belastet.
Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies außerdem auf mehrere Beratungsunternehmen, die nur mit einem leichten Anstieg der chinesischen Ölimporte rechnen. Demnach dürften die Einfuhren in diesem Jahr bestenfalls um zwei Prozent steigen und damit so wenig wie seit 20 Jahren nicht. „Gründe hierfür sind das Vorgehen der Behörden gegen Betrugsfälle bei den Importquoten sowie die hohen Ölpreise“, sagte Fritsch.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53503098-oelpreise-sinken-nachfragesorgen-belasten-016.htm
Hans Bentzien u.a.: IWF hebt BIP-Prognose 2022 an – Impfungen machen den Unterschied – DJN/dpa-AFX, 27.7.2021

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden Jahr unverändert gelassen und die für 2022 leicht angehoben. Wie der IWF in einem Update zu dem im April veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick mitteilt, sind die Prognosen für die Industrieländer („Advanced Economies“) generell etwas höher als im April und die für Schwellen-/Entwicklungsländer etwas niedriger.
Der IWF rechnet für 2021 wie zuvor mit einem Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 6,0 Prozent und prognostiziert für 2022 jetzt 4,9 (zuvor: 4,4) Prozent Wachstum. Die aktuellen Prognosen für die Schwellen- und Entwicklungsländer werden mit 6,3 (6,7) und 5,2 (5,0) Prozent angegeben, die für die Industrieländer mit 5,6 (5,1) und 4,4 (3,6) Prozent.
„Der Zugang zu Impfstoffen hat sich als die wichtigste Trennlinie herausgestellt, entlang derer sich die globale Erholung in zwei Blöcke aufspaltet: Die, die sich auf eine weitere Normalisierung der Aktivität im Laufe dieses Jahres freuen können – fast alle fortgeschrittenen Volkswirtschaften – und diejenigen, die immer noch mit wiederkehrenden Infektionen und steigenden Covid-Todeszahlen konfrontiert sind“, heißt es in dem Bericht.
Eine wichtige Stütze der Weltwirtschaft sind laut IWF die umfangreichen US-Konjunkturprogramme. Seine US-Prognosen hebt der IWF daher auch besonders deutlich an – auf 7,0 (6,4) und 4,9 (3,5) Prozent. Zugleich weist er aber auf das Risiko hin, dass ein so starkes Wachstum die Inflationserwartungen deutlich heben könnte, was letzten Endes zu einer Straffung der Geldpolitik und schlechteren Finanzierungsbedingungen für Schwellen- und Entwicklungsländer führen würde. Diese Länder wären dann doppelt getroffen – von der Pandemie und steigenden Dollar-Kursen, gibt er zu bedenken.
Die Wachstumsprognosen des Euroraums wurden auf 4,6 (4,4) und 4,3 (3,8) angehoben. Für Deutschland erwartet der IWF jetzt BIP-Anstiege von 3,6 (3,6) und 4,1 (3,4) Prozent, was er schon kürzlich zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mitgeteilt hatte. Frankreichs Prognosen blieben unverändert bei 5,8 und 4,2 Prozent, Italiens wurden auf 4,9 (4,2) und 4,2 (3,6) Prozent angepasst und Spaniens auf 6,2 (6,4) und 5,8 (4,7) Prozent.
Der Großteil der Prognosesenkungen für 2021 entfällt auf die asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländer, deren BIP-Schätzung für 2021 auf 7,5 (8,6) Prozent reduziert wurde, was durch eine Anhebung für 2022 auf 6,4 (6,2) Prozent bei weitem nicht ausgeglichen wird. Für das besonders hart von der Pandemie getroffene Indien rechnet der IWF nur noch mit einem BIP-Anstieg um 9,5 (12,5) Prozent. Die Prognose für 2022 wurde auf 8,5 (6,9) Prozent angehoben.
Die IWF-Prognosen beruhen auf der Annahme, dass die lokale Übertragung des Coronavirus Ende 2022 überall auf ein niedriges Niveau gesunken ist, und zwar wegen einer Kombination aus gezielteren Vorsichtsmaßnahmen und verbessertem Zugang zu Impfstoffen und Therapien.
Anfang Juli hob der IWF zudem seine Wachstumsprognose für die USA für dieses Jahr erneut an, von zuletzt 6,4 Prozent auf rund 7 Prozent. Das wäre für die weltgrößte Volkswirtschaft das stärkste Wachstum seit einer Generation, was auch die globale Konjunktur beflügeln würde. Als Gründe für das stärkere Wachstum nannte der IWF unter anderem das im März verabschiedete massive Konjunkturpaket.
Die vergleichsweise hohe IWF-Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft liegt zum Teil auch daran, dass viele Staaten im Vorjahr wegen der Corona-Krise eine Rezession von historischem Ausmaß erlebt hatten und nun wieder aufholen. Laut IWF-Daten vom April brach die globale Wirtschaft 2020 um 3,3 Prozent ein.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53516698-iwf-hebt-bip-prognose-2022-an-impfungen-machen-den-unterschied-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53509886-neue-iwf-prognose-zum-wachstum-der-weltwirtschaft-016.htm
Andreas Kißler (WSJ): ZVEI: Welt-Elektromarkt erholt sich 2021 und 2022 deutlich – Zuwächse in China, Südkorea, Taiwan und Vietnam – dominieren – Gesamt-amerikanischer und europäischer Markt sind 2020 jeweils gleich stark geschrumpft – DJN, 28.7.2021
Der Weltmarkt für elektrotechnische und elektronische Güter wird sich nach Einschätzung des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) um 9 Prozent im laufenden Jahr steigern, das dabei auch von Basiseffekten getrieben werde. 2022 sollte der Welt-Elektromarkt um 6 Prozent zulegen können, teilte der Verband in Frankfurt mit. Im vergangenen Jahr sei der Markt auf 4.603 Milliarden Euro gekommen. „Damit hat er sein 2019er Niveau trotz Corona-Pandemie halten können“, sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Für Deutschland rechnet der ZVEI 2021 mit einem Anstieg um 6 Prozent und 2022 um 7 Prozent.
„Vor allem durch Zuwächse in China, aber auch einigen anderen asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan oder Vietnam konnte ein Rückgang verhindert werden“, erklärte Gontermann mit Blick auf den Weltmarkt. Auf Asien entfielen im vergangenen Jahr laut ZVEI mit 2.896 Milliarden Euro 62,9 Prozent des globalen Elektromarktes. Nach seinem immer noch leichten einprozentigen Anstieg 2020 könnte der asiatische Markt 2021 um 10 Prozent und damit unter allen Kontinenten am kräftigsten zulegen. Für 2022 ging der ZVEI hier von einem Wachstum um 7 Prozent aus.
Der chinesische Markt – mit 1.898 Milliarden Euro und einem Weltmarkt-Anteil von 41,2 Prozent der mit weitem Abstand größte Ländermarkt – sollte nach seinem letztjährigen Plus von 4 Prozent 2021 um 11 und 2022 um noch einmal 8 Prozent expandieren können. In Japan ging der Elektromarkt nach den Angaben im vergangenen Jahr schätzungsweise um 6 Prozent auf 296 Milliarden Euro zurück und nahm mit einem Anteil von 6,4 Prozent die dritte Position im globalen Ranking ein. Für dieses Jahr werde hier wieder ein Wachstum von 6 Prozent erwartet, für 2022 ein geringeres von 3 Prozent.
Der gesamt-amerikanische Elektromarkt ist 2020 nach vorläufigen Berechnungen des ZVEI um 3 Prozent auf 852 Milliarden Euro geschrumpft. Sein Anteil am globalen Markt belief sich damit auf 18,5 Prozent. Die Erholungsaussichten für 2021 lägen bei plus 9 Prozent. Im Jahr 2022 könnte der Markt auf dem Kontinent noch einmal um 5 Prozent zulegen. Für den US-Markt – der 2020 um ein Prozent auf 611 Milliarden Euro nachgab und weltweit die zweite Position im Länderranking einnahm – sei für dieses Jahr ebenfalls mit einem Plus von 9 Prozent zu rechnen und im kommenden mit einem Wachstum von 5 Prozent.
In Europa fiel der Marktrückgang 2020 laut ZVEI mit minus 3 Prozent so hoch aus wie in Amerika. Mit 743 Milliarden Euro mache der europäische Elektromarkt noch 16,1 Prozent des Weltmarktes aus. Dieses Jahr könnte er der ZVEI-Prognose zufolge um 7 Prozent zulegen und im kommenden Jahr um 6 Prozent. Der deutsche Markt für elektrotechnische und elektronische Erzeugnisse gab im vergangenen Jahr laut den Angaben um 5 Prozent auf 120 Milliarden Euro nach, blieb mit einem Anteil von 2,6 Prozent aber der fünftgrößte der Welt. Für 2021 rechnet der ZVEI mit einem Anstieg um 6 Prozent. Für 2022 geht der ZVEI von einem Marktwachstum um 7 Prozent auf dann 136 Milliarden Euro aus.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53523762-zvei-welt-elektromarkt-erholt-sich-2021-und-2022-deutlich-015.htm
OECD area employment rate rose to 66.8% in the first quarter of 2021, but wide disparities across countries are visible – 26.7.2021, OECD
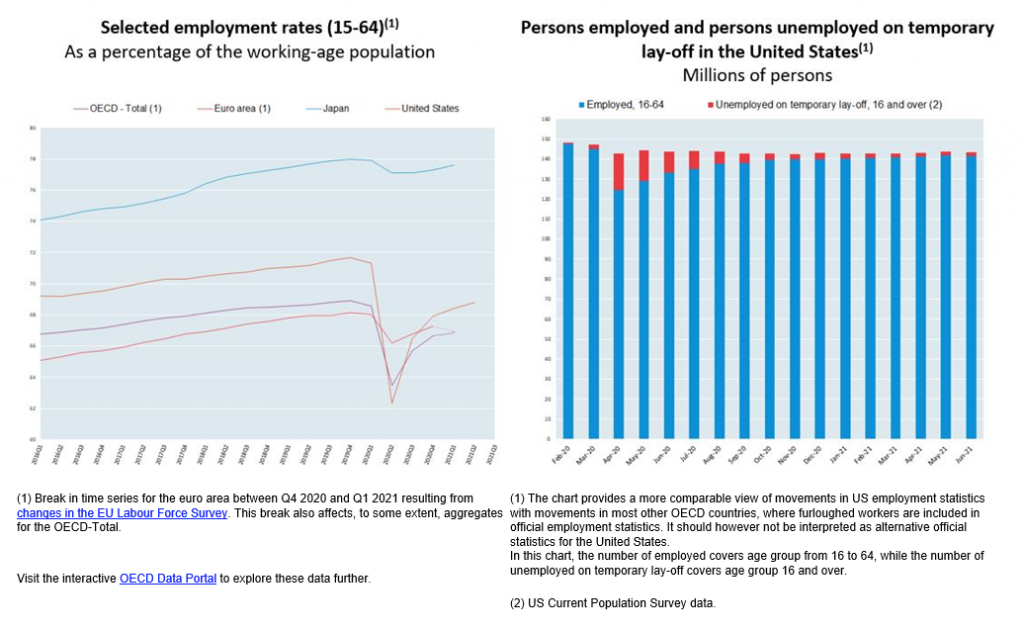
The OECD area employment rate – the share of the working-age population with jobs – rose to 66.8% in the first quarter of 2021, from 66.7% in the previous quarter. Some care is needed in interpreting the latest developments in the OECD employment rate, as methodological changes to the EU Labour Force Survey blur the comparison between the fourth quarter of 2020 and the first quarter of 2021 for EU countries. In addition, a large part of the increase in the third and, to a lesser extent, fourth quarter of 2020 reflects the return to work of furloughed workers in Canada and the United States, where they are recorded as unemployed, whereas in most other countries, they are recorded as employed.
In the euro area, the employment rate stood at 66.9% in the first quarter of 2021, as compared to 68.4% in the United States and 77.6% in Japan. A large disparity is also observed within the area, with the employment rate ranging from a maximum of 79.3% in the Netherlands to a minimum of 53.9% in Greece.
QUELLE: https://www.oecd.org/newsroom/employment-situation-oecd-first-quarter-2021.htm
IMF Executive Board Discusses the Rise of Public and Private Digital Money—A Strategy to Continue Delivering on the IMF’s Mandate – IMF, 29.7.2021
The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) discussed a staff paper on “The Rise of Public and Private Digital Money—A Strategy to Continue Delivering on the IMF’s Mandate”. A companion paper, “The Rise of Digital Money—A Strategic Plan to Continue Delivering on the IMF’s Mandate,” was discussed by the Executive Board in an informal meeting on April 2, 2021, and is also being published today.
The paper lays out an operational strategy for the IMF to continue to deliver on its mandate given the rapidly changing developments stemming from the rise of public and private digital money.
The paper begins by summarizing the forces of change driving the adoption of digital forms of money and the new policy questions that emerge. It then offers a vision for how the IMF’s core activities and output will need to evolve and discusses how the IMF intends to partner with other organizations, and to grow and structure internal resources to fulfill this vision.
The paper analyzes the wide-ranging and profound implications of digital money for the IMF membership. First, new forms of money must remain trustworthy. They must protect consumers, be safe and anchored in sound legal frameworks, and support financial integrity. Second, domestic economic and financial stability must be protected by carefully designed public-private partnerships, a smooth transition of the role of banks, and fair competition. And digital money should be designed to support climate sustainability and efficient fiscal policy. Third, the international monetary system (IMS) should remain stable and efficient. Digital money must be designed, regulated, and provided so that countries maintain control over monetary policy, financial conditions, capital account openness, and foreign exchange regimes. Payment systems must grow increasingly integrated, not fragmented, and must work for all countries to avoid a digital divide. Moreover, reserve currency configurations and backstops must evolve smoothly.
The paper provides a case of how the IMF within its mandate can help ensure that widespread adoption of digital money fosters domestic economic and financial stability, and the stability of the IMS. The paper describes how the IMF can monitor, and advise on, this rapid and complex transition for all members via its four core competencies: near universal membership; focus on macro-financial policies and spillovers; diversity of expertise; and unique ties to member countries—central banks and ministries of finance—through surveillance and capacity development.
*** Executive Board Assessment [1] ***
Executive Directors welcomed the opportunity to discuss the strategy to continue delivering on the IMF’s mandate given the rise of digital money. They noted that an increased adoption of digital money can foster greater efficiency and financial inclusion but also poses important challenges, and that the Fund has a critical role to play to help its members harness the benefits and manage the risks of digital money. Against this background, Directors broadly welcomed the staff’s proposals for closer engagement with other organizations and country authorities involved in this area, tailored support to member countries, and broader efforts in capacity development. Noting the fast-moving developments with digitalization and the need for the Fund to act swiftly and be at the forefront in this area, and be able to assist its members, many Directors found the strategy to be appropriately ambitious. Many other Directors, however, called for further prioritization and a more phased implementation of the strategy, given the complexity of the issue and the evolving regulatory environment.
Directors agreed that digital money has implications that lie at the core of the Fund’s mandate and that the Fund must be part of the discussions on these issues. In particular, digital money has wide-ranging implications for the international monetary system, spillover and cross-border effects, and the structure and stability of domestic economies. Directors, therefore, emphasized that digital money must be designed, regulated, and provided so that countries maintain control over monetary policy, financial conditions, capital account openness, and foreign exchange regimes. They also underscored that domestic economic and financial stability must be protected by carefully designed public-private partnerships, a smooth transition of the role of banks, and fair competition. Ensuring financial integration and inclusion will also be important.
Directors broadly agreed that given its mandate, near-universal membership, focus on macro-financial policies and spillovers, diversity of expertise, and unique ties to member countries, the Fund could serve as a thought leader in analytical work and policy development, particularly on issues related to the international monetary and financial system, in close collaboration with other organizations and provide timely advice in surveillance and capacity development to its members when requested. They also saw a role for the Fund in serving as a bridge between the experience of its membership and the international policy-making process. Directors underscored the importance of tailored advice, given the different stages of development of this issue and different capacities among member countries. In particular, low-income countries and EMDCs with less developed digital capabilities will need timely advice and capacity development assistance in macro critical areas pertinent to these countries. A number of Directors saw scope for the Fund to focus more at this stage on the development of analytical frameworks and on multilateral surveillance and capacity development, and piloting or limiting the coverage of this issue in bilateral surveillance.
Directors underscored the need to focus on the Fund’s comparative advantage and to partner and collaborate with other international financial institutions, country authorities, standard setters, as well as the private sector, to maximize synergies and minimize duplication of work and foster knowledge sharing. Effective delineation of responsibilities will be important. To ensure efficiency gains and avoid putting an excessive burden on hiring external experts, Directors also emphasized the importance of internal training of fungible economists to mainstream this important workstream, as well as staff exchanges with other organizations and country authorities. They also underscored the importance of promoting knowledge sharing and cooperation between country teams and functional departments.
Directors noted the proposal on resource allocation and broadly agreed that this would need to be considered holistically in the context of the broader budget augmentation request. They called for consideration of policy options and trade-offs in deciding the resource allocations in the new areas of work. As such, Directors looked forward to the Board engagement on the proposed budget augmentation request. In their preliminary assessment, many Directors were supportive of, or open to considering, the resource request, while many other Directors suggested a more modest, phased increase in resources calibrated to actual developments and finer details on work priorities. A number of Directors emphasized the importance of prioritizing and ensuring adequate resources to assist members, particularly LICs, with low capacity for mitigating the risks from the spread of digital money and from spillovers.
Going forward, regular engagement with the Board will be important to reevaluate the appropriateness of the strategy and any agreed resource allocation.
[1] At the conclusion of the discussion, the Managing Director, as Chairman of the Board, summarizes the views of Executive Directors, and this summary is transmitted to the country’s authorities. An explanation of any qualifiers used in summings up can be found here: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.
QUELLE: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/28/pr21230-imf-executive-board-discusses-rise-public-private-digital-money-strategy-imf-mandate
SIEHE DAZU:
=> Policy Paper No. 2021/054 : The Rise of Digital Money – IMF, 29.7.2021
Rapid technological innovation is ushering in a new era of public and private digital money, bringing about major benefits in terms of efficiency and inclusion. To reap the full benefits and manage risks, authorities around the world will have to address new policy challenges. These are widespread, complex, rapidly evolving, and have profound implications. This paper identifies the main challenges currently arising regarding consumer protection and financial integrity, domestic financial and economic stability, as well as the stability and efficiency of the international monetary system. The paper argues that many of these challenges intersect the Fund’s mandate. The Fund must therefore monitor, and advise on, this rapid and complex transition for all members. The paper ends with a broad vision of how to deliver on this mandate and serve its members, including by enhancing resources, and collaborating closely with other institutions. This is the first of two papers, the second of which lays out a more detailed operational strategy.
QUELLE: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/07/28/The-Rise-of-Digital-Money-462914
=> Policy Paper No. 2021/055 : The Rise of Public and Private Digital Money – IMF, 29.7.2021
Following the companion paper on the new policy challenges related to the adoption of digital forms of money, this paper presents an operational strategy for the IMF to continue delivering on its mandate of ensuring domestic and international financial and economic stability. The paper begins by summarizing the forces driving the adoption of digital forms of money, and the new policy questions that emerge. It then focusses on how the IMF’s core activities and output will need to evolve, including surveillance, capacity development, and analytical foundations. It ends by discusses how the IMF intends to partner with other organization, and to grow and structure internal resources to fulfill this vision.
QUELLE: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/07/28/The-Rise-of-Public-and-Private-Digital-Money-462919
BÖRSE
SENTIX-Sentimente: Skepsis geht, Overconfidence bleibt – China-Aktien-Unwetter droht auf andere Märkte überzugreifen – In Frankfurt lacht die Sonne vom Börsenhimmel: wie lange noch? – Deutscher Rentenmarkt zeigt Schwäche – Am Golde hängt, nach Golde drängt doch alles: längerfristig – SENTIX, 1.8.2021
Dunkle Wolken mit Donnergrollen und da und dort Blitzen am chinesischen Aktienhimmel, die so bald nicht vergehen werden. Bei weitem nicht ganz so dunkle Wolken hingegen am US-Börsenhimmel. Wieweit das Wetter andere Börsenplätze anstecken wird, bleibt abzuwarten. Nur über der Franfurter Börse lacht noch die Börsensonne – und das schon seit geraumer Zeit. Wie lange noch? Das geradezu maßlose Vertrauen der Anleger in weitere Kursgewinne ist ein Warnzeichen. Gold hingegen bleibt längerfristig eine Option.
Auch über dem deutschen Rentenmarkt ziehen dunklere Wolken herein, die möglicherweise Vorboten eines Unwetters sein könnten.
QUELLE (REGISTRIERPFLICHT): https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-31-2021.html
INTERNATIONAL: AAII Sentiment Survey: Optimistische US-Privatanleger – DAX-Anleger pessimistisch – DJN, 29.7.2021
Die jüngsten Sentimentumfragen zeigen eine entgegengesetzt verlaufende Stimmung unter den Privatanlegern, und zwar dies- wie jenseits des Atlantiks. In Deutschland könnten die bevorstehenden Bundestagswahlen die Anleger zunehmend verunsichern, ist doch kein klarer Trend abzulesen und ist zudem kein Kanzlerkandidat am Start, der den Umfragen zufolge eine Mehrheit hinter sich hat.
Die USA haben dagegen ihren Präsidenten bereits gewählt, und dieser schickt neue milliardenschwere Konjunkturprogramme auf den Weg. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey stieg das Bullenlager deutlich auf 36,2 Prozent von 30,6 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 24,1 (30,6) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 39,7 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu nach 38,7 Prozent in der Vorwoche.
Bei den Privatanlegern in Deutschland wird durch die jüngste Erhebung dagegen deutlich, dass sie dem DAX mehrheitlich auf mittlere Sicht offenbar keine wesentlichen Kursgewinne mehr zutrauen. Möglicherweise wollte man aber auch nur aufgelaufene Gewinne festschreiben. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg erwartet aber, dass die Privatanleger unterhalb von 15.000 DAX-Zählern als Käufer zurückkehren. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, reduzierte sich der Bullenanteil der Privatanleger um deutliche 7 Punkte auf nur noch 29 Prozent. Das Lager der Bären stieg um 5 Prozentpunkte auf 45 Prozent, während das neutrale Lager um 2 Prozentpunkte auf nun 26 Prozent zulegte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53540964-sentiment-optimistische-us-privatanleger-dax-anleger-pessimistisch-015.htm
US-ANLEIHEMARKT: Seit Wochen stellt die Zinsentwicklung Anlageexperten vor ein grosses Rätsel – eine mögliche Erklärung – Neue Zürcher Zeitung, 24.7.2021
Sinkende Zinsen, wie sie in den vergangenen Monaten zu beobachten waren, signalisieren eigentlich eine sich abschwächende Konjunktur und wären ein Warnsignal für die Aktienmärkte. Es gibt aber eine plausible Erklärung, die zu völlig anderen Schlüssen führt.
Die Zinsen sind der Preis des Geldes. Sie beeinflussen eine Reihe von elementaren Entscheidungen, etwa ob Unternehmen Kredite aufnehmen, um neue Maschinen zu kaufen, oder ob Anleger ihr Vermögen eher in Anleihen oder in Aktien investieren. Sie gelten zudem als wichtiger Signalgeber für die künftige Entwicklung der Konjunktur. Liegen die langfristigen Sätze über den kurzfristigen und weitet sich der Abstand aus, spricht man von einer steiler werdenden Zinsstrukturkurve. Eine solche wird als zuverlässiges Zeichen für eine Konjunkturerholung angesehen.
Die Zinskurven signalisieren eine nachlassende Dynamik
Das Gegenteil einer flacher werdenden Zinsstrukturkurve deutet auf eine nachlassende konjunkturelle Dynamik hin, und stellt sich die vergleichsweise seltene Konstellation ein, dass die langfristigen unter die kurzfristigen Zinssätze sinken (man spricht dann von einer inversen Zinsstrukturkurve), gilt das als Vorbote einer Rezession. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Ökonomen und Anlagestrategen die Zinsentwicklung seit eh und je mit Argusaugen betrachten.
Ebenso verständlich ist, dass ein auf den ersten Blick unerklärliches Phänomen die Marktteilnehmer seit Wochen beunruhigt: In den USA sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen seit März deutlich gefallen. Damals lagen sie bei 1,77%, vor wenigen Tagen waren es gerade einmal 1,13%. Die Zinsstrukturkurve hat sich im Zuge dieser Entwicklung deutlich abgeflacht, was nichts Gutes für die Wirtschaft des Landes und damit auch die globale Konjunktur bedeutet.
Die Entwicklung ist umso rätselhafter, weil seit Monaten Covid-19-Impfprogramme laufen, die Fallzahlen in vielen Industrieländern deutlich gesunken sind, die enormen geld- und fiskalpolitischen Stimuli weiterhin Bestand haben und auch am Arbeitsmarkt im Trend spürbare Fortschritte zu verzeichnen sind. Kurzum: Die Normalisierung der Wirtschaft ist schon weit vorangeschritten, einige Länder haben bereits wieder das Vorkrisenniveau erreicht.
Das Anleihekaufprogramm des Fed hat den Markt verengt
Zudem würde auch die mehrheitliche Erwartung der Marktbeobachter, dass die US-Notenbank Fed zum Jahreswechsel damit beginnen wird, die geldpolitischen Zügel zu straffen, eher für steigende Zinsen sprechen. Zweifeln die Bondanleger, die als besonders versierte Investoren gelten, an alldem, wie es die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen vermuten lässt?
Lisa Shalett, Anlagechefin Wealth Management bei Morgan Stanley, ist dezidiert anderer Ansicht. Sie weist auf mehrere technische Faktoren hin, die nach ihrer Ansicht den Markt für amerikanische Staatsanleihen jüngst verzerrt und für die überraschend niedrigen Langfristzinsen gesorgt haben.
Dazu zähle erstens das unverändert umfangreiche Anleihekaufprogramm durch die US-Notenbank. Das Fed besitze inzwischen fast ein Viertel der ausstehenden Treasuries im Vergleich zu rund 15% vor der Pandemie. Die monatlichen Käufe in Höhe von unverändert 120 Mrd. $ übten einen Druck auf die langfristigen Renditen aus.
Renditedifferenz hat ausländische Anleger angelockt
Diese hohe Nachfrage treffe zweitens auf ein sinkendes Angebot. Dank sinkenden Staatsausgaben und steigenden Steuereinnahmen habe sich die Emission neuer Staatsanleihen verlangsamt, was zusätzlich auf die Renditen drücke. Drittens seien ausländische Investoren in der jüngeren Vergangenheit vermehrt auf den Geschmack von US-Staatspapieren gekommen, weil sie im Vergleich zu jenen aus anderen Ländern höhere Renditen böten.
Und viertens hätten etliche Pensionskassen in den USA angesichts der starken Performance etlicher Anlageklassen ihre Portfolios defensiver ausgerichtet und Gelder in Staatsanleihen umgeschichtet. Die Deutsche Bank liefert schliesslich ein fünftes Argument. Gemäss ihren Beobachtungen haben einige Investoren mit grossen Positionen auf steigende US-Renditen gesetzt. Da genau das Gegenteil eingetreten ist, müssten sie ihre Wetten schliessen, indem sie Anleihen kaufen. Dieser Prozess könne noch eine Weile anhalten.
Steigende Zinsen bedeuten Gegenwind für Wachstumstitel
Aktienanleger sollten nun jedoch nicht überschwänglich werden. Sie sind zwar den möglicherweise irreführenden Warnzeichen nicht auf den Leim gegangen, was sich daran ablesen lässt, dass die Börsen weiterhin nahe ihren Rekordhochs notieren. Shalett warnt jedoch vor den jüngst stark gestiegenen Bewertungen bei Technologiewerten – solche Wachstumstitel sind in Tiefzinsphasen besonders gesucht.
Ähnlich wie die Experten der Deutschen Bank rechnet die Anlagestrategin von Morgan Stanley auf mittlere Sicht wieder mit spürbar anziehenden US-Zinsen. Im dritten Quartal werde die Rendite der zehnjährigen Treasuries auf 1,75% steigen, vermutet sie. Für Technologiewerte könne das einigen Gegenwind bedeuten. Stattdessen sollten Anleger auf Werte aus dem Finanzsektor setzen, die von steigenden Zinsen profitieren.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/finanzen/aktien/sinkende-us-zinsen-doch-kein-vorbote-einer-schwachen-konjunktur-ld.1636990
CHINA – AKTIEN: Tech-Firmen bekommen Prügel: Warum Peking ein Börsenbeben auslöst – n-tv, 30.7.2021
Viele chinesische Technologiefirmen haben derzeit ein Problem: Sie sind ins Visier der Staats- und Parteiführung geraten. Die Aktienkurse einstiger Vorzeige-Konzerne stürzen in die Tiefe.
Chinas Regierung hat für ein Börsenbeben gesorgt. Die Aktienkurse zahlreicher Unternehmen rauschen seit einigen Tagen in den Keller, vor allem Tech-Konzerne leiden. Der Nasdaq China Golden Dragon, in dem die US-Aktien chinesischer Firmen versammelt sind, steuert auf den heftigsten Monatsverlust seit der Finanzkrise zu – das aktuelle Juli-Minus beträgt 22,5 Prozent.
Damit haben sich Milliarden Dollar Börsenwert in Luft aufgelöst. Der Grund: Peking hat massive Regulierungsmaßnahmen eingeleitet gegen Technologie-Unternehmen. Zunächst sind das Firmen, die große Datenmengen besitzen. Im Visier sind auch Unternehmen, die an US-Börsen gelistet sind. Außerdem steht der Bildungssektor im Fokus. Aber auch andere Branchen sind betroffen.
Die Regulierungswelle sorgt auch für starke Verluste an den Börsen in Shanghai und in Hongkong. In Shanghai verlor der CSI-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, im Juli rund 8 Prozent und erlitt damit stärkere Verluste als beim Corona-Schock im Februar vergangenen Jahres.
Zum ersten Mal sichtbar wurde Pekings neuer Kurs beim Börsengang von Didi Chuxing. Der erfolgreiche Fahrdienstleister, der Uber aus der Volksrepublik verdrängt hatte, war Ende Juni in den USA an die Börse gegangen – und das, obwohl Chinas Cyberspace-Aufsicht vorher dringend davon abgeraten hatte. Kurz nach dem triumphalen Börsendebüt mit satten Kursgewinnen wurde App-Stores in China verboten, die Didi-App in China weiterhin zum Download anzubieten. Der Aktienkurs brach ein. Doch das war erst der Anfang. Didi muss sich auf eine harte Strafe einstellen.
*** Schlechtes Image ***
Es sieht zwar ganz danach aus, dass Peking an Didi ein Exempel statuiert. Denn Gründer Cheng Wei hat mit dem Börsengang die Staats- und Parteiführung herausgefordert. Doch das ist nicht der einzige Grund: Peking will heimische Tech-Firmen von ausländischen Börsen fernhalten. Die Regierung fürchtet, dass sie von den dortigen Behörden gezwungen werden könnten, ihren riesigen Datenschatz zur Verfügung zu stellen – und den Zugriff wollen Chinas Behörden exklusiv.
Die ersten chinesischen Tech-Firmen haben ihre US-Börsenpläne nun auf Eis gelegt, darunter die Tiktok-Mutter Bytedance und der Medizin-Datendienstleister LinkDoc. Derweil kommen auch die Kurse von in den USA gelisteten Firmen wie etwa dem Online-Giganten Alibaba, dem Suchmaschinen-Betreiber Baidu, und dem Social-Media-Riesen Tencent unter die Räder. Zur Einordnung: Tencent ist an der Börse derzeit etwa 546 Milliarden Dollar wert. Das bedeutet, dass die We-Chat-Mutter seit dem Höchststand Mitte Februar etwa 396 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren hat.
Das illustriert eindrucksvoll, welche Folgen Pekings Kehrtwende an den Börsen hat. Hatte die Führung Internet-Konzerne lange als Treiber von Innovation und als Symbol der wachsenden wirtschaftlichen Potenz Chinas gesehen, ist das nun anders. Die Branche wird nun eher als Sicherheitsrisiko und als Ursache von sozialen Problemen gesehen. In der Volksrepublik hat das eine immense Bedeutung. Denn politische und gesellschaftliche Stabilität hat für die Kommunistische Partei die allerhöchste Priorität.
Das erklärt auch das Vorgehen gegen Firmen, die im Bildungsbereich aktiv sind. Am vergangenen Wochenende hatte die chinesische Regierung eine Reform des privaten Bildungssektors angekündigt. Unternehmen, die Nachhilfe-Programme anbieten, dürfen künftig keine Gewinne erzielen oder an die Börse gehen. Peking versucht damit, die immensen Bildungskosten für Familien in den Griff zu bekommen.
In China gibt es für Schüler eine harte Abschlussprüfung, die „Gaokao“. Diese „Große Prüfung“ entscheidet maßgeblich über das zukünftige Leben der Schulabgänger – und setzt sie deshalb unter immensen Druck. Wer eine hohe Punktzahl holt, kann sich für die besten Hochschulen in China bewerben. Wer schlecht abschneidet, dem bleibt in der Regel bloß der Gang zu Mittelklasse-Hochschulen, was später oft Auswirkungen auf Job-Angebote hat. Eltern bringen viel Geld auf, um ihren Kindern zu möglichst guten Schulnoten zu verhelfen. Die privaten Institute richten ihre Angebote nicht nur an schwächere Schüler, die in ihrer Klasse nicht mitkommen. Auch für die Besten eines Jahrgangs ist es völlig normal, am Wochenende privaten Unterricht zu buchen, um so noch besser abschneiden zu können als ohnehin schon. Dies hat eine florierende Industrie von Nachhilfeschulen geschaffen.
Für die Unternehmen ist die Ankündigung Pekings ein schwerer Schlag. Sollten sie tatsächlich wie angekündigt künftig in gemeinnützige Unternehmen verwandelt werden, inklusive Verbot von Wochenend-Unterricht, ist ihr Geschäftsmodell am Ende. Die Folge: An den Börsen geht es auch für sie in den Keller.
Ein weiteres Beispiel für Pekings Regulierungs-Rundumschlag ist Meituan. Auch für die Aktien des Liefergiganten geht es steil abwärts. Zuvor waren neue Vorschriften veröffentlicht worden, die die Rechte der Essensausfahrer stärken – beispielsweise werden Mindestlöhne in der Branche eingeführt. Bisher hat Meituan die Fahrer etwa mit drastischer Verdienstkürzung bestraft, wenn sie nicht schnell genug beim Kunden waren, auch wenn sie wegen dichten Verkehrs nichts für die Verspätung konnten. Die Arbeitsbedingungen stehen landesweit in der Kritik, nachdem das Staatsfernsehen einen Beitrag über einen Beamten der Pekinger Stadtverwaltung ausgestrahlt hatte, der undercover einen harten Tag lang als Essenslieferant für Meituan unterwegs war und mit umgerechnet fünf Euro Lohn nach Hause ging. (ntv.de, mit rts/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Warum-Peking-ein-Boersenbeben-ausloest-article22714494.html
SIEHE DAZU:
=> Plötzlich unauffindbar Wieso verschwinden in China Milliardäre? – n-tv, 23.1.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wieso-verschwinden-in-China-Milliardaere–article22308386.html
EUROPA – AKTIEN: Alexander Trentin: Hat Europa die falschen Aktien? – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 30.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/cdt-30-jul-640×417.jpg
Über die vergangenen Jahre konnte man mit amerikanischen Aktien mehr Performance einstreichen als mit europäischen. Und das, obwohl die europäischen Titel angesichts fallender Bewertungskennzahlen immer günstiger wurden. Woran lag das?
Ein Grund: die Sektorzusammensetzung. Immerhin war in den USA das spektakuläre Wachstum der grossen Tech-Riesen ein wichtiger Teil der Gesamtperformance. Hat der europäische Aktienmarkt also einfach die falschen Titel? Zu wenig Technologie- und Qualitätsaktien, zu wenig Innovation und zu viel «Old Economy» sind die häufigen Vorwürfe.
Solch eine Kritik hat einiges für sich, meinen die Analysten der UBS. Aber sie weisen auch daraufhin, dass es signifikante Veränderungen in der Zusammensetzung des europäischen Aktienmarkts gibt – und die Covid-19-Pandemie hat diese Trends noch beschleunigt. Ein wichtiger Umbruch zeigt die obige Grafik: Seit vergangenem Jahr hat der Technologiesektor den Anteil der Banken überholt.
Statt den Finanzinstituten sind nun die Sektoren Pharma (12% nach Börsenkapitalisierung) und Kapitalgüter (11%) am stärksten vertreten. Die Banken machen nur noch 7% aus. Vor fünfzehn Jahren machten Energie- und Bankaktien noch ein Drittel des Markts aus. Auch der Energiesektor ist zusammengebrochen, und die zwei Sektoren stellen zusammen gerade einmal etwas mehr als ein Zehntel des Gesamtbörsenwerts Europas.
Und auch andere Sektoren holen auf: Der Luxusgütersektor hat das stärkste Wachstum aller Sektoren hingelegt. Seit der Finanzkrise hat sich der Börsenwert dieser Unternehmen verfünffacht – auf fast 6% und damit fast so viel wie der Bankensektor.
Die Anleger müssen ihre Vorbehalte gegenüber europäischen Aktien demnach überdenken. Denn die Gewichtsveränderungen «lassen vermuten, dass Europa nicht mehr so stark von den wichtigsten Treibern der vergangenen Performance abhängig ist».
Diese immer noch wichtigen, aber weniger dominierenden Treiber sind gemäss UBS die Performance der Value-Aktien, Dividendenrenditen und der Ölpreis. Für die Aktienkurse seien die Faktoren Momentum der Unternehmensgewinne und die Einkaufsmanagerindizes (PMI) als Frühindikatoren der Konjunktur gleich wichtig geworden. (Quelle der Grafik: UBS)
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2108/
EUROPA – MSCI: Frank Heiniger: Verkehrte Welt: an Stelle forlaufender Gewinnkorrekturen nach unten heuer stetig bessere Gewinnprognosen – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 27.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/cotd-640×424.png
Die Coronapandemie hat gängige Muster am Aktienmarkt kräftig durcheinandergewirbelt. Das illustriert der obige Chart von Morgan Stanley, der sowohl die aktuelle als auch die historische Entwicklung der Gewinnschätzungen im MSCI Europe nachzeichnet.
In der Vergangenheit sah das Bild zumeist so aus: Die Analysten publizierten im Vorfeld äusserst zuversichtliche Gewinnprognosen, die im Jahresverlauf stetig nach unten korrigiert werden mussten (hellblaue und graue Linie).
Nicht so im laufenden Jahr. Dank der stetigen Konjunkturerholung und einer Verbesserung der Rahmenbedingungen konnten die Erwartungen für 2021 kontinuierlich nach oben revidiert werden. Inzwischen liegt die Gewinnschätzung für das Gesamtjahr beinahe 15% höher als im vergangenen Dezember (dunkelblaue Linie).
Laut den Analysten von Morgan Stanley sind es dabei nicht nur zyklische, also konjunktursensitive Unternehmen, die von Aufstufungen profitieren, sondern auch defensive Gesellschaften. Einzig die Gewinnprognosen der europäischen Kommunikationsdienstleister mussten jüngst tendenziell gestutzt werden. (Quelle der Grafik: Morgan Stanley)
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2105/
DEUTSCHLAND – FONDS (28.7.2021): Steigende Börsenkurse und ein solides Neugeschäft haben das verwaltete Vermögen der europäischen Fondsbranche in immer höhere Sphären gehoben: Insgesamt steuert Europas Fondsbranche per Ende Mai ein Volumen von 20,0 Billionen Euro in Publikumsfonds (Ucits) und alternativen Investmentfonds (AIF), wie Europas Branchenverband Efama berichtet. (Börsen-Zeitung)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53522290-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
ZENTRALBANKEN
– EUROPÄISCHE UNION / EZB
Hans Bentzien: EZB: Unternehmenskredite wachsen im Juni mit konstantem Tempo – DJN, 27.7.2021
Das Wachstum der Kreditvergabe im Euroraum hat sich im Juni nicht weiter verlangsamt. Die Jahreswachstumsrate der Buchkreditvergabe an Nicht-Finanz-Unternehmen lag nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wie im Mai bei 1,9. Prozent. Im April waren es noch 3,2 Prozent gewesen, im März 5,3 und im Februar 7,0 Prozent. Ursache war der pandemiebedingte Anstieg der Unternehmenskreditvergabe im Frühjahr des Vorjahres. Im Berichtsmonat stieg die Unternehmenskreditvergabe gegenüber dem Vormonat um 11 Milliarden Euro, nachdem sie in den beiden Vormonaten um 12 und 27 Milliarden gesunken war.
Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 4,0 (Mai: 3,9) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 5,6 (5,4) Prozent zunahmen. Die Konsumentenkredite wuchsen mit einer Jahresrate von 0,4 (0,6) Prozent.
Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 6,2 (6,7) Prozent, wobei das Wachstum der Kreditvergabe an Private 3,0 (2,7) Prozent betrug. Die an den Staat vergebenen Kredite wuchsen mit einer Jahresrate von 13,0 (15,4) Prozent.
Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Juni mit einer Jahresrate von 8,3 (8,4) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Rate von 8,2 Prozent gerechnet. Die Dreimonatsrate betrug 8,7 Prozent. Das Wachstum der engeren Geldmenge M1 erhöhte sich auf 11,7 (11,6) Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53512799-ezb-unternehmenskredite-wachsen-im-juni-mit-konstantem-tempo-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Panetta: Überhitzung der Wirtschaft notwendig – DJN, 29.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach den Worten von EZB-Direktor Fabio Panetta eine Überhitzung der Wirtschaft zulassen, um ihrem Ziel von 2 Prozent Inflation Glaubwürdigkeit zu verleihen. In einem Interview mit dem Corriere dela Sera zeigte Panetta außerdem Sympathie für eine dauerhafte Aufhebung der europäischen Haushaltsregeln.
„In der Vergangenheit hat die Ungeduld der EZB dazu geführt, dass sie die Zinssätze zu früh angehoben hat, was die Inflation übermäßig unter Druck gesetzt und das Wachstum gehemmt hat“, sagte Panetta. Es sei also jedem klar, dass es zur Gewährleistung der Preisstabilität notwendig sein könne, die Wirtschaft heiß laufen zu lassen. „Es ist eine Möglichkeit, unsere Bemühungen um eine Inflationsrate von 2 Prozent glaubwürdig zu machen.“
Zu den coronabedingt bis 2022 suspendierten EU-Haushaltsregeln sagte der Italiener: „Sollten wir das 2020 eingeführte Krisenmanagementsystem dauerhaft einführen? Ich denke, das wäre ein wichtiger Schritt nach vorn, aber nicht jeder ist damit einverstanden und die unterschiedlichen Standpunkte sind verständlich.“
Panetta widersprach zudem der Wahrnehmung, dass sich die EZB wegen ihrer Kooperation mit der Finanzpolitik einer „fiskalischen Dominanz“ beuge. „Wenn es notwendig ist, fiskalische Maßnahmen zu ergreifen, um die Preisstabilität zu sichern, und wenn die Geldpolitik dafür sorgt, dass die Fiskalpolitik entsprechend agieren kann, dann führt dies nicht zu einer fiskalischen Dominanz“, sagte Panetta und fügte hinzu: „Im Gegenteil, dies wäre eine monetäre Dominanz, da die Zentralbank die Fiskalpolitik nutzen würde, um ihr Inflationsziel zu erreichen.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53539584-ezb-panetta-ueberhitzung-der-wirtschaft-notwendig-015.htm
EZB/De Guindos: Europas Banken sind robust – Keine Anzeichen, dass aus vorübergehender eine strukturelle Inflation wird – Inflationshöhepunkt für November mit 3 Prozent erwartet – Warnung vor „Klippeneffek“ bei Auslaufen des Anleihekaufprogramms PEPP 2022 – DJN, 30.7.2021
„Europas Banken sind robust, sie sind widerstandsfähig.“ Diesen Ausblick gab der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, auf die Ergebnisse der europäischen Banken-Stresstests, die am Abend veröffentlicht werden. „Die Details veröffentlichen wir ja erst am Freitagabend, aber so viel kann ich schon jetzt sagen.“ Dem Handelsblatt sagte er, „unser ungünstigstes Szenario ist diesmal noch anspruchsvoller als beim letzten Test 2018, und die Banken haben ja zudem gerade das schwierige Jahr 2020 verkraftet.“ Er erwarte, dass sich die Banken im Test im Großen und Ganzen gut geschlagen haben.
Die EBA hat 50 Geldhäuser aus 15 europäischen Ländern unter die Lupe genommen. Parallel dazu hat die EZB weitere 51 Banken aus dem Euroraum untersucht, die sie direkt beaufsichtigt.
Die Aufseher ließen die Banken auf Basis ihrer Bilanz des Corona-Krisenjahres 2020 durchrechnen, wie stark die Kapitalpuffer bis Ende 2023 schrumpfen würden, wenn Pandemie und Wirtschaftsflaute sich zuspitzen würden. Zusätzlich wurde in den Stresstests ein Bündel ungünstiger Entwicklungen angenommen: steigende Arbeitslosenquote, Einbruch der Immobilienpreise, stark sinkende Auslandsnachfrage, weiter fallenden Marktzinsen.
Mit solchen Stresstests überprüfen Aufseher weltweit regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Einzelnen Instituten können sie auf Basis der Ergebnisse auftragen, Kapitalpuffer zu stärken. Die Spannbreite der Ergebnisse im aktuellen Test „dürfte nicht größer als beim letzten Mal sein“, sagte de Guindos. „Aber natürlich müssen wir die Banken, die klar unterdurchschnittlich abschneiden, besonders sorgfältig beobachten.“
*** Keine strukturelle Inflation, Höhepunkt der vorübergehenden Inflation im November ***
Mit Blick auf die derzeit anziehenden Preissteigerungsraten in der Eurozone sieht de Guindos bislang „keine Anzeichen“, dass aus einer vorübergehenden eine strukturelle Inflation wird. Die Notenbank müsse aber wachsam bleiben und mögliche Zweitrundeneffekte, etwa Lohnerhöhungen beobachten. „Für den Euro-Raum erwarten wir den Höhepunkt im November mit etwa 3 Prozent“, sagte er mit Blick auf die Inflationslage. „Im kommenden Jahr wird das Tempo wieder abnehmen, weil dann einige Sondereffekte, etwa die vorübergehende Senkung der deutschen Mehrwertsteuer im Jahr 2020, nicht mehr in die Rechnung eingehen.“
*** Weitere Unterstützung der Wirtschaft nötig, Warnung vor „Klippeneffekt bei Auslaufen des PEPP ***
De Guindos geht davon aus, dass die Wirtschaft der Eurozone noch auf absehbare Zeit Unterstützung braucht. Wenn das Anleihekaufprogramm PEPP der EZB, das für den Notfall der Pandemie geschaffen wurde, im kommenden Jahr ausläuft, dürfe es keinen „Klippeneffekt“ geben, warnt der EZB-Vizepräsident.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53549054-ezb-de-guindos-europas-banken-sind-robust-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53550823-ezb-vize-europas-banken-auch-unter-stress-robust-016.htm
Hans Bentzien u.a.: Eba: EU-Banken haben in Stress-Szenario über 10% Eigenkapital – CET1-Eigenkapitalquote der Banken sinkt im Test bis 2023 um 485 Basispunkte auf 10,2 (2020: 15,0) Prozent – Starke Unterschiede zwischen den Bankinstituten: größtes Kreditverlustrisiko bei Banken in Frankreich, Italien und Deutschland – Risikomix aus Kreditverlusten, Marktverlusten und Fehloperationen – Bei auslaufenden Zahlungsmoratorien steigt Anteil wertgeminderter Kredite – DJN/dpa-AFX, 30.7.2021
Die Großbanken in der EU würden nach Aussage des Bankenregulierers Eba auch unter extremen ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch über ausreichend Eigenkapital verfügen, um weitere Verluste zu decken – jedenfalls im Durchschnitt der 50 untersuchten Institute. Wie die Eba nach Abschluss ihres aktuellen Stresstests mitteilte, würde die an den Risikoaktiva gemessene harte CET1-Eigenkapitalquote der Banken bis 2023 um 485 Basispunkte auf 10,2 (2020: 15,0) Prozent sinken und die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) um 130 Basispunkte auf 4,3 (5,6) Prozent. Im Stresstest 2018 hatte sich die CET1-Quote um 395 Basispunkte verringert.
Allerdings gibt es starke Unterschiede zwischen den Instituten, die Eigenkapitalverluste reichen von 80 bis 996 Basispunkten. „Banken mit starkem Inlandsgeschäft oder mit geringen Nettozinseinnahmen verlieren mehr Eigenkapital“, erläuterte die Eba. Regional gesehen drohen den Banken die größten Kreditverluste bei Engagements in Frankreich, Italien und Deutschland.
Das Szenario sieht wegen des aktuell von der Corona-Pandemie geprägten Umfelds anhaltend niedrige Zinsen vor, die die stützende Wirkung der Nettozinseinnahmen der Institute gegenüber dem 2018 durchgeführten Stresstest um 100 Basispunkte auf 2,9 Prozentpunkte senken. Am stärksten belastet wird das Eigenkapital durch Kreditverluste (423 Basispunkte), Verluste aus Marktrisiken (102 Basispunkte) und operationelle Risiken (68 Basispunkte.
Das Szenario sieht für die Jahre 2021 bis 2023 außerdem einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,6 Prozent vor. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass das Basisjahr 2020 von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geprägt war.
Die Eba geht in ihrem Szenario davon aus, dass die mit ihren Richtlinien übereinstimmenden Zahlungsmoratorien ausgelaufen, staatliche Kreditgarantien aber noch in Kraft sind. Auf dieser Basis ergibt sich, dass der Anteil wertgeminderter Kredite (Stage 3) von Banken mit einer hohen Exponierung gegenüber corona-sensitiven Sektoren auf 9,1 (2020: 2,8) Prozent steigt. Für den Durchschnitt aller Banken prognostiziert die Eba im Stress-Szenario einen Anstieg auf 6,3 (2,1) Prozent.
Der Anteil wertgeminderter Kredite bei früher Zahlungsmoratorien unterliegenden Krediten steigt laut Eba auf 13,4 (3,1) Prozent, die entsprechende Quote bei Krediten mit Staatsgarantie auf nur 6,8 (1,1) Prozent.
Unter den 50 Banken in dem von der europäischen Bankenaufsicht EBA koordinierten Test waren 38 Institute aus dem Euroraum, die unter EZB-Aufsicht fallen. Die EZB-Bankenaufsicht nahm weitere 51 Geldhäuser aus dem Euroraum unter die Lupe, die unter ihre Aufsicht fallen. Die EZB überwacht seit November 2014 die größten Banken und Bankengruppen im Euroraum, derzeit sind dies 114 Institute, die für fast 82 Prozent des Marktes im Währungsraum der 19 Länder stehen.
QUELLEN
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53557851-eba-eu-banken-haben-in-stress-szenario-ueber-10-eigenkapital-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53558410-ezb-bescheinigt-euroraum-banken-nach-stresstest-widerstandsfaehigkeit-016.htm
Hans Bentzien: EZB/Panetta will mehr Freiheiten für europäische Finanzpolitik – Gefordert: weniger Defizit- und Schuldenregelungen – Wiederaufbaufonds Next Generation (NGEU) als „Europäischer Sozialvertrag“ und Dauermodell – ESM mit neuer Nutzung – Bessere Optionen für antizyklische Finanzpolitik – DJN, 27.7.2021
Die Länder des Euroraums sollten ihre Finanzkraft nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta effizienter einsetzen und dabei weniger durch Defizit- und Schuldenregeln behindert werden. In einem auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Beitrag lobt Panetta den in der Pandemie geschaffenen Wiederaufbaufonds NGEU (Next Generation EU) als „Europäischen Sozialvertrag“, schlägt eine neue Nutzung der finanziellen Kapazitäten des Euro-Rettungsfonds ESM vor und fordert bessere Möglichkeiten für die Mitglieder, eine antizyklische Finanzpolitik zu betreiben. Folge drei Punkte hebt Panetta hervor:
- NGEU könnte bei Erfolg Dauermodell werden
Der über eine gemeinsame Schuldenaufnahme finanzierte Wiederaufbaufonds verkörpert laut Panetta einen neuen „Europäischen Sozialvertrag“. Die Länder müssten über ehrgeizige und gut umgesetzte Ausgabenpläne dafür sorgen, dass dieser NGEU ein Erfolg wird. Die mit europäischem Geld finanzierten Pläne müssten mit den EU-Prioritäten übereinstimmen und dazu beitragen, die wirtschaftlichen und institutionellen Schwächen der Länder zu beheben. „Bei erfolgreicher Umsetzung wird NGEU dazu beitragen, dieses neue Modell und die Verwendung von EU-Anleihen zu legitimieren, sollte eine zukünftige Krise erneut die nationale Politik zu überfordern drohen“, schreibt Panetta. - SURE- und ESM-Mittel umnutzen
Panetta schlägt vor, die eigentlich für andere, „rückwärtsgewandte“ Zwecke gedachten Finanzmittel des SURE-Programms und des Rettungsfonds ESM für zukunftsorientierte Aufgaben einzusetzen. „Diese Instrumente könnten erweitert und angepasst werden, um verschiedene politische Ziele in der Erholungsphase zu unterstützen – in erster Linie die Förderung des Humankapitals durch Maßnahmen wie Ausbildung am Arbeitsplatz und aktive Arbeitsmarktpolitik“, schreibt Panetta. Dies würde wiederum das Beschäftigungswachstum ankurbeln, wenn der Aufschwung an Fahrt gewinne. - Fiskalregeln reformieren
Panetta weist darauf hin, dass „ein Großteil der fiskalischen Feuerkraft Europas“ in der nationalen Politik verankert bleibe. „Daher ist eine Reform der Regeln (Obergrenzen für Haushaltsdefizite und Gesamtverschuldung) für diese Politik unerlässlich.“ Dabei muss laut Panetta berücksichtigt werden, dass diese Regeln über die Erwartungen der Akteure die Nachfrage direkt beeinflussten. Sie müssten daher antizyklisch sein.
„Eine gezielte Reform sollte sowohl eine konjunkturelle Komponente haben, die sicherstellt, dass die Fiskalpolitik auf kurzfristige Marktschwankungen reagiert und einen starken Aufschwung ermöglicht, als auch eine strukturelle Komponente, die die Tragfähigkeit der Schulden über den Konjunkturzyklus hinweg stärkt“, argumentiert Panetta. Aktuell sind die europäischen Fiskalregeln wegen der Corona-Pandemie suspendiert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53513204-ezb-panetta-will-mehr-freiheiten-fuer-europaeische-finanzpolitik-015.htm
Hans Bentzien: Protokoll enthüllt keine Diskussionen im EZB-Rat über neue Strategie – Allerdings gab es Dissensen über den zukünftigen Weg der EZB im Vorfeld der Ratssitzung vom 21. und 22. Juli – DJN, 29.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ein Protokoll der Ratssitzung am 8. Juli 2021 veröffentlicht, in der die neue geldpolitische Strategie der Zentralbank beschlossen wurde. Im Unterschied zu den Protokollen der alle sechs Wochen stattfinden geldpolitischen Beratungen gibt dieses Dokument aber keinen Hinweis auf die Diskussionen, die in dem Gremium stattgefunden haben. Es fasst lediglich die am 8. Juli veröffentlichten Beschlüsse noch einmal zusammen. Aussagen von EZB-Ratsmitgliedern aus den Monaten vor dem Beschluss deuten aber darauf hin, dass es durchaus unterschiedliche Vorstellungen über eine anzustrebende neue Strategie gab.
Deren wichtigstes Element ist die Änderung des Inflationsziels von „nahe, aber unter 2 Prozent“ auf „2 Prozent“ sowie die Feststellung, dass die EZB an der nominalen Zinsuntergrenze unter Umständen besonders energisch oder ausdauernd agieren muss, um eine Verfestigung der Inflationserwartungen auf einem zu niedrigen Niveau zu verhindern. Dabei will sie auch ein zeitweiliges und moderates Überschießen der Inflation zulassen.
Über die operative Umsetzung dieser zu Monatsbeginn einstimmig beschlossenen Maxime herrschte bei der Ratssitzung am 21. und 22. Juli schon keine Einigkeit mehr. Das deutsche Ratsmitglied Jens Weidmann stimmte gegen die veränderte Zins-Guidance, die Zinserhöhungen in den nächsten Jahren eher noch unwahrscheinlicher machen.
Der italienische EZB-Direktor Fabio Panetta sprach sich dafür aus, die Wirtschaft des Euroraums heiß laufen zu lassen, um dem neuen Inflationsziel Glaubwürdigkeit zu verschaffen. „In der Vergangenheit hat die Ungeduld der EZB dazu geführt, dass sie die Zinssätze zu früh angehoben hat, was die Inflation übermäßig unter Druck gesetzt und das Wachstum gehemmt hat“, sagte er.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53541577-protokoll-enthuellt-keine-diskussionen-im-ezb-rat-ueber-neue-strategie-015.htm
– ÖSTERREICH / OeNB
OeNB unterstützt Vorarbeiten für einen digitalen Euro – OeNB, 27.07.2021
Die Notenbanken des Eurosystems führten im Frühjahr 2021 umfangreiche Voruntersuchungen für eine mögliche Etablierung eines digitalen Euro durch. Anhand von technischen Experimenten wurden wichtige Fragestellungen zu einem digitalen Euro untersucht, um mögliche Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.
Die Arbeiten wurden in Kooperation mit den Notenbanken des Eurosystems durchgeführt, die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) beteiligte sich mit einem technischen Team an zwei der vier Teilprojekte. Dabei wurden Lösungsansätze basierend auf vorhandener zentraler Zahlungsverkehrsinfrastruktur sowie mit neuen, dezentralen Technologien untersucht. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass es je nach Anforderung mehr als eine technische Möglichkeit gäbe, einen digitalen Euro umzusetzen.
Die Ergebnisse der Voruntersuchung fließen in das ESZB-Projekt „Digital Euro“ ein, das am 14. Juli 2021 vom EZB-Rat beschlossen wurde und in dessen Rahmen in den nächsten zwei Jahren die mögliche Ausgestaltung eines digitalen Euro näher analysiert werden soll. Keines der technischen Experimente aus der Voruntersuchung oder ihrer Ergebnisse stellt dabei aber eine Vorentscheidung für die Ausgestaltung eines künftigen digitalen Euro dar.
Nähere Informationen zum Digital Euro-Projekt finden sich auf der EZB-Website und im ECB Blog, die Ergebnisse der Voruntersuchung auf der Website der Banca d‘Italia sowie der Banque de France.
QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20210727.html
USA
US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet – DJN, 28.7.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 23. Juli 2021 deutlicher als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,089 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um nur 2,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,107 Millionen Barrel erhöht. Das private American Petroleum Institute (API) hatte am Vortag einen Rückgang um 4,7 Millionen Barrel gemeldet.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,253 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,0 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,121 Millionen gesunken waren. Die API-Daten hatten einen Rückgang von 6,2 Millionen Barrel angezeigt. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11,2 Millionen Barrel pro Tag um 0,2 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53530171-us-rohoellagerbestaende-sinken-staerker-als-erwartet-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände – DJN, 27.7.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 6,2 Millionen Barrel nach plus 3,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53520539-api-daten-zeigen-rueckgang-der-us-rohoellagerbestaende-015.htm
USA: Konsumklima Michigan trübt sich ein – Warnung vor Inflationsspirale – „Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein Inflationssturm aufziehen wird“ – dpa-AFX, 30.7.2021
Das Konsumklima in den USA hat sich im Juli eingetrübt, wenn auch nicht ganz so stark wie bisher gedacht. Der von der Universität Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung fiel im Monatsvergleich um 4,3 Punkte auf 81,2 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Erhebung mitteilte. Nach einer ersten Schätzung hatte sich die Stimmung etwas stärker eingetrübt.
Sowohl die aktuelle Lage als auch die künftige Entwicklung bewerteten die befragten Verbraucher ungünstiger. Die Konsumenten sorgten sich wegen steigender Preise für Eigenheime, Fahrzeuge und Haushaltsgüter, kommentierte der für die Umfrage zuständige Chefökonom Richard Curtin.
„Während die meisten Verbraucher immer noch von einem vorübergehenden Inflationsanstieg ausgehen, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein Inflationssturm aufziehen wird“, sagte Curtin und warnte vor einer Spirale aus steigenden Preisen und Löhnen. Die US-Notenbank sieht derartige Gefahren gegenwärtig nicht und will auf die deutlich erhöhte Inflation nicht reagieren.
Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen. Außerdem werden die Inflationserwartungen der Haushalte abgefragt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53556670-usa-konsumklima-michigan-truebt-sich-ein-warnung-vor-inflationsspirale-016.htm
Chicagoer Einkaufsmanagerindex überraschend auf auf 73,4 Punkte und liegt somit knapp unter jüngstem Höchststand im Mai 2021 – DJN, 30.7.2021
Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Juli spürbar aufgehellt. Der Indikator stieg auf 73,4 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Juni stand der Index bei 66,1 Punkten. Volkswirte hatten einen leichten Rückgang auf 64,1 Punkte erwartet.
Der Frühindikator liegt damit weiter über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.
Unter den Subindizes verzeichnete der für die Produktion mit einem Plus von 8,8 Punkten den größten Anstieg, da die Nachfrage hoch blieb und einige Unternehmen von Problemen in der Lieferkette profitierten. Jener für die Auftragseingänge stieg um 5,4 Punkte, was auf eine starke Nachfrage hindeutet, während der Wert für die Auftragsbestände nur um 3,4 Punkte zulegte. Die Unternehmen verwiesen auf einen Mangel an Rohstoffen und Personal, was zu einem erhöhten Arbeitsrückstand geführt habe, so MNI Indicators, die die Daten zusammenstellen.
Der Indikator notiert damit nur geringfügig unter seinen jüngsten Hochständen. Im Mai hatte der Indikator mit 75,2 Punkten den höchsten Stand seit Ende 1973 erreicht. Werte über der Marke von 50 Punkten signalisieren wirtschaftliches Wachstum, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin.
Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53556785-chicagoer-einkaufsmanagerindex-steigt-im-juli-deutlich-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53556392-usa-chicago-indikator-hellt-sich-ueberraschend-auf-016.htm
US-Wirtschaft wächst im 2Q schwächer als erwartet – DJN, 29.7.2021
Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal entgegen den Erwartungen kaum verstärkt. Nach Mitteilung des Bureau of Economic Analyses (BEA) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um annualisiert 6,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 8,4 Prozent Wachstum prognostiziert. Die vorläufig für das erste Quartal gemeldete Wachstumsrate von 6,4 Prozent wurde auf 6,3 Prozent revidiert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53542114-us-wirtschaft-waechst-im-2q-schwaecher-als-erwartet-015.htm
Stimmung der US-Verbraucher im Juli laut Michigan University eingetrübt – Einschätzung der aktuellen Lage gleichfalls, aber gering gesunken – DJN, 30.7.2021
Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 81,2 von 88,6 Ende Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 80,8 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 80,8.
Der Index für die Erwartungen belief sich auf 79,0 (Vormonat: 83,5, vorläufig: 78,4), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 84,5 (85,5 bzw 84.5) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,7 von 4,2 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren blieben sie konstant bei 2,8 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53556700-stimmung-der-us-verbraucher-im-juli-eingetruebt-015.htm
SIEHE DAZU:
=> http://www.sca.isr.umich.edu/
Xavier Fontdegloria u.a.: Stimmung der US-Verbraucher laut Conference Board im Juli unerwartet verbessert – DJN/dpa-AFX, 27.7.2021
Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Juli entgegen den Erwartungen aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 129,1. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf 124,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 128,9 von zunächst 127,3 revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 160,3 (Vormonat: 159,6), jener für die Erwartungen fiel auf 108,4 (108,5).
„Der Privatkonsum dürfte das Wirtschaftswachstum weiterhin stützen“, erklärte die Herausgeberin der Umfrage, Lynn Franco. Getrübt werde die Stimmung nur durch die hohe Inflation. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.
Einen höheren Stand hatte der Indikator zuletzt im Februar 2020, kurz bevor die Corona-Pandemie die USA heimsuchte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 123,9 Punkte gerechnet.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53517716-stimmung-der-us-verbraucher-im-juli-unerwartet-verbessert-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53517554-usa-verbraucherstimmung-hellt-sich-leicht-auf-016.htm
Konsum der US-Haushalte im Juni mit 1 Prozent im Plus etwas höher als erwartet, Einkommen sanken hingegen – DJN, 30.7.2021
Die US-Konsumausgaben sind im Juni stärker als erwartet gestiegen, während die Einkommen entgegen den Erwartungen nicht sanken. Laut Mitteilung des Bureau of Economic Analyses (Bea) erhöhten sich die Ausgaben gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, während die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet hatten. Im Mai waren die Ausgaben nach revidierten Angaben um 0,1 Prozent gesunken, vorläufig war eine Stagnation gemeldet worden.
Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg von 0,1 Prozent. Volkswirte hatten ein Minus von 0,2 Prozent erwartet. Das für Mai zunächst gemeldete Minus von 2,0 Prozent wurde auf 2,2 Prozent revidiert.
Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 4,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Fed verfolgt ein flexibles Inflationsziel: Die Preissteigerung darf für eine Weile höher als 2 Prozent liegen, wenn sie sich zuvor für einen längeren Zeitraum darunter bewegt hat. Ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 0,4 Prozent auf Monats- und 3,5 Prozent auf Jahressicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53555893-konsum-der-us-haushalte-im-juni-etwas-hoeher-als-erwartet-015.htm
US-Auftragseingang für langlebige Güter schwächer gestiegen als erwartet – DJN/dpa-AFX, 27.7.2021
Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juni schwächer als erwartet gewesen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, stiegen die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Der vorläufig für Mai gemeldete Anstieg von 2,3 Prozent wurde allerdings auf 3,2 Prozent revidiert.
Der Auftragseingang ohne den Transportbereich nahm um 0,3 Prozent zu und der ohne den Rüstungssektor um 1,0 Prozent.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,5 Prozent.
In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.
Bei den langlebigen Gütern handelt es sich im industrielle Waren wie Maschinen. Ohne den Transportsektor, zu dem etwa Flugzeuge zählen, erhöhten sich die Aufträge im Juni um 0,3 Prozent. Auch hier war mit 0,8 Prozent ein höherer Anstieg erwartet worden.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53516452-us-auftragseingang-fuer-langlebige-gueter-schwaecher-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53516271-usa-auftraege-fuer-langlebige-gueter-steigen-weniger-als-erwartet-016.htm
USA: Stärkster Anstieg der Immobilienpreise seit 2004 – Case-Shiller-Index – dpa-AFX, 27.7.2021
Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im Mai weiter beschleunigt. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise zum Vorjahresmonat um 17,0 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Dies ist der stärkste Zuwachs seit dem Sommer 2004.
Analysten hatten im Schnitt mit einer Beschleunigung des Preisanstiegs gerechnet. Sie waren aber nur von einem Zuwachs um 16,3 Prozent ausgegangen. Im Vormonat hatte die Rate 15,0 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Hauspreise im Mai um 1,8 Prozent.
Der US-Häusermarkt zeigt sich weiter robust in der Corona-Krise. Die extrem niedrigen Zinsen, eine sicherheitsbedingte Nachfrage nach Immobilien und der steigende Bedarf an Wohnraum treiben die Preise. Immer mehr Menschen zieht es aus den Metropolen in die Vorstadt- und Peripheriegebiete, weil in der Corona-Krise viele zu Hause arbeiten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53516673-usa-staerkster-anstieg-der-immobilienpreise-seit-2004-case-shiller-index-016.htm
USA: Häuserpreise steigen etwas stärker als erwartet – FHFA – dpa-AFX, 27.7.2021
In den USA sind die Häuserpreise etwas stärker als erwartet gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte im Mai im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 1,6 Prozent erwartet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat legten die Hauspreise um 18,0 Prozent zu. Dies ist ein Rekordanstieg im Jahresvergleich.
„Die Hauspreise setzten ihr rekordhohes Wachstum im Mai fort“, sagte Lynn Fisher, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Forschung und Statistik der FHFA. „Dieser Trend wird sich wahrscheinlich im ganzen Land fortsetzen, da die aktiven Sommermonate für den Hauskauf den Druck auf die bereits angespannten Wohnungsmärkte aufrechterhalten.“
Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53516828-usa-haeuserpreise-steigen-etwas-staerker-als-erwartet-fhfa-016.htm
USA: Schwebende Hausverkäufe fallen überraschend – dpa-AFX, 29.7.2021
In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe überraschend gefallen. Sie sank im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten eine Stagnation erwartet.
Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Zahl der sogenannten schwebenden Hausverkäufe um 3,3 Prozent. Im Mai waren die Verkäufe noch um 14,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.
Die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe, die auch als schwebende Hausverkäufe bezeichnet werden, gelten als Frühindikator für den Häusermarkt in den USA, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53543154-usa-schwebende-hausverkaeufe-fallen-ueberraschend-016.htm
USA: Neubauverkäufe geben weiter nach – dpa-AFX, 26.7.2021
In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser erneut stark gefallen. Die Neubauverkäufe sanken im Juni im Monatsvergleich um 6,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Es war der dritte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 3,5 Prozent gerechnet.
Außerdem war der Rückschlag im Mai stärker als bisher bekannt ausgefallen. Das Ministerium revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf 7,8 Prozent. Zuvor war ein Minus von 5,9 Prozent gemeldet worden.
Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Juni 676 000 neue Häuser in den USA verkauft. Es war der niedrigste Stand seit April 2020. Erwartet wurden 796 000 Häuser. Zuletzt sind die Baukosten in den USA deutlich gestiegen. Dies bremst laut Experten den Bau von neuen Häusern
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53505647-usa-neubauverkaeufe-geben-weiter-nach-016.htm
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet – DJN/dpa-AFX, 29.7.2021
Die Erholung des US-Arbeitsmarkts von dem Corona-Schock setzt sich fort. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 24. Juli 2021 weniger stark als erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 24.000 auf 400.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 380.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 424.000 von ursprünglich 419.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 8.000 auf 394.500.
In der Woche zum 17. Juli erhielten 3,269 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 7.000 mehr als in der Vorwoche.
Die Erstanträge gehen im Trend seit Beginn des Jahres zurück. Sie liegen allerdings immer noch deutlich über dem Niveau von vor der Corona-Krise. Vor der Pandemie wurden pro Woche etwa 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Allerdings befand sich der Arbeitsmarkt damals auch in einem wesentlich besseren Zustand als heute. Vor der Krise herrschte nahezu Vollbeschäftigung, infolge der Pandemie haben Millionen Amerikaner ihren Job verloren.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53542207-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-etwas-hoeher-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53541933-usa-weniger-erstantraege-auf-arbeitslosenhilfe-016.htm
SIEHE DAZU: Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
Andrew Duehren und Kristina Peterson: Unterhändler im US-Senat wohl einig über Infrastrukturprogramm – DJN, 28.7.2021
In den USA gibt es Anzeichen für eine Einigung im Streit um das von US-Präsident Joe Biden geplante milliardenschwere Infrastrukturprogramm. Senator Rob Portman (R., Ohio) sagte, eine parteiübergreifende Gruppe von Unterhändlern habe eine Einigung über die „wichtigsten Punkte“ des Infrastrukturpakets von rund 1 Billion US-Dollar erzielt. Ein Berater der Demokraten bestätigte ebenfalls, dass es eine Einigung gibt. Zuvor hatte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer (D., N.Y.), den Senatoren gesagt, sie sollten bereits am Mittwochabend zur Abstimmung bereit sein, um die Debatte über das Paket zu eröffnen.
Eine parteiübergreifende Gruppe von zehn Senatoren arbeitet seit Wochen an einer Einigung über die Details eines lockeren Rahmens für zusätzliche Bundesausgaben von 600 Milliarden Dollar für Straßen, Brücken, erweiterten Breitbandzugang und anderes. Am späten Dienstag hatte es Annäherungen beim letzten Knackpunkt gegeben: der Frage, wie viele Mittel für den öffentlichen Nahverkehr bereitgestellt werden sollten, für den die Demokraten eine Erhöhung gefordert hatten.
Während die Infrastrukturgespräche weitergehen, arbeiten führende Demokraten daran, unter den 50 Mitgliedern der demokratischen Fraktion eine Mehrheit für ein 3,5 Billionen Dollar schweres Paket mit Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Klimawandel und Armutsbekämpfung zu bekommen.
Die Unterstützung für die beiden Pakete, die zusammen einen Großteil der Agenda von Präsident Biden in ein Gesetz gießen würden, hängt sowohl von der Zusammenarbeit der verschiedenen Fraktionen der Demokraten als auch von der Bereitschaft der Republikaner ab, eine parteiübergreifende Vereinbarung über die Infrastruktur zu treffen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53531365-unterhaendler-im-us-senat-wohl-einig-ueber-infrastrukturprogramm-015.htm
SCHWEIZ
Sylviane Chassot: Was, wenn die Asiaten nicht wiederkommen? – Bergbahnen stecken tief in der Krise. Mitten in der Hochsaison bleiben die Terrassen leer – Finanz & Wirtschaft, 27.7.2021
Silvan Studer macht sich Sorgen. «Letztes Jahr hatten wir an so einem Tag doppelt so viele Gäste. Es ist schon etwas bedrückend, dass diesen Sommer neben der Pandemie auch noch das Wetter nicht mitspielt.» Er ist bei den Titlis-Bahnen zuständig für die Aktivitäten. Kurz nach 12 Uhr an diesem sonnigen Montag in der Ferienzeit steht er auf der Terrasse der Mittelstation vor einem Sprungturm, wo Kinder aus drei, viereinhalb und sechs Metern Höhe auf eine Matte springen. Wieder und wieder. Dass sie auf dem Weg nach oben keine Schlange passieren müssen, stört die Kleinen kaum. …
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/was-wenn-die-asiaten-nicht-wiederkommen/
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
Angela Capolongo, Michael Kühl: European Stability Mechanism: From savings to spending: Fast track to recovery – European Stability Mechanism, 30.7.2021
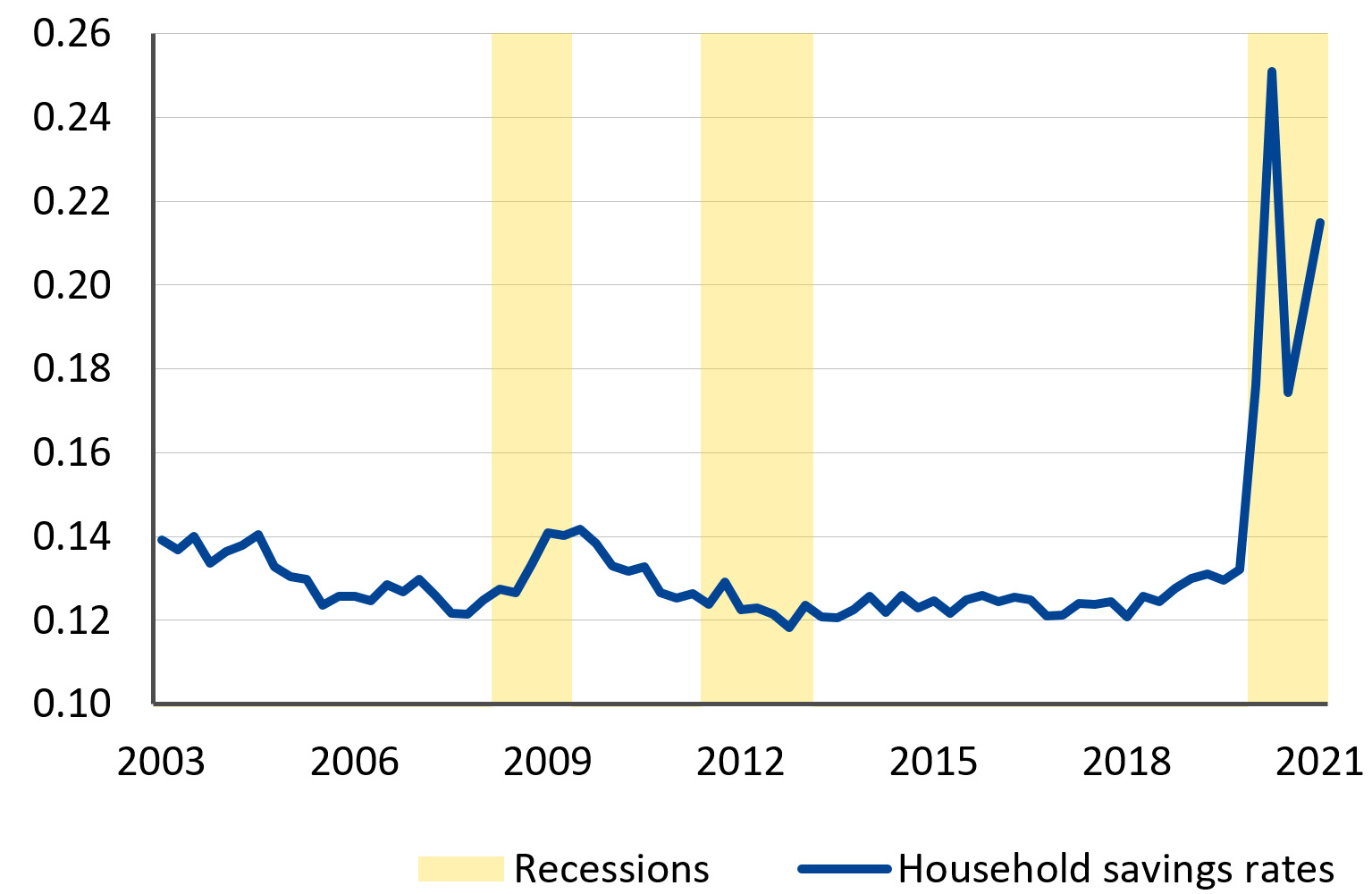
GRAPHIK: https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/image/2021-07/2021-07-30-figure1.jpg
Household savings increased to unprecedented levels during the pandemic as extraordinary levels of uncertainty were accompanied by pandemic-induced restrictions on households’ opportunities to spend. In this blog post, we quantify the drivers for the exceptional rise in household savings and analyse how what happens to these extra savings will determine the speed of economic recovery. If vaccine progress continues and policies remain in place to encourage a speedier spending of the extra savings, we could regain pre-pandemic gross domestic product (GDP) growth levels sooner than currently forecasted.
QUELLE: https://www.esm.europa.eu/blog/savings-spending-fast-track-recovery
Hans Bentzien: Euroraum-Verbraucherpreise steigen auf Jahressicht etwas stärker als erwartet auf 2,2 (Juni: 1,9) Prozent, sind aber im Monatsvergleich um 0,1 Prozent gesunken – Kerninflation flacht ab auf 0,7 Prozent (Juni: 0,9) – Energiekosten stark angestiegen, nicht unerheblicher Anstieg bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln sowie weiteren Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol – DJN, 30.7.2021
Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Juli etwas deutlicher als erwartet zugenommen, wobei auch die Kernteuerung etwas höher als prognostiziert ausfiel. Nach Angaben von Eurostat sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,2 (Juni: 1,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang um 0,3 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,0 Prozent prognostiziert.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) sanken um 0,4 Prozent auf Monatssicht und überstiegen ihr Vorjahresniveau um 0,7 (0,9) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisrückgang um 0,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 0,6 Prozent.
Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich mit einer Jahresrate von 1,6 (0,5) Prozent und unverarbeitete Nahrungsmittel um 1,8 (minus 0,3) Prozent. Energie kostete 14,1 (12,6) Prozent mehr als vor einem Jahr, die Teuerung bei Industriegütern ohne Energie ging auf 0,7 (1,2) Prozent zurück. Dienstleistungen kosteten 0,9 (0,7) Prozent mehr als vor Jahresfrist.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53552512-euroraum-verbraucherpreise-steigen-etwas-staerker-als-erwartet-015.htm
Hans Bentzien: Wirtschaftsstimmung im Euroraum hellt sich wie erwartet auf – DJN, 29.7.2021
Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli wie erwartet aufgehellt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Esi) stieg auf 119,0 (Juni: 117,9) Punkte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 118,9 gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator erhöhte sich auf 118,0 (117,1) Punkte.
Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.
Für Deutschland stieg der Esi auf 117,5 (117,2). In Frankreich erhöhte er sich auf 116,7 (112,7) und in Italien auf 119,6 (117,9) Punkte. Spaniens Esi zog auf 108,9 (107,2) Punkte an.
Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf plus 14,6 (plus 12,8) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf plus 13,0 erwartet. Der Index des Verbrauchervertrauens sank in zweiter Veröffentlichung auf minus 4,4 (minus 3,3) Punkte, was wie erwartet der ersten Veröffentlichung entsprach.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53538792-wirtschaftsstimmung-im-euroraum-hellt-sich-wie-erwartet-auf-015.htm
Hans Bentzien: Euroraum-Wirtschaft wächst preisbereinigt im 2. Quartal um 13,7 Prozent auf Jahressicht und damit stärker als erwartet – Auch das Quartalswachstum liegt mit 2 Prozent über den Erwartungen – DJN, 30.7.2021
Die Wirtschaft des Euroraums ist im zweiten Quartal stärker als gewachsen. Laut Mitteilung von Eurostat stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 2,0 Prozent und lag um 13,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quartalswachstumsrate von 1,5 Prozent und eine Jahresrate von 13,2 Prozent prognostiziert. Im ersten Quartal war das BIP nach bestätigten Angaben um 0,3 Prozent gesunken und hatte das Vorjahresniveau um 1,3 Prozent unterschritten
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53552511-euroraum-wirtschaft-waechst-im-2-quartal-staerker-als-erwartet-015.htm
Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im Juni deutlich auf 7,7 Prozent – DJN, 30.7.2021
Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Juni niedriger als erwartet gewesen. Nach Mitteilung von Eurostat sank die Arbeitslosenquote auf 7,7 (Mai revidiert: 8,0) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine gegenüber dem vorläufigen Mai-Wert von 7,9 Prozent unveränderte Quote prognostiziert.
Gemäß Schätzungen von Eurostat waren im Juni 12,517 Millionen Menschen arbeitslos. Gegenüber Mai 2021 sank die Zahl um 423.000 und gegenüber Juni 2020 um 339.000 im Euroraum.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53552513-euroraum-arbeitslosenquote-sinkt-im-juni-deutlich-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): IfW: Streben nach wirtschaftlicher Autonomie würde für EU-Länder teuer – China im Fokus: Abkoppeln der EU von internationalen Lieferketten würde EU-Staaten hunderte Milliarden Euro kosten – Einführung von Importzöllen ließe BIP deutlich weniger wachsen, bei Gegenmaßnahmen in die EU exportierender Länder noch stärker – Deutschland besonders betroffen – Isolation als falscher Weg, Alternativen: Lieferantennetz breiter aufzustellen, Recycling fördern, Lagerhaltung verbessern – DJN, 30.7.2021
Versorgungsengpässe infolge der Corona-Krise haben in der EU die Diskussion über eine stärkere wirtschaftliche Eigenständigkeit und die Rückverlagerung der Produktion befeuert. Ein Abkoppeln der EU von internationalen Lieferketten oder auch nur von China würde die EU-Staaten jedoch hunderte Milliarden Euro kosten, zeigen Simulationsrechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), wie das Institut in Kiel mitteilte.
Würde die EU einseitig die Handelsbarrieren – abseits von neuen Zöllen – verdoppeln, um sich vom Rest der Welt zu entkoppeln, würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) jedes Jahr verglichen zum Basisjahr 2019 preisbereinigt rund 580 Milliarden Euro oder 3,5 Prozent geringer ausfallen als ohne die Eingriffe, rechnet das IfW vor. Würden sich Europas Handelspartner wehren und im Gegenzug vergleichbare Maßnahmen einleiten, wüchse der Verlust nach den Berechnungen auf rund 870 Milliarden Euro oder 5,3 Prozent des BIP.
Ein Abkoppeln der EU sei besonders mit Blick auf den strategischen Rivalen China in der Diskussion. Würde die EU einseitig entsprechende Handelsbarrieren gegenüber China verdoppeln, würde das 130 Milliarden Euro (0,8 Prozent des BIP) kosten – bei vergleichbaren Gegenmaßnahmen Chinas wüchsen die Kosten auf 170 Milliarden Euro (1 Prozent des BIP). „Würde sich die EU auch nur teilweise von internationalen Liefernetzen abkoppeln, würde das den Lebensstandard der Menschen sowohl in der EU als auch bei ihren Handelspartnern deutlich verschlechtern. Neue Handelsbarrieren sollten deshalb unbedingt vermieden werden“, sagte Alexander Sandkamp, einer der Studienautoren.
Deutschland wäre als international wirtschaftlich besonders stark vernetztes Land härter als viele andere EU-Länder betroffen: Rund ein Fünftel der Kosten der gesamten EU würde Deutschland tragen, sofern sich die EU einseitig vom Ausland entkoppelt – das entspricht rund 115 Milliarden Euro oder 3,3 Prozent des deutschen BIP. Bei einer einseitigen Entkoppelung von China trüge Deutschland sogar rund ein Viertel der Lasten (32 Milliarden Euro oder 0,9 Prozent des BIP). Ein eskalierender Handelskrieg mit China könnte diese Kosten noch einmal um 50 Prozent steigen lassen.
Trotz Kritik an neuen Handelshürden sahen die Autoren der Studie Handlungsbedarf, um die Wirtschaft der EU gegen Krisen im internationalen Warenverkehr widerstandsfähiger zu machen. Besser als eine Abkoppelung von internationalen Lieferketten wäre es allerdings aus ihrer Sicht, zum Beispiel das Lieferantennetz breiter aufzustellen, Recycling zu fördern und die Lagerhaltung zu verbessern. Isolation sei der falsche Weg.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53550982-ifw-streben-nach-wirtschaftlicher-autonomie-wuerde-fuer-eu-laender-teuer-015.htm
SIEHE DAZU:
=> Decoupling Europe
QUELLE: https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/kiel-policy-briefs/2021/decoupling-europe-0/
Graues Gold — Das Milliarden-Geschäft mit der Altenpflege – Ausgaben der öffentlichen Hand – Investigate Europe, Juli 2021
Quer durch Europa teilen alten Menschen ein Schicksal: Werden Sie pflegebedürftig und müssen und in ein Altenheim ziehen, erleben sie, wie der Mangel an Personal und überarbeitete Pflegekräfte ihr Leben bedrohen. Die Zustände in den Heimen wurden noch sichtbarer durch die Covid-19-Pandemie. Fast überall in Europa werden die Pflegebedürftigen schlecht versorgt. Doch zugleich machen internationale Konzerne und Finanzinvestoren mt Pflegeheimen ein Milliardengeschäft.
Eine alternde Gesellschaft und eine stabile öffentliche Finanzierung sind die Grundlagen für das lukrative Geschäft. In Spanien betreiben gewinnorientierte Unternehmen bereits 80 Prozent aller Pflegeheime, in Großbritannien sind es 76 Prozent, in Deutschland sind vier von zehn Heimen in privater Hand. Und es werden immer mehr. In den vergangenen vier Jahren haben allein die 25 führenden Unternehmen ihre Kapazitäten um 22 Prozent erhöht. Der europäische Marktführer Orpea hat seinen Aktienkurs seit 2015 verdoppelt. Korian, die Nummer zwei der Branche, kündigte jüngst an, weitere Einrichtungen in Italien und Großbritannien kaufen zu wollen. Manche Konzerne nutzen undurchsichtige Strukturen, wie zum Beispiel DomusVi, ein weiterer Akteur mit Sitz in Frankreich. Der Besitz von dessen Heimen läuft über Gesellschaften an Orten wie Luxemburg oder den Jersey-Inseln. Diese Konstrukt führt dazu, dass DomusVi auf dem Papier stets Verluste macht und keine Steuern zahlen muss.
Dem Milliarden-Geschäft mit der Altenpflege sind die Reporterinnen und Reporter von Investigate Europe gemeinsam mit Medienpartnern von Portugal bis Schweden quer durch 15 europäische Länder nachgegangen. Dabei fanden Sie beunruhigende Entwicklungen:
() Ein immer größerer Anteil der Gelder, die Regierungen für die Pflege ausgeben, fließt auf die Konten internationaler Konzerne und Finanzinvestoren. Für sie hat der Markt ein riesiges Potenzial. Denn nach Angaben der OECD zahlen die EU-Staaten jährlich 220 Milliarden Euro an die Betreiber von Pflegeeinrichtungen.
() Bereits heute betreiben gewinnorientierte Unternehmen einen wichtigen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die 25 größten Konzerne verfügen europaweit über mehr als 455.000 Pflegeplätze. Nach Recherchen von Investigate Europe konnten sie ihre Kapazitäten binnen der vergangenen vier Jahre um 22 Prozent erhöhen.
() Wenn Pfleger und Pflegerinnen dies dennoch versuchen, müssen sie mit drastischen Konsequenten rechnen.
() Finanzinvestoren drängen ebenfalls in den Pflegemarkt. Investigate Europe konnte 30 Private-Equity-Fonds identifizieren, die in dem Markt aktiv sind. Diese meist anonymen Investoren betreiben komplizierte Unternehmenskonstrukte, um möglichst wenig Steuern auf ihre Gewinne zu zahlen, die sie mit öffentlichen Geldern erzielt haben. Dafür leiten sie ihre Erlöse in Offshore-Zentren wie die Jersey-Inseln um.
() Die zunehmende Privatisierung und die steigende Beteiligung von Finanzinvestoren führt in vielen EU-Staaten dazu, dass in den Heimen weniger Pflegerinnen und Pfleger eingesetzt werden und die Qualität der Pflege vielerorts einbricht.
() Staatliche Behörden versagen bei den Kontrollen. In vielen Ländern werden Qualitätsprüfungen nur sehr selten durchgeführt. Mitunter begutachten Prüferinnen und Prüfer dafür nicht einmal die pflegebedürftigen Menschen selbst, sondern lesen nur die Pflegedokumentation.
Wie passen enorme Profite zu einem Sektor, der unterbesetzt und unterfinanziert ist? Wieso erlauben Regierungen diese Zustände? Was sind die Konsequenzen? Und: Gibt es Alternativen zum Milliarden-Geschäft mit der alternden Gesellschaft?
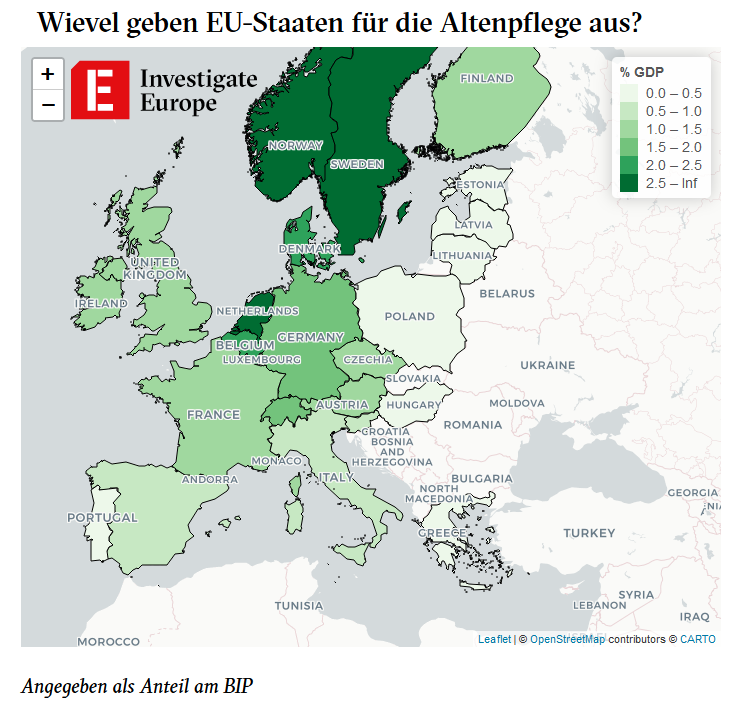
FRANKREICH
Frankreich: Inflation schwächt sich ab – dpa-AFX, 30.7.2021
PARIS (dpa-AFX) – Die Inflation in Frankreich hat sich im Juli abgeschwächt, wenn auch nicht so stark wie erwartet. Gegenüber dem Vorjahr seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Im Vormonat hatte die Rate 1,9 Prozent betragen. Analysten hatten mit einer Abschwächung auf 1,4 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,1 Prozent.
Preisdämpfend wirkte die Entwicklung bei industriell gefertigten Gütern, deren Preise deutlich fielen. Die Preise von Dienstleistungen stiegen zwar an, allerdings schwächer als im Juni. Die Energiepreise erhöhten sich dagegen kräftig um mehr als 12 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53550360-frankreich-inflation-schwaecht-sich-ab-016.htm
Frankreich: Verbraucherstimmung trübt sich ein – DJN, 28.7.2021
Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Juli eingetrübt. Der vom Statistikamt Insee erhobene Indikator fiel zum Vormonat um zwei Punkte auf 101 Zähler, wie Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 102 Punkten gerechnet.
Allerdings wurden die Daten für den Vormonat leicht nach oben revidiert, auf 103 Punkte. Damit erreichte der Stimmungsindikator im Juni den höchsten Stand seit März 2020. Trotz des Dämpfers im Juli rangiert der Index weiter über dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53523613-frankreich-verbraucherstimmung-truebt-sich-ein-016.htm
ITALIEN
Italien: Inflation geht überraschend deutlich zurück – dpa-AFX, 30.7.2021
In Italien hat sich die Inflation stärker als erwartet abgeschwächt. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Juli zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Inflationsrate von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem sie im Juni bei 1,3 Prozent lag.
Im Monatsvergleich fielen die Lebenshaltungskosten im Juli um 1,1 Prozent und damit wie von Analysten erwartet. Die Preisentwicklung in Italien bleibt hinter der in der Eurozone insgesamt zurück. Wie das europäische Statistikamt Eurostat zeitgleich mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im gemeinsamen Währungsraum im Juli 2,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53552439-italien-inflation-geht-ueberraschend-deutlich-zurueck-016.htm
BELGIEN
Hans Bentzien: Belgiens Geschäftsklimaindex im Juli auf Rekordhoch – DJN, 26.7.2021
Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juli weiter aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex auf ein Rekordhoch von 10,1 (Juni: 9,8) Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten sogar einen Anstieg auf 10,3 Punkte prognostiziert. Das Geschäftsklima besserte sich vor allem im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel. Schlechter war es dagegen im Dienstleistungssektor und in der Bauindustrie.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53505123-belgiens-geschaeftsklimaindex-im-juli-auf-rekordhoch-015.htm
DEUTSCHLAND
Erneut starker Anstieg der deutschen Importpreise auf Jahressicht auf 13 Prozent, ohne Energieeinfuhren um 7 Prozent – Energieeinfuhren um 89 Prozent teurer – Basiseffekt als eine Ursache – DJN, 28.7.2021
Nach Deutschland importierte Güter haben sich erneut stark verteuert. Die Importpreise in Deutschland sind im Juni erneut stärker gestiegen als erwartet. Dafür sorgten insbesondere die Energiepreise. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 1,1 Prozent prognostiziert.
Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Preissteigerung von 12,9 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten 12,4 Prozent erwartet. Im Mai hatten die Raten bei revidiert 1,6 (vorläufig: 1,7) Prozent zum Vormonat und bestätigt 11,8 Prozent zum Vorjahresmonat gelegen.
Eine höhere Vorjahresveränderung hat es laut Bundesamt zuletzt im Oktober 1981 im Rahmen der zweiten Ölpreiskrise gegeben. Bereits im Mai waren die Importpreise im Jahresvergleich stark um 11,8 Prozent gestiegen, nach einem kräftigen Plus von 10,3 Prozent im April.
Energieeinfuhren waren im Juni um 88,5 Prozent teurer als im Vorjahr. Hier kam wie bereits im April und Mai der Basiseffekt zutage, sprich ein ungewöhnlich niedriges Preisniveau in der Pandemie- und Lockdownphase 2020.
Ohne Energie waren die Importpreise um 0,8 Prozent höher als im Vormonat, binnen Jahresfrist betrug die Steigerung 7,2 Prozent.
Die Preise für importierte Vorleistungsgüter stiegen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls kräftig, um 17,1 Prozent, wie es weiter hieß. Gegenüber Juni 2020 verteuerten sich in diesem Bereich vor allem Eisenerze, deren Preise sich fast verdoppelt haben.
Der Index der Ausfuhrpreise lag im Juni um 0,8 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 5,0 Prozent registriert. Höher war dieser Wert zuletzt im April 1982 gewesen.
Den starken Preisanstieg im Jahresvergleich führte das Bundesamt vor allem auf die Entwicklung der Energiepreise zurück: „Energieeinfuhren waren im Juni 2021 um 88,5 Prozent teurer als im Juni 2020.“ Das Bundesamt verwies auf einen Basiseffekt, hervorgerufen durch das außerordentlich niedrige Preisniveau für Energie im Juni 2020. Ohne Energie waren die Importpreise dem Bundesamt zufolge im Juni um 7,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53523285-erneut-starker-anstieg-der-deutschen-importpreise-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53523258-deutschland-staerkster-anstieg-der-importpreise-seit-1981-preistreiber-energie-016.htm
INFLATION (DJN Pressespiegel, 30.7.2921) – Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer rechnet nicht mit einer dauerhaften Erhöhung der Inflationsrate. Zwar dürfte die Teuerung in der zweiten Jahreshälfte 3 Prozent übersteigen (im Juli waren es bereits 3,8 Prozent). Diese Entwicklung liege unter anderem an der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung und anderen Einflussfaktoren. „Ganz überwiegend handelt es sich dabei aber um temporäre Faktoren, von einer dauerhaften Inflationserhöhung ist derzeit nicht auszugehen“, so Schnitzer. Wie stark der wirtschaftliche Aufschwung nach der Corona-Krise ausfallen wird, hänge stark von der Impfentwicklung ab und wie sich die Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten wie etwa Chips entwickeln. (Passauer Neuen Presse)
IMK-Direktor Sebastian Dullien geht davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr vorübergehend auf über 4 Prozent steigen, aber schon im Januar 2022 wieder deutlich nachgeben könnte. „Mittelfristig wird sich die Inflation wieder um 2 Prozent oder darunter einpendeln, also bei dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank“, sagte der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung. Da der Inflationsanstieg nur vorübergehend sei, gebe es dadurch auch keine großen Gewinner oder Verlierer. Er werde sich nicht in dauerhaft steigenden Löhnen und Preisen niederschlagen. Deshalb gebe es auch „keinen Handlungsdruck für die Europäische Zentralbank“. (Funke Mediengruppe)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53549008-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juli auf 3,1 Prozent, die nationale auf 3,8 Prozent – Jahresteuerungen: Nahrungsmittel 4,3 (Juni: 1,2) Prozent, Energie11,6 (9,4) Prozent, Dienstleistungs 2,2 Prozent (1,6) Prozent -Basiseffekte treiben: coronabedingte Mehrwertsteuersenkung im Vorjahr, CO2-Bepreisung u.a. – Änderung der Gütergewichte im HVPI sorgt für Auseinanderklaffen von HVPI und nationaler Inflationsrate – DJN, 29.7.2021
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 3,1 (Juni: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war der höchste Stand seit August 2008. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 3,0 Prozent prognostiziert.
In nationaler Definition erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent auf Monats- und 3,8 (2,3) Prozent auf Jahressicht. Volkswirte hatten Anstiege von 0,5 und 3,3 Prozent prognostiziert. Die Preisanstiege waren breit basiert, wobei den größten Beitrag die Nahrungsmittel mit einer Jahresteuerung von 4,3 (Juni: 1,2) Prozent lieferten. Energie verteuerte sich um 11,6 (9,4) Prozent, und Dienstleistungen kosteten 2,2 (1,6) Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg der Wohnungsmieten blieb bei 1,3 Prozent.
Ausgelöst wurde der Inflationsanstieg laut Destatis vor allem von einem Basiseffekt, der auf die coronabedingte Senkung der Mehrwertsteuersätze im Juli 2020 zurückzuführen ist. Seit Januar 2021 befinden sich die Mehrwertsteuersätze für fast alle Waren und Dienstleistungen wieder auf dem vorherigen Niveau.
Die genaue Höhe des Basiseffekts ist nach Angaben der Statistiker schwer zu beziffern, da gleichzeitig auch andere Preiseffekte wirken, wie zum Beispiel die CO2-Bepreisung und übliche Marktentwicklungen. Zum Zeitpunkt der Senkung der Mehrwertsteuersätze im Juli 2020 lag der rein rechnerische Effekt bei minus 1,6 Prozentpunkten.
Destatis weist außerdem darauf hin, dass die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen für das öffentliche Leben und den daraus resultierenden Folgen eine Änderung des üblichen Vorgehens bei der jährlichen Aktualisierung der Gütergewichte des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) notwendig gemacht haben. Diese Aktualisierung erklärt den großen Unterschied zwischen Verbraucherpreisindex und HVPI.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53541855-deutsche-hvpi-inflation-steigt-im-juli-auf-3-1-prozent-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): DIW-Konjunkturbarometer sinkt für 3Q – BIP 2Q geschätzt +2,5 Prozent – Wirtschaftsplus in Q2 dank Erholung in vielen Dienstleistungsbranchen nun abgeschlossen – Industrie im zweiten Quartal durch fehlende Vorleistungsgüter ausgebremst – Anziehende Industriedynamik für späteren Jahresverlauf erwartet – DJN, 28.7.2021
Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sinkt nach Angaben des Instituts. Für das laufende dritte Quartal liegt es demnach bei einem Stand von 100 Punkten. Damit deute sich fortan eine langsamere Entwicklung an, nachdem das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni mit rund zweieinhalb Prozent einen kräftigen Satz gemacht haben dürfte. Im Juni hatte das DIW für das zweite Quartal einen Wert seines Barometers von 113 Punkten ausgewiesen.
„Die deutsche Wirtschaft wird im dritten Quartal wohl an Tempo verlieren. Maßgeblich für das kräftige Plus im vergangenen Quartal war die Erholung in vielen Dienstleistungsbranchen, die nun weitgehend abgeschlossen sein dürfte“, sagte Simon Junker, DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland. Dagegen sei die Industrie im zweiten Quartal durch fehlende Vorleistungsgüter ausgebremst worden. Bislang zeichnet sich keine Besserung ab. „Auch im dritten Quartal leiden viele Branchen unter globalen Lieferengpässen, die Industrie schwächelt weiterhin“, so Junker.
Nicht zuletzt aufgrund möglicherweise wieder stärker zulegender Inzidenzen seien auch die Stimmungsindikatoren zuletzt gesunken. Alles in allem setze sich die Erholung der deutschen Wirtschaft fort. Angesichts der Schwierigkeiten in der Industrie dürfte der Zuwachs von Juli bis September im Vorquartalsvergleich aber allenfalls bei 1 Prozent liegen. Damit komme die Erholung zwar in etwas ruhigeres Fahrwasser – Aussichten auf eine kräftigere Industriekonjunktur im späteren Jahresverlauf sprächen aber für eine wieder anziehende Dynamik zum Jahreswechsel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53525405-diw-konjunkturbarometer-sinkt-fuer-3q-bip-2q-geschaetzt-2-5-prozent-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche Wirtschaft wächst im 2Q schwächer als erwartet – DJN, 30.7.2021
Die deutsche Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal von dem coronabedingten Einbruch des ersten Quartals erholt – und allerdings etwas verhaltener als erwartet. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent und lag kalenderbereinigt um 9,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quartalswachstumsrate von 1,9 Prozent und eine Jahresrate von 9,6 Prozent prognostiziert.
Laut Destatis wurde das Wachstum vom privaten und staatlichen Konsum gestützt. Im ersten Quartal war das BIP nach revidierten Angaben um 2,1 (vorläufig: 1,8) Prozent gesunken.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53551585-deutsche-wirtschaft-waechst-im-2q-schwaecher-als-erwartet-015.htm
ROUNDUP: Delta-Variante sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft – Einschätzung der künftigen Geschäfte belastet – Geschäftsklima im Dienstleistungssektor verschlechtert – Sommerhalbjahr dürfte hohes Wachstum bringen, das vierte Quartal eine „massive Verlangsamung des Wachstums“ – dpa-AFX, 26.7.2021
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli überraschend eingetrübt. Der Index für das Geschäftsklima sank um 0,9 Punkte auf 100,8 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag bekanntgab. Das führende deutsche Konjunkturbarometer, das auf einer Umfrage unter etwa 9000 Unternehmen basiert, fiel damit erstmals seit Beginn des Jahres. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 102,5 Punkte gerechnet.
Ausschlaggebend für den Rückgang ist die Einschätzung der künftigen Geschäfte. Hier ging der entsprechende Indexwert zurück, während die Bewertung der aktuellen Lage erneut besser war. „Lieferengpässe bei Vorprodukten und Sorgen um wieder steigende Infektionszahlen belasten die deutsche Wirtschaft“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.
Nach Einschätzung von Fuest hat der Optimismus in den Chefetagen deutscher Firmen „merklich“ abgenommen. Im Dienstleistungssektor, der zuletzt besonders stark von den Lockerungen der Corona-Maßnahmen profitierte, habe sich das Geschäftsklima verschlechtert. Fuest wies aber darauf hin, dass die Dienstleister nach wie vor mit steigenden Umsätzen rechnen, wenn auch nicht mehr so stark wie im Juni.
„Der Pandemieverlauf ist weiterhin ein Risikofaktor für die wirtschaftliche Entwicklung“, kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seiner Einschätzung nach deuten die Ergebnisse der Ifo-Umfrage darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft das Konjunkturhoch hinter sich lasse und im Herbst „vom Aufholmodus in den Normalmodus“ wechseln werde.
Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Sommerhalbjahr kräftigen wachsen werde. Eine mögliche vierte Corona-Welle und die Reaktion der Politik darauf dürften die Wirtschaft aber im vierten Quartal belasten. „Wir rechnen mit einer massiven Verlangsamung des Wachstums, aber nicht mit einem Schrumpfen der Wirtschaft“, sagte Krämer.
Am Devisenmarkt geriet der Euro nach Veröffentlichung der Ifo-Daten unter Druck und gab die Kursgewinne aus dem frühen Handel ab
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53501792-roundup-delta-variante-sorgt-fuer-stimmungsdaempfer-in-der-deutschen-wirtschaft-016.htm
Kurzvideo – USA verlängert Einreisestopp Beyer: Industrie „gerät immer mehr in Schieflage“ – n-tv, 27.7.2021
Die USA verlängern ihren Einreisestopp für Personen aus dem Schengenraum. Das stellt die Industrie vor große Probleme: Ausländische Ingenieure können nicht ins Land, Maschinen nicht gewartet werden. Peter Beyer, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, schätzt im Gespräch mit ntv die Lage ein.
QUELLE (inkl. 3:49-min-Video): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Beyer-Industrie-geraet-immer-mehr-in-Schieflage-article22707207.html
SIEHE DAZU:
=> Angst vor Delta-Variante USA halten an Reisebeschränkungen fest – n-tiv, 27.72021
QUELLE: https://www.n-tv.de/panorama/USA-halten-an-Reisebeschraenkungen-fest-article22706010.html
Andreas Kißler (WSJ): Ifo-Exporterwartungen fallen im Juli leicht – DJN, 27.7.2021
Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung leicht verschlechtert. Die Ifo- Exporterwartungen der Industrie sind im Juli auf 24,5 Punkte gefallen, von saisonbereinigt korrigierten 25,0 Punkten im Juni, gab das Institut in München bekannt. „Insgesamt läuft die deutsche Exportwirtschaft jedoch weiterhin sehr gut“, so das Institut. Nahezu alle Branchen gingen von einem Anstieg der Exporte aus. Einen deutlichen Zuwachs der Auslandsumsätze erwarte die Elektroindustrie. Gleiches gelte für den Maschinenbau und die Nahrungsmittelindustrie. In der Metallindustrie seien die Exporterwartungen weiter rückläufig, aber immer noch auf Wachstum ausgerichtet. Die Automobilwirtschaft gehe von moderaten Zuwächsen aus. Einen deutlichen Dämpfer hingegen habe das Papiergewerbe verkraften müssen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53511160-ifo-exporterwartungen-fallen-im-juli-leicht-015.htm
Hans Bentzien: Ifo-Geschäftsklima sinkt im Juli unerwartet – Gestörte Lieferketten und steigende Infektionszahlen lassen Erwartungen und Einschätzung der aktuellen Lage sinken – DJN, 26.7.2021
Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 100,8 (Juni revidiert: 101,7) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 102,5 Punkte erwartet. Vorläufig waren für Juni 101,8 Punkte gemeldet worden.
Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage stieg auf 100,4 (revidiert 99,7) Punkte. Ökonomen hatten 101,5 prognostiziert. Vorläufig war für Juni ein Stand von 99,6 gemeldet worden. Der Index für die Geschäftserwartungen fiel auf 101,2 (revidiert 103,7) Zähler. Erwartet worden waren 103,6 Punkte. Der vorläufige Juni-Wert betrug 104,0.
„Lieferengpässe bei Vorprodukten und Sorgen um wieder steigende Infektionszahlen belasten die deutsche Wirtschaft“, kommentierten die Konjunkturforscher die Zahlen. Der Ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.
Im verarbeitenden Gewerbe fiel der Index, was auf deutlich weniger optimistische Erwartungen der Unternehmen zurückzuführen war. Der entsprechende Indikator sank zum vierten Mal in Folge. Die Einschätzungen der Unternehmen zur aktuellen Lage stiegen dagegen auf den höchsten Wert seit August 2018. Die Kapazitätsauslastung konnte von 85,9 auf 87,1 Prozent gesteigert werden. Sie liegt damit deutlich oberhalb des langfristigen Mittelwerts von 83,5. Die Knappheit bei den Vorprodukten verschärft sich weiter, und immer mehr Firmen klagten über Fachkräftemangel.
Im Dienstleistungssektor verschlechterte sich das Geschäftsklima. Während die Dienstleister mit ihren laufenden Geschäften zufriedener waren, blicken sie deutlich weniger optimistisch auf die kommenden Monate. Die Unternehmen rechneten trotzdem weiter mit steigenden Umsätzen, wenn auch nicht mehr so stark wie im Vormonat. Auch im Handel gab der Index nach. Die vorsichtig optimistischen Erwartungen aus dem Vormonat verschlechterten sich. Der Indikator zur aktuellen Lage konnte hingegen etwas zulegen.
Auch im Handel berichteten mehr und mehr Firmen von Lieferengpässen. Im Bauhauptgewerbe konnte sich das Geschäftsklima verbessern. Die Unternehmen waren zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Der Erwartungsindikator stieg das dritte Mal in Folge.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53501227-ifo-geschaeftsklima-sinkt-im-juli-unerwartet-015.htm
SIEHE DAZU:
=> Ifo-Index sinkt überraschend: Schwere Lieferengpässe bremsen Industrie – n-tv, 26.7.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Schwere-Lieferengpaesse-bremsen-Industrie-article22704856.html
Andreas Kißler (WSJ) u.a.: Ifo-Exporterwartungen fallen im Juli leicht – DJN/dpa-AFX, 27.7.2021
Ungeachtet der andauernden Corona-Krise und des Chipmangels gehen die meisten Branchen der deutschen Industrie von weiter steigenden Exporten in den nächsten Monaten aus. Laut Ifo erwarten nahezu alle Branchen einen Anstieg der Exporte, insbesondere Elektroindustrie, Maschinenbau und Nahrungsmittelindustrie. Die Autoindustrie rechnet demnach mit moderaten Zuwächsen
Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung leicht verschlechtert. Die Ifo- Exporterwartungen der Industrie sind im Juli auf 24,5 Punkte gefallen, von saisonbereinigt korrigierten 25,0 Punkten im Juni, gab das Institut in München bekannt. „Insgesamt läuft die deutsche Exportwirtschaft jedoch weiterhin sehr gut“, so das Institut. Nahezu alle Branchen gingen von einem Anstieg der Exporte aus. Einen deutlichen Zuwachs der Auslandsumsätze erwarte die Elektroindustrie. Gleiches gelte für den Maschinenbau und die Nahrungsmittelindustrie. In der Metallindustrie seien die Exporterwartungen weiter rückläufig, aber immer noch auf Wachstum ausgerichtet. Die Automobilwirtschaft gehe von moderaten Zuwächsen aus. Einen deutlichen Dämpfer hingegen habe das Papiergewerbe verkraften müssen.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53511160-ifo-exporterwartungen-fallen-im-juli-leicht-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53511107-ifo-industrie-erwartet-steigende-exporte-stimmung-etwas-schlechter-016.htm
Umsatz in gewerblicher Wirtschaft Deutschlands um 2,7 Prozent höher – DJN, 28.7.1021
FRANKFURT (Dow Jones)–Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands ist im Juni zum zweiten Mal in Folge gestiegen und liegt inzwischen deutlich über dem Vorkrisenniveau. Nominal, aber kalender- und saisonbereinigt erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Er lag damit um 12,2 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Den vorläufig für Mai gemeldeten Anstieg von 1,6 Prozent revidierten die Statistiker auf 2,3 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53523335-umsatz-in-gewerblicher-wirtschaft-deutschlands-um-2-7-prozent-hoeher-015.htm
Jan Hauser: Immobiliengeschäft im Wandel : Genau hinsehen – Insider sehen keine Gefahr einer Überhitzung des Immobilienmarktes – Immobilieninvestoren: statt Büro- nun Wohnimmobilien im Blickpunkt – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.7.2021
Immer wieder stellt sich die Frage, ob der Immobilienmarkt hierzulande zu überhitzen droht – und Anleger davon deshalb besser die Finger lassen sollten. Für die Versicherungen in Deutschland sieht die Antwort darauf eindeutig aus: Die Branchenvertreter erkennen nach einer neuen Umfrage zumindest bislang keine Gefahr und steigern ihre Immobilienquote seit beinahe zehn Jahren Stück für Stück.
Dennoch wandelt sich auch ihr Anlageverhalten. Das neue, beliebteste Investmentziel sind die Wohnimmobilien, die an den Logistikflächen als bisherigem Spitzenreiter vorbeigezogen sind. Einige Plätze dahinter rangieren nun Büros, die zuvor auch schon ganz vorn lagen, sowie Einzelhandel und Hotels. Mancher Wandel ist durch die Corona-Pandemie entstanden, die keinen Einbruch auf dem Immobilienmarkt verursacht, aber immerhin den Trend zum Homeoffice hervorgebracht hat.
Von den Versicherungen können sich andere Anleger durchaus abschauen, dass es sich lohnt, auch die einzelnen Bereiche auf dem Immobilienmarkt genau zu betrachten. Dazu zählen die Anlageklasse einer möglichen Investition gewiss, aber eben fast noch mehr der Ort und dessen Perspektive. Versicherungen legen das Kapital vor allem an guten bis sehr guten Standorten in Ballungsräumen an. Es sollte sich lohnen, diesen Rahmen im Blick zu haben und den Taschenrechner zu zücken. Sicher werden sich so auch auf dem Büromarkt noch attraktive Anlagen finden.
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/immobiliengeschaeft-im-wandel-genau-hinsehen-17447929.html
Andreas Kißler (WSJ): GfK: Konsumklima stagniert entgegen den Erwartungen – Konjunkturerwartung weiter auf sehr hohem Niveau – Einkommenserwartung mit moderaten Einbußen – DJN, 28.7.2021
Nach einer zuletzt deutlichen Aufhellung hat die Stimmung der Verbraucher laut den Konsumforschern der GfK eine Verschnaufpause eingelegt. Sie ermittelten nach eigenen Angaben für August einen Stand ihres Indikators zum Konsumklima von minus 0,3 und damit den gleichen Wert wie im Juli. Die Entwicklung fällt damit deutlich gedämpfter aus als erwartet, denn die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten eine Zunahme auf 0,5 Zähler angenommen.
„Die Phase sinkender Inzidenzen ist zu Ende gegangen, und die Infektionszahlen steigen wieder. Zudem hat die Dynamik beim Impfen trotz ausreichend vorhandenen Impfstoffes zuletzt deutlich nachgelassen“, konstatierte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. „Dies verhindert gegenwärtig einen weiteren deutlichen Anstieg der Konsumstimmung.“
Hinzu komme, dass das Thema Inflation wieder stärker in den Fokus der Konsumenten rücke. Die Erfahrung zeige, dass steigende Preise, wie sie im Moment zu beobachten seien, belastend auf das Konsumklima wirkten. „Trotz der momentanen Stagnation des Konsumklimas wird die Binnenkonjunktur in der zweiten Jahreshälfte einen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten“, meinte Bürkl aber. „Dafür werden auch die gut gefüllten Portemonnaies der Verbraucher sorgen.“
*** Konjunkturerwartung weiter auf sehr hohem Niveau ***
Sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung haben laut GfK moderate Verluste verzeichnet, während die Anschaffungsneigung nochmals leicht zulegte. Vor allem die Konjunkturerwartung weise aber nach wie vor „ein überaus hohes Niveau“ auf. Nachdem die Konjunkturerwartung im Vormonat auf ein Zehn-Jahres-Hoch geklettert war, habe sie sich im Juli etwas moderater gezeigt. Der Indikator büßte laut GfK 3,8 auf 54,6 Punkte ein. Das nach wie vor überaus hohe Niveau belege auch die Tatsache, dass die Konjunkturaussichten 44 Zähler über dem entsprechenden Vorjahreswert lägen.
*** Einkommenserwartung mit moderaten Einbußen ***
Die Einkommenserwartung folge den Konjunkturaussichten und habe ebenfalls moderate Einbußen um 5,1 auf 29 Punkte verzeichnet. Auch hier sei das Niveau zufriedenstellend, wie ein Plus von gut 10 Zählern gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert belege. Ein Grund für die gemäßigtere Entwicklung der Einkommenserwartung dürfte das Thema Inflation sein. Durch gestiegene Energiepreise sowie die eingeführte CO2-Bepreisung sei die Inflationsrate zuletzt auf mehr als 2 Prozent gestiegen. Hinzu komme, dass im Juli die Inflation noch einen Sprung nach oben machen werde, da nun der Basiseffekt der im Juli 2020 gesenkten Mehrwertsteuer wirksam werde.
Die Anschaffungsneigung kletterte dagegen um 1,4 auf 14,8 Punkte. Gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres weise die Konsumneigung ein Minus von knapp 28 Zählern auf. „Nach wie vor ist die Konsumfreude nicht ungetrübt“, betonte Bürkl. „Zwar sind die Portemonnaies derzeit bei vielen Konsumenten gut gefüllt, aber die Maskenpflicht sowie Abstandsregeln verhindern bislang ein ungetrübtes Einkaufserlebnis.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53524382-gfk-konsumklima-stagniert-entgegen-den-erwartungen-015.htm
ROUNDUP/Weniger Geld am Monatsende: Corona setzt Löhne unter Druck – dpa-AFX, 29.7.2021
Millionen Arbeitnehmer mussten in Kurzarbeit, Hunderttausende verloren ihren Job: Die Corona-Krise hat die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Deutschland hart getroffen. Das spiegelt sich auch immer stärker in der Lohnentwicklung wider. Erstmals seit einem Jahrzehnt wird aus Sicht von Wissenschaftlern der Anstieg der Tariflöhne 2021 voraussichtlich nicht ausreichen, um die allgemeine Preissteigerung auszugleichen. Und bei der Entwicklung der Reallöhne sah es für die Beschäftigen zuletzt auch nicht gut aus.
In den Jahren 2018 und 2019 waren die Tariflöhne mit Zuwächsen von 3,0 und 2,9 Prozent noch relativ kräftig gestiegen. Doch das ist vorbei. Seit dem Frühjahr 2020 stünden die Tarifauseinandersetzungen „ganz im Zeichen der Corona-Krise“, sagte der Leiter des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Thorsten Schulten, am Donnerstag in Düsseldorf.
Die Folge: Schon im Jahr 2020 stiegen die Tariflöhne nur um 2,0 Prozent. Und der Abwärtstrend hat sich 2021 fortgesetzt. Nach den im ersten Halbjahr und in den Vorjahren für 2021 abgeschlossenen Tarifverträgen werden die Tariflöhne in diesem Jahr nur um 1,6 Prozent steigen, wie das WSI errechnete. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Inflationsrate werde die reale Tariflohnentwicklung mit einem Minus von 0,2 Prozent damit leicht negativ ausfallen. Die Folge: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten sich mit ihrem Verdienst am Ende – etwas – weniger kaufen als noch im Vorjahr. In den vergangenen 20 Jahren habe es das nur drei Mal gegeben: 2006, 2007 und 2011.
Dabei wurde der Abwärtstrend noch durch die bereits in den vergangenen Jahren für 2021 abgeschlossenen Tarifverträge abgemildert. Bei den im 1. Halbjahr 2021 neu abgeschlossenen Tarifverträgen lagen die Lohnsteigerungen sogar nur bei durchschnittlich 1,1 Prozent.
Und real dürfte es in vielen Portemonnaies zuletzt sogar noch etwas schlechter ausgesehen haben. Denn nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die bezahlte Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten im 1. Quartal dieses Jahres um drei Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Hier machte sich vor allem die Kurzarbeit bemerkbar. Sie reduzierte die bezahlte Wochenarbeitszeit und damit den Bruttomonatsverdienst.
Wie sich das auf Löhne und Gehälter auswirkte, ist allerdings gar nicht so einfach zu sagen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lagen die Reallöhne im 1. Quartal 2021 um 2,0 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Doch ganz so schlimm dürften die Einbußen für die Beschäftigten am Ende doch nicht gewesen sein. Denn die Statistiker berücksichtigten bei diesen Berechnungen das gezahlte Kurzarbeitergeld nicht, weil es in ihren Augen eine Lohnersatzleistung darstellt und damit kein Verdienstbestandteil ist.
Fest steht aber, dass die Pandemie den in den Jahren bis 2019 beobachteten Höhenflug der Bruttolöhne und Gehälter erst einmal gestoppt hat. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 waren die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nach Angaben der Statistiker um 28,5 Prozent gestiegen. Die jährliche Zuwachsrate lag bei durchschnittlich 2,5 Prozent. Im Corona-Jahr 2020 gingen die Bruttolöhne und -gehälter dagegen nach den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung um 0,1 Prozent zurück.
Die Konjunkturexperten des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen sehen allerdings Licht am Ende des Tunnels. In ihrem jüngsten Konjunkturbericht prognostizierten sie, dass die Bruttolöhne und -gehälter bereits in diesem Jahr wieder deutlich stärker steigen werden als es die Entwicklung der Tariflöhne suggeriere. Ihre Prognose: „Nach dem kräftigen Einbruch im letzten Jahr dürften die Bruttolöhne und -gehälter mit 3,0 Prozent beziehungsweise 3,1 Prozent 2021 und 2022 anziehen.“ Da bliebe vielleicht auch nach Abzug der Inflationsrate etwas mehr übrig
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53540676-roundup-weniger-geld-am-monatsende-corona-setzt-loehne-unter-druck-016.htm
Pro-Kopf-Verschuldung steigt 2020 um gut 14 Prozent auf 26.141 Euro – DJN, 28.7.2021
Um gut 14 Prozent auf 26.141 Euro ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland per Ende 2020 gestiegen. Insgesamt summierten sich die Verbindlichkeiten des öffentlichen Gesamthaushalts mit Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte auf 2.172,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Damit wurde der bislang höchste Wert am Ende eines Jahres verzeichnet. Im Jahresvergleich weitete sich die öffentliche Verschuldung um 14,4 Prozent oder 273,8 Milliarden Euro aus.
Der Anstieg ist nach Aussage der Statistiker insbesondere bei Bund und Ländern auf die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zurückzuführen. Er setzte sich auch im ersten Quartal 2021 fort. Der Bund war Ende 2020 mit 1.403,5 Milliarden Euro verschuldet, ein Plus von 18,1 Prozent bzw 214,9 Milliarden Euro. Die Schulden der Länder sind im Vorjahresvergleich um 9,8 Prozent entsprechend 57,0 Milliarden auf 636,0 Milliarden Euro gestiegen, wobei in allen 16 Bundesländern Zuwächse verzeichnet wurden.
Am höchsten war die Pro-Kopf-Verschuldung – wie bereits im Vorjahr – mit durchschnittlich 21.723 Euro in den Stadtstaaten, wobei sie in Bremen bei 57.823 (43.921), in Hamburg bei 19.181 (18.279) und in Berlin bei 16.307 (14.773) Euro lag. Unter den Flächenländern mit einem Durchschnitt von 6.520 Euro war sie im Saarland mit 14.737 (13.989) Euro am höchsten, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 11.002 (10.609) Euro.
Trotz der hohen prozentualen Zuwächse der Schuldenstände gegenüber 2019 in Sachsen (plus 344 Prozent) und Bayern (plus 38 Prozent) war die Verschuldung dort pro Kopf mit 1.244 (279) Euro bzw mit 1.359 (987) Euro im Ländervergleich weiterhin am niedrigsten. Die Sozialversicherung war Ende 2020 mit 0,53 (0,71) Euro je Kopf der Bevölkerung verschuldet. Die Gesamtschulden haben sich wie in den Vorjahren weiter reduziert und beliefen sich auf 44 (59) Millionen Euro.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53524434-pro-kopf-verschuldung-steigt-2020-um-gut-14-prozent-auf-26-141-euro-015.htm
IG Metall warnt vor Arbeitsplatzverlagerung in Autoindustrie – Massiver Arbeitsplatzabbau im Rahmen des Klimaschutzes erwartet – Osteuropa profitiert: Verschiebung der Produktion in Best-Cost-Länder mit niedriger Kostenlast – Forderungen: Ausbau der Mitbestimmung, Recht auf mehr Qualifizierung, mehr staatliche Hilfen – dts-Nachrichtenagentur, 26.7.2021
Die IG Metall warnt vor einem massiven Arbeitsplatzabbau im Zuge verstärkter Anstrengungen beim Klimaschutz und erhebt schwere Vorwürfe gegen Teile der Automobilindustrie. „Wir beobachten, dass viele Unternehmen das Anziehen der Klimaschutzvorgaben für eine verschärfte Restrukturierung missbrauchen“, sagte Jörg Köhlinger, Leiter des wichtigen IG Metall-Bezirks Mitte, der die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland und Thüringen umfasst, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben).
Gekennzeichnet sei diese Entwicklung durch Pläne für Standort-Verlagerungen in sogenannte Best-Cost-Länder, die sich vor allem in Osteuropa befinden, so der Gewerkschafter weiter. „Wir erleben schon jetzt, dass Standorte noch einmal richtig ausgepresst werden mit neuen Schichtsystemen und Wochenendarbeit. Die Leute werden nicht weiter qualifiziert, sie sollen einfach fallen gelassen werden, weil bereits feststeht, dass der Standort in zwei, drei Jahren dichtgemacht wird“, kritisierte Köhlinger. Um einen Kahlschlag bei den Jobs vor allem bei Autozulieferern und in der Stahlbranche zu verhindern, fordert die IG Metall den Ausbau der Mitbestimmung und ein Recht auf mehr Qualifizierung sowie mehr staatliche Hilfen.
„Wir brauchen ein festgeschriebenes Recht auf Qualifizierung“, sagte Köhlinger dem RND. „Es kann nicht sein, dass ein Unternehmer nach Gutsherrenart entscheidet, wer sich qualifizieren darf und wer nicht.“ Wichtig sei außerdem, dass Qualifizierung immer vor der Entlassung kommen müsse.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53508369-ig-metall-warnt-vor-arbeitsplatzverlagerung-in-autoindustrie-003.htm
Ifo-Beschäftigungsbarometer gesunken – DJN, 28.7.2021
Die deutschen Unternehmen bremsen ihre Suche nach neuen Mitarbeitern nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sei im Juli auf 102,4 Punkte gefallen, von 103,8 Punkten im Juni, teilte das Institut in München mit. „Die Erholung auf dem deutschen Arbeitsmarkt geht weiter, wenn auch langsamer“, erklärte das Ifo-Institut.
Im Verarbeitenden Gewerbe hat das Beschäftigungsbarometer laut den Angaben einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Unter anderem die Chemische Industrie suche vermehrt Mitarbeiter. Im Dienstleistungssektor dagegen zeigte das Barometer demnach einen deutlichen Dämpfer. Insbesondere die Personaldienstleister seien skeptischer gewesen. Auch bei den Logistikern sei etwas Vorsicht eingekehrt. Im Handel hingegen nähmen die Neueinstellungen langsam Fahrt auf. Das Baugewerbe gehe von einer konstanten Beschäftigtenzahl aus.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53523334-ifo-beschaeftigungsbarometer-gesunken-015.htm
Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im Juni um 0,2 Prozent – DJN, 29.7.2021
Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland hat im Juni bei 44,7 Millionen gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts waren das saisonbereinigt 0,2 Prozent mehr als im Vormonat und auch 0,2 Prozent mehr als im Juni 2020. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt jedoch weiter erheblich unter dem Vorkrisenniveau: So waren im Juni saisonbereinigt 1,3 Prozent oder 573.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53536350-erwerbstaetigkeit-in-deutschland-steigt-im-juni-um-0-2-prozent-015.htm
Hans Bentzien: Arbeitslosigkeit in Deutschland sinkt weitaus stärker als erwartet – BA-Vorsitzender Scheele: „Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind trotz Beginn der Sommerpause weiter kräftig gesunken“ – DJN, 29.7.2021
Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im Juli weitaus deutlicher als erwartet verbessert. Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 91.000, nachdem sie im Juni um revidiert 39.000 (vorläufig: 38.000) zurückgegangen war. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ging auf 5,7 (Juni: 5,9) Prozent zurück.
Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich 22.500 weniger Arbeitslose und eine Quote von 5,8 Prozent prognostiziert. Ohne Saisonbereinigung verringerte sich die Arbeitslosenzahl um 24.000 auf 2,590 Millionen und lag um 320.000 unter dem Niveau des Vorjahresmonats.
„Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind trotz Beginn der Sommerpause weiter kräftig gesunken“, erklärte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele. Das Wachstum der Beschäftigung halte an, und die Unternehmen suchten vermehrt nach neuem Personal.
Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, lag im Juli bei 3.379.000 Personen. Das waren 294.000 weniger als vor einem Jahr.
Konjunkturelles Kurzarbeitergeld erhielten im Mai – aktuellere Zahlen liegen nicht vor – 2,23 Millionen Arbeitnehmer. Vor Beginn von Kurzarbeit müssen Betriebe eine Anzeige über den voraussichtlichen Arbeitsausfall machen. Nach aktuellen Daten zu geprüften Anzeigen wurde vom 1. bis einschließlich 25. Juli für 75.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53537892-arbeitslosigkeit-in-deutschland-sinkt-weitaus-staerker-als-erwartet-015.htm
BA-Stellenindex im Juli deutlich gestiegen – DJN, 28.7.2021
Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland im Juli weiter gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) kletterte im Monatsvergleich spürbar um 7 Punkte auf 121, wie die Agentur mitteilte. Im Vergleich zum Juli 2020, einen Monat nach dem Nachfragetiefpunkt seit Beginn der Corona-Krise, liegt der Stellenindex um 29 Punkte höher. Um 7 Punkte übertrifft er den Stand von März 2020, dem letzten Monat, bevor die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sichtbar wurden.
Im Juli gab es in allen Branchen gegenüber dem Vormonat ein Stellenplus. Nach Angaben der Agentur resultiert die Belebung zu einem großen Teil aus der positiven Entwicklung des Gastgewerbes, von Verkehr und Logistik sowie des Handels aufgrund der Öffnungen seit Mai.
Im Vorjahresvergleich habe sich in fast allen Branchen ein Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich gezeigt. So lag die Zahl der gemeldete Stellen im Gastgewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe im Juli um über die Hälfte höher. Im Bereich Information und Kommunikation, in der Landwirtschaft, bei Verkehr und Logistik, Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Handel habe der Anstieg mehr als ein Drittel betragen. Lediglich der Öffentliche Dienst sowie Banken und Versicherungen hätten ein nur einstelliges Plus beim gemeldeten Personalbedarf im Vergleich zum Juli 2020 verzeichnet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53525317-ba-stellenindex-im-juli-deutlich-gestiegen-015.htm
Hans Bentzien: Ifo: Homeoffice geht weiter zurück – DJN, 29.7.2021
Die Arbeit im Homeoffice in Deutschland ist im Juli nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts weiter rückläufig gewesen. Demnach fiel der Anteil von 28,4 auf 25,5 Prozent der Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten. „Die Menschen suchen wieder häufiger den persönlichen Kontakt im Büro“, sagt Jean-Victor Alipour, Experte für Homeoffice beim ifo Institut. Die Quote war bereits vor der Abschaffung der Homeoffice-Pflicht Ende Juni gefallen. „Wir erwarten, dass sich in Zukunft vor allem hybride Arbeitsmodelle durchsetzen werden“, sagt Alipour.
Im Verarbeitenden Gewerbe war der Rückgang bei den Getränkeherstellern (Juli: 5,3 Prozent, nach 13,7) und in der Chemieindustrie (Juli: 18,2 Prozent, nach 25,3) besonders deutlich. Auch bei den Dienstleistern fiel die Quote. Bei Fernseh- und Radiosendern kehrten besonders viele Beschäftigte ins Büro zurück. Nach 60,9 Prozent im Juni waren im Juli nur noch 36,9 Prozent zumindest teilweise im Homeoffice. Auch im Verlagswesen fiel der Wert deutlich. Im Juli waren es nur 40,3 Prozent, nach 50,4 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53535962-ifo-homeoffice-geht-weiter-zurueck-015.htm
FIRMENPLEITEN (28.7.2021) – Der deutschen Wirtschaft droht nach Expertenmeinung nach dem Auslaufen staatlicher Hilfsleistungen ein deutlicher Anstieg bei den Firmenpleiten. „Ich rechne für das kommende Jahr mit etwa 30.000 Unternehmensinsolvenzen“, sagte Biner Bähr, Partner der internationalen Kanzlei White & Case, der Rheinischen Post. Dass die Insolvenzantragspflicht zwischenzeitlich ausgesetzt gewesen sei, habe vielen geholfen, die Krise zu bewältigen. Aber durch die staatliche Hilfe verzögere sich der notwendige Strukturwandel in bestimmten Bereichen, so der Insolvenzexperte. Es bestehe die Gefahr, dass „manche sich mit dem Geld des Staates ausruhen“. (Rheinische Post)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53522290-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
ÖSTERREICH
– STATISTIK
Inflation im Juli 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 2,7%
Erzeugerpreise des Produzierenden Bereichs im Juni 2021 um 6,9% gestiegen
Konjunktur-Frühschätzung Juni 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich über Vorkrisenniveau; Transportaufkommen auf der Straße hat im 2. Quartal 2021 stark angezogen
Zweiter Pandemie-Juni bringt ein Nächtigungsplus im Vergleich zum Juni 2020, liegt aber deutlich unter Vorkrisenniveau
Kinder- und Jugendhilfe betreute 2020 38.489 Minderjährige in der Familie, 12.678 außerhalb der Familie
Fast jeder zweite Verkehrstote im 1. Quartal 2021 bei Unfällen mit Lkw
Zahl der Sterbefälle in den ersten Juli-Wochen deutlich niedriger als Ende Juni
QUELLE: https://www.statistik.at
– MELDUNGEN
Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB: BIP Ende Juli erstmals wieder knapp über dem Vorkrisenniveau – OeNB, 30.7.2021
In den Kalenderwochen 25 bis 29 (21. Juni bis 25. Juli 2021) setzte sich der leichte Aufwärtstrend der österreichischen Wirtschaft fort. Am Ende des Beobachtungszeitraums in Kalenderwoche 29 (19. bis 25. Juli 2021) lag die Wirtschaftsleistung in Österreich mit +0,6 % erstmals seit Ausbruch der COVID-19-Krise wieder knapp über dem Vorkrisenniveau, d. h. über dem Niveau der Vergleichswoche 2019. Durchschnittlich lag das BIP in den vergangenen fünf Wochen aber noch 0,6 % unter dem Vorkrisenniveau.
Maßgeblich zur Verbesserung beigetragen haben die gestiegenen Übernachtungen ausländischer Gäste in Österreich. Die Ausgaben ausländischer Gäste mit Zahlungskarten lagen in Kalenderwoche 29 „nur“ noch 15 % unter dem Vorkrisenniveau. Insbesondere Gäste aus Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Herkunftsland, zeichnen für diese positive Entwicklung verantwortlich. Auch in der exportorientierten Industrie ist in den letzten 5 Wochen ein Aufwärtstrend festzustellen. Sowohl die LKW-Fahrleistungsdaten als auch der Stromverbrauch sind leicht gestiegen. Die Industriekonjunktur entwickelt sich aber weiterhin schwächer als es die Stimmungsindikatoren signalisieren. Kapazitäts- und Transportengpässe bei Vormaterialien dürften eine stärkere Ausweitung der Produktion verhindern. Die Daten zu Bargeldeinlieferungen und Zahlungskartenumsätzen deuten auf eine Seitwärtsbewegung der realen Konsumausgaben der österreichischen Haushalte hin. Dabei wirkte der jüngste Anstieg der Inflation dämpfend auf den realen Konsum.
Beim Vergleich zur jeweiligen Vorjahreswoche ergeben sich aktuell aufgrund eines ausgeprägten Basiseffektes stark positive Wachstumsraten (grüne Linie in der Grafik, siehe methodische Erläuterungen weiter unten). In Kalenderwoche 29 lag die Wirtschaftsleistung 4,5 % über dem Wert der entsprechenden Vorjahreswoche.
Die aktuelle VGR-Schnellschätzung für das zweite Quartal 2021 weist ein Wachstum des österreichischen BIP gegenüber dem zweiten Quartal 2020 von 11,4 % aus. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 (Vorkrisenvergleich) ist das BIP jedoch noch niedriger (–3,2 %). Im Rahmen des wöchentlichen BIP-Indikators wurden Wachstumsraten von 12,1 % bzw. –2,9 % prognostiziert.
QUELLE (inkl. interaktiver Graphik): https://www.oenb.at/Publikationen/corona/bip-indikator-der-oenb.html
SIEHE DAZU:
=> Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB für die Kalenderwochen 25 bis 29 (PDF, 0,3 MB)
QUELLE: https://www.oenb.at/dam/jcr:2cd9d702-f1c0-499e-9d1b-f8abfb7f6726/woechentlicher_bip-indikator_KW_25_bis_29_2021.pdf
=> Daten zum wöchentlichen BIP-Indikator für KW 25 bis 29 (XLSX, 0,1 MB)
QUELLE: https://www.oenb.at/dam/jcr:a0f65a52-4729-4b50-a6ed-4d80b2c700b6/daten_bip-indikator_KW_25-29_2021.xlsx
=> Weekly OeNB GDP indicator: data (XLSX, 0,1 MB)
QUELLE: https://www.oenb.at/dam/jcr:a0f65a52-4729-4b50-a6ed-4d80b2c700b6/daten_bip-indikator_KW_25-29_2021.xlsx
=> Weekly OeNB GDP indicator: data (CSV, 0 MB)
QUELLE: https://www.oenb.at/dam/jcr:7c5ab44b-204d-4d45-a802-884d1019f7f5/data_on_the_weekly_GDP-indicator.csv
BIP stieg im II. Quartal 2021 um 4,3% – Schnellschätzung des WIFO: Industrie und Lockerungen prägten Konjunkturerholung – Endgültiges Ergebnis wird Ende August veröffentlicht – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 30.7.2021
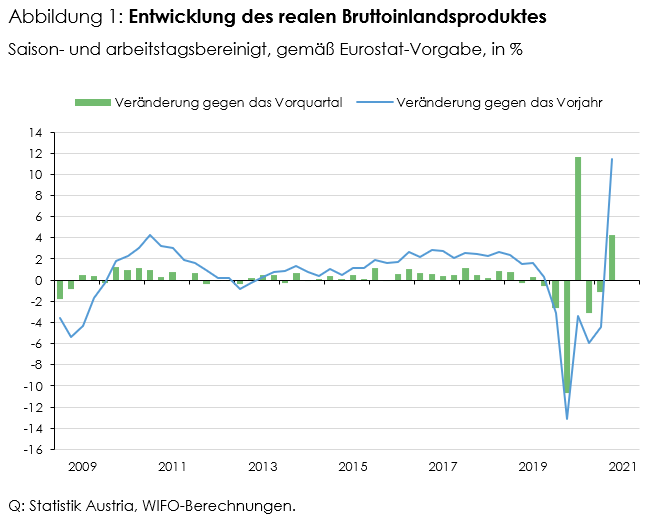
GRAPHIK: https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/images/img-db/1621537945434.png
Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO expandierte die österreichische Wirtschaftsleistung im II. Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal um 4,3%. Damit setzte nach den beiden negativen Vorquartalen erstmals wieder ein Wachstum ein. …
Mit der Lockerung der zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie gesetzten Maßnahmen Mitte Mai wurden ein Anstieg der Konsumnachfrage der privaten Haushalte sowie ein Zuwachs in der Wertschöpfung von konsumrelevanten Dienstleistungsbereichen (besonders Beherbergung und Gastronomie) verzeichnet. Die Erholung der Industriekonjunktur setzte sich im II. Quartal weiter fort.
Die wirtschaftliche Dynamik wurde im II. Quartal 2021 erneut von den gesundheitspolitischen Maßnahmen sowie deren Lockerungen Mitte Mai geprägt. Nach dem Rückgang des BIP im IV. Quartal 2020 (–3,1%) und im I. Quartal 2021 (–1,1%) erfolgte ein Anstieg der heimischen Wirtschaftsleistung im Vorquartalsvergleich. Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP im II. Quartal 2021 um 4,3% gegenüber der Vorperiode (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe). Damit lag die heimische Wirtschaftsleistung um 11,4% über dem Vorjahresquartal. Dieser kräftige Anstieg ist auch auf das sehr schwache Niveau im II. Quartal 2020 zurückzuführen. Hier haben die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie erstmals zur Gänze durchgeschlagen (–13,2%).
Mit der Aufhebung der behördlichen Einschränkungen Mitte Mai kam es zu einer kräftigen Ausweitung der Wirtschaftsleistung in den von der Krise am stärksten betroffenen Bereichen Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (+20,5% nach –9,5% im I. Quartal 2021 im Vorquartalsvergleich) sowie den sonstigen Dienstleistungen (+7,1% nach –6,3% im I. Quartal 2021, beinhaltet u. a. Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie körpernahe Dienstleistungen). Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck) stieg dazu ebenso kräftig (+3,8% nach –3,5% im I. Quartal 2021).
Nachdem die Industriekonjunktur im I. Quartal an Fahrt gewann, setzte sich die positive Dynamik im II. Quartal weiter fort. Die Wertschöpfung in der Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) stieg im II. Quartal um 2,3% (nach +2,7%). Die Bauwirtschaft stagniert auf hohem Niveau (–0,6% nach +4,8%). Auch die Investitionsnachfrage der Unternehmen entwickelte sich positiv. Die Bruttoanlageinvestitionen wurden um 2,1% ausgeweitet (I. Quartal 2021 +3,3%).
Die Reiseverkehrsexporte profitierten von der Lockerung der Reiseverkehrsbeschränkungen sowie den Öffnungsschritten in Beherbergung und Gastronomie. Vor dem Hintergrund der internationalen Konjunkturerholung stiegen auch die Warenexporte, sodass die Exporte um 14,9% über dem Vorquartal lagen. Mit einem Zuwachs der Importe von 9,8% trug der Außenbeitrag positiv zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum bei.
*** Wichtige Information ***
Seit Ende September 2020 wird die Quartalsrechnung von Statistik Austria erstellt und publiziert. Die WIFO-Schnellschätzung baut auf diese Rechnung auf und liefert eine Schätzung für das darauffolgende Quartal. Diese umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von saison- und arbeitstagsbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).
Die Daten dieser Rechnung sind eine erste Schätzung und als solche mit Unsicherheiten und einem möglichen Revisionsbedarf verbunden.
Ende August 2021 wird von Statistik Austria die Quartalsrechnung mit dem BIP und Detailergebnissen für das II. Quartal 2021 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht.
QUELLE (inkl. Tabelle und Grapik): https://www.wifo.ac.at/news/bip_stieg_im_ii_quartal_2021_um_43
Eurozone: Stresstest: Österreichs Banken „im Mittelfeld“ – Oesterreichische Nationalbank: „Ergebnis wie erwartet, aber kein Grund zum Feiern“ – WIener Zeitung/APA, 30.7.2021
Die sechs österreichischen Banken, die an den europaweiten Belastungstests von Europäischer Bankenaufsicht (EBA) und Europäischen Zentralbank (EZB) teilgenommen haben, zeigten sich in diesen Simulationen „widerstandsfähig“ und landeten „im europäischen Mittelfeld“. Das erklärten Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und Finanzmarktaufsicht (FMA) am Freitagabend in einem gemeinsamen Kommentar.
Für OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber entspricht das Ergebnis den Erwartungen der Notenbank, „es ist aber auch kein Grund zum Feiern“, wie er hinzufügte. Die Banken müssten weiter an ihrer Kosteneffizienz arbeiten, die Profitabilität verbessern und bei Gewinnausschüttungen Zurückhaltung üben, um Kapital aufzubauen.
*** Gesetzliche Kapitalanforderungen ***
Die Performance der einzelnen Banken sei heterogen, was auch an den unterschiedlichen Geschäftsmodellen liege, so OeNB und FMA. Auch wegen der staatlichen Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft seien die Aktivitäten der Banken in einigen Ländern, auch Österreich, weniger stark betroffen als in anderen.
„Alle österreichischen Banken erfüllen auch nach Anwendung des harten Stress-Szenarios die gesetzlichen Kapitalanforderungen“, betonen Notenbank und Finanzaufsicht. Der von der Aufsicht vorzeichnete Weg zur Verbesserung der heimischen Banken sei ein richtiger gewesen, das habe die Corona-Pandemie gezeigt. „Um auch für künftige Krisen gewappnet sein, muss dieser Weg fortgesetzt werden“, so FMA-Vorstand Helmut Ettl.
In die Stresstests waren 89 Banken aus dem Euroraum einbezogen. Für 38 Banken – aus Österreich Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) – läuft der Test unter Führung der EBA ab, bei den restlichen Banken (aus Österreich BAWAG, RLB OÖ, Volksbanken und Sberbank) unter Ägide der EZB. Veröffentlicht werden die Resultate aller Banken, für die erste der beiden Gruppen detailliert auf der EZB-Homepage.
Die Erste Group hat am Freitagabend selbst Ergebnisse bekanntgegeben, demnach ist sie in der Harten Kernkapitalquote (CET 1) auf 10,2 Prozent bezogen auf das Jahresende 2023 abgerutscht. Im Vergleich dazu sei die tatsächliche CET-1-Quote (Basel 3 final) zum Ausgangszeitpunkt Ende 2020 bei 14,2 Prozent gelegen, betonte das Institut. Insgesamt ändere sich die CET 1-Quote (Basel 3 final) stressbedingt somit um -401 Basispunkte gegenüber einer Veränderung um -450 Basispunkte im EBA-Stresstest 2018, so die Erste Group.
*** Basisszenario ***
Angemerkt wird von der Erste Group, dass der covidbedingte Ausblick sich im Vergleich zur Situation zu Beginn des Tests deutlich verbessert habe, was dem Basisszenario, in dem die CET1-Quote (Basel 3 final) der Erste Group im letzten Szenario-Jahr 15,4 Prozent erreiche, eine höhere Signifikanz verleihe
Den am Freitagabend von der Bankenaufsicht EBA publizierten Ergebnisse zufolge würde die harte Kernkapitalquote (CET1) der Geldhäuser in Europa insgesamt in einem simulierten Krisenszenario auf 10,3 Prozent im Jahr 2023 schrumpfen, gegenüber 15,3 Prozent 2020. Ursprünglich war der Stresstest 2020 geplant gewesen, er wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie auf heuer verschoben.
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2114699-Stresstest-Oesterreichs-Banken-im-Mittelfeld.html
ÖSTERREICH: Politik: SPÖ: Pflege mit Vermögenssteuer finanzieren – Oberösterreich-ORF, 31.7.2021
Die SPÖ Oberösterreich fordert die Einführung einer Vermögenssteuer, um damit die Pflege finanzieren zu können. Je nach Modell ließen sich laut Berechnungen des Wirtschaftsprofessors Jakob Kapeller jährlich bis zu 19 Milliarden Euro einnehmen.
1.249 Milliarden Euro – so groß ist das Gesamtvermögen in Österreich nach Berechnungen von Jakob Kapeller, der auch an der Kepler Universität Linz lehrt. Verteilt sei dieses Vermögen sehr ungleich. Demnach besitzen die oberen 10 Prozent gut 66 Prozent des Vermögens, während die unteren 50 Prozent zusammen nur 3 Prozent des Vermögens halten.
*** Ab einer Million Euro ***
Doch während sie über ihre Einkommen und ihren Konsum viele Steuern bezahlen, gibt es auf Vermögen in Österreich keine Steuern. Und das solle sich ändern, so Birgit Gerstorfer. Vermögen über einer Million Euro sollen davon betroffen sein. Besteuern will die SPÖ ab dem ersten Euro nach dieser Million.
*** Progressives Modell ***
Mit zunehmendem Vermögen sollte aber auch die Vermögenssteuer immer höher werden, fordert der Wirtschaftswissenschafter Jakob Kapeller. Ab 50 Millionen Euro seien 2,5 Prozent denkbar, für jeden Euro, den man mehr besitzt als diese Summe. Kapeller spricht sich für ein progressives Modell aus, das die besonders reichen Haushalte treffe. Mit steigendem Vermögen solle auch der Steuersatz steigen.
*** Mehr Geld für Personal ***
Je nach Modell würden damit mindestens 7 Milliarden Euro, maximal 19 Milliarden Euro pro Jahr an Vermögenssteuer zusammenkommen. Damit wäre so viel Geld vorhanden, dass die Pflege mit deutlich mehr und besser entlohntem Personal auf völlig neue Beine gestellt werden könnte, so Gerstorfer.
ÖVP: „Steuererhöhungen kommen nicht in Frage“
Steuererhöhungen kommen für ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer nicht in Frage. In einer Aussendung meinte er, der von der SPÖ-Landesvorsitzenden Birgit Gerstorfer vorgeschlagene Weg sei nicht jener der ÖVP, da eine Erhöhung der Steuerlast Gift für Wachstum, Beschäftigung und Zuversicht wäre. Die SPÖ-Vorsitzende solle auf dem Weg aus der Krise nicht auf Klassenkampf setzen, sondern den oberösterreichischen Weg von Zusammenarbeit und Zusammenhalt mitgehen.
* Grüne: „Arbeitsbedingungen verbessern“*
Die Grüne Gesundheitssprecherin Ulrike Schwarz meint zu den Plänen der SPÖ, dass das Geld zwar eine wichtige, aber nicht die einzige Rolle für die Zukunft der Pflege spiele. Denn um mehr Interessierte für den herausfordernden Pflegeberuf zu gewinnen, müssten nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Arbeitsbedingungen und damit die Attraktivität dieses Berufs verbessert werden. Und genau das werde unter Minister Wolfgang Mückstein mit der kommenden Pflegereform in Angriff genommen, so die Grüne Gesundheitssprecherin Ulrike Schwarz in einer Aussendung.
QUELLE: https://ooe.orf.at/stories/3114948/
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER
Daniel Gros: Wirtschaftspolitischer Graben zwischen EU und USA – Die EU und die USA driften wirtschaftspolitisch auseinander. Das dürfte den Dollar stärken und Europas Abhängigkeit steigern – Finanz & WIrtschaft, 26.7.2021
Nun, da Europa endlich beginnt, bei der Impfung seiner Bevölkerung gegenüber den USA aufzuholen, scheinen beide Seiten des Atlantiks auf eine starke wirtschaftliche Erholung zuzusteuern. Doch entwickelt sich ihre makroökonomische Politik in einer Weise auseinander, die in der Zukunft ernste Probleme hervorrufen könnte.
Die Fiskalpolitik geht bereits in unterschiedliche Richtungen. Die USA steuern für zwei Jahre (2020 und 2021) auf ein Defizit im öffentlichen Sektor von rund 15% des BIP zu. Das Defizit des kommenden Jahres bleibt abzuwarten, doch es auf einen einstelligen Wert zu drücken, wäre eine beispiellose Kontraktion. Ergänzt man dies um Präsident Joe Bidens vorgeschlagenen «American Jobs Plan» im Volumen von zwei Billionen Dollar – über den seine Regierung noch immer mit dem Kongress verhandelt –, so erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die USA ihre Fiskalpolitik 2022 plötzlich straffen werden.
In der Eurozone haben die Regierungen ihre Ausgaben während der Covid-19-Krise ebenfalls gesteigert, doch nicht annähernd so stark. Die zusätzlichen Ausgaben belaufen sich 2020 und 2021 auf 7 bis 8% des BIP – das ist prozentual nicht wenig, aber doch nur halb so viel wie in den USA.
*** Zurück zur Besonnenheit ***
Darüber hinaus soll das Defizit laut der Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission vom Frühjahr 2021 im kommenden Jahr auf 4% des BIP sinken – was vermutlich erneut halb so viel wie in den USA wäre. Die meisten europäischen Länder planen, rasch zu jener Besonnenheit zurückzukehren, die die Eurozone in die Lage versetzt hat, 2019 ein Durchschnittsdefizit von nahezu null zu erreichen.
Auf den ersten Blick mag diese Auseinanderentwicklung in der Fiskalpolitik verblüffen. Schliesslich werden die USA als Erste wieder ihr BIP von vor der Krise erreichen, was nahelegt, dass sie Konjunkturimpulse weniger nötig haben. Ein genauerer Blick jedoch zeigt den Grund für diese Auseinanderentwicklung – nämlich die Ausrichtung der Haushaltsausgaben.
In den meisten europäischen Ländern stellte Kurzarbeitergeld den Unternehmen die Mittel zur Verfügung, die sie brauchten, um ihre Arbeitnehmer weiterzubeschäftigen, selbst wenn diese aufgrund der öffentlichen Gesundheitsmassnahmen über Monate hinweg kaum etwas zu tun hatten. Die US-Regierung dagegen stellte allen unter einem gewissen Einkommensniveau Schecks aus, unabhängig davon, ob sie ihre Arbeitsplätze behielten oder nicht, und sie erhöhte zusätzlich das Arbeitslosengeld.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Ansätze beeinflusste die Pandemie die europäischen und US-Arbeitsmärkte auf unterschiedliche Weise. In Europa war die Lage nicht besonders turbulent: Obwohl die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden deutlich sank, erhöhte sich die erfasste Arbeitslosigkeit um nicht einmal einen Prozentpunkt.
In den USA fiel die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in ähnlichem Umfang, doch die Arbeitslosigkeit war alles andere als stabil. Dutzende Millionen Arbeitnehmer wurden mit Beginn der Lockdowns Anfang 2020 entlassen. In den letzten Monaten wurden angesichts der Impffortschritte und gelockerter Beschränkungen Millionen wieder eingestellt. Doch rund sieben Millionen Arbeitsplätze müssen noch neu besetzt werden, bevor die US-Wirtschaft zur Vollbeschäftigung zurückkehrt.
Die USA und Europa verfolgen zudem unterschiedliche geldpolitische Ansätze. Natürlich bleibt die Geldpolitik offiziell weiterhin überall enorm locker. Doch die Rahmenbedingungen – und die tatsächliche Politik – beginnen sich auseinanderzuentwickeln, nun da sich die Notenbanken entschieden haben, wann und wo sie anfangen werden, die Geldpolitik zu straffen.
Das US Federal Reserve plant, weiter eine sehr lockere Politik inklusive grosser Wertpapierankäufe zu verfolgen, bis die tatsächliche Inflation ihren Zielwert von annähernd 2% überschreitet. In einem gewissen Sinn wurde diese Linie bereits überschritten: Die Gesamtinflation liegt bereits bei über 4%, und selbst die Kerninflation (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) hat vor kurzem 3% überschritten. Doch geht das Fed davon aus, dass dieser Anstieg vorübergehend ist, deshalb will sie ihre Politik nicht sofort straffen. Sie hat offiziell erklärt, sie würde «die Beschäftigungsdefizite … gegenüber dem Höchstniveau abmildern» – was bedeutet, dass sie die Wirtschaft «heisslaufen» lassen wird.
Doch stehen die Massnahmen der Fed mit ihrer offiziellen Linie nicht so recht im Einklang. Der jüngste «Dot-Plot», der die Erwartungen der Mitglieder des Offenmarktausschusses an die künftige Zinsentwicklung abbildet, legt nahe, dass die Zinsen bereits Anfang nächsten Jahres steigen könnten. Schon jetzt hat das Fed diskret begonnen, die Geldpolitik zu straffen.
In den letzten Monaten hat das Fed eine grosse Anzahl an Rückkaufoperationen getätigt. Dabei hat es Termingeschäfte über den Verkauf von Schatzanleihen im Volumen von rund 800 Mrd. $ abgeschlossen – viel mehr, als es am Kassamarkt gekauft hat. Anders ausgedrückt: Ein Arm des Fed konterkariert durch umgekehrte Pensionsgeschäfte faktisch die Anleihenkäufe des anderen Arms. Dieser Ansatz versetzt das Fed in die Lage, zu behaupten, dass es die Geldpolitik in einer Zeit weiterhin hoher Arbeitslosigkeit nicht strafft, auch wenn es faktisch genau dies tut.
Die Diskrepanz zwischen der offiziellen Haltung des Fed und seiner tatsächlichen Politik hat die Unsicherheit über die künftige Inflationsentwicklung in den USA naturgemäss verstärkt. Einige Finanzmarkt-Kennzahlen geben die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation die 3%-Marke während der nächsten fünf Jahre übersteigen wird, inzwischen mit fast 40% an.
*** Weitere Anleihenkäufe ***
Die Europäische Zentralbank bleibt dagegen der Preisstabilität verpflichtet. Auch wenn die Gesamtinflation im Mai erstmals seit Jahren 2% erreicht hat, verharrt die Kerninflation weiterhin unter 1%. Da die EZB das Ziel einer Inflation von annähernd 2% verfolgt, hat sie kaum eine andere Wahl, als weitere Anleihen zu kaufen.
Während die Fiskal- und die Geldpolitik technisch gesehen auf beiden Seiten des Atlantiks expansiv bleiben, befinden sich die USA und die Eurozone inhaltlich eindeutig auf unterschiedlichem Kurs. Während die USA eine expansive Fiskalpolitik verfolgen, aber verstohlen eine Straffung der Geldpolitik betreiben, ist die Eurozone eifrig darum bedacht, zur Haushaltsdisziplin zurückzukehren, aber weiterhin eine lockere Geldpolitik zu verfolgen.
Für sich genommen ist diese Auseinanderentwicklung nicht besonders berichtenswert. Niemand ist schockiert, zu hören, dass Unterschiede bei der Wirtschaftslage und den Prioritäten zu unterschiedlichen Ansätzen führen. Doch sollte man die potenziellen längerfristigen Auswirkungen nicht unterschätzen. Wenn beide Volkswirtschaften ihren Kurs beibehalten, wird das den US-Dollar stärken, Amerikas Tendenz zu grossen externen Defiziten verstärken und das Wachstum in Europa noch exportabhängiger machen. Dies ist ein Rezept für Handelsspannungen – und für ein abruptes Ende des transatlantischen Honeymoons der Biden-Ära.
DANIEL GROS ist Vorstandsmitglied und Distinguished Fellow des Centre for European Policy Studies.
Copyright: Project Syndicate
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/wirtschaftspolitischer-graben-zwischen-eu-und-usa/
Bert Rürup: Wirtschaftswachstum Deutschlands 2021 bei erwarteten 2,7 Prozent – Die vierte Corona-Welle baut sich auf – Mangel an elektronischen Bauteilen wird immer schlimmer – Inflationsgefahr? Höchste Inflation seit 1993 – Teuerung bei Vorprodukten, doch kein markanter Lohnschub in Sicht! – Der Chefökonom / HANDELSBLATT, 30.7.2021
Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal des Jahres um 1,5 Prozent gewachsen – „nur“, möchte man hinzufügen. Denn damit wurde der Einbruch um 2,1 Prozent in den ersten drei Monaten nicht wettgemacht.
Laut amtlicher Schnellschätzung trugen vor allem höhere private und staatliche Konsumausgaben im Frühjahr zum Wachstum bei – die übrigen Komponenten wie Außenhandel und Investitionen also offenbar nicht. Bankvolkswirte hatten im Vorfeld im Mittel mit rund zwei Prozent Wachstum gerechnet. Die Startrampe für das zweite Halbjahr ist also merklich niedriger als erwartet.
*** Die vierte Corona-Welle baut sich auf ***
Weit wichtiger als dieser Blick zurück ist jedoch der Blick nach vorne. Und der sieht zwar nicht richtig schlecht, aber keineswegs so rosig aus, wie mancher der Konjunkturauguren noch vor wenigen Wochen prognostiziert hat. Die vierte Corona-Welle baut sich gerade auf, und der Mangel an elektronischen Bauteilen wird immer schlimmer.
„Die Auswirkungen der Engpässe bei Halbleitern konnten wir bislang begrenzen, rechnen jedoch mit etwas deutlicheren Effekten im dritten Quartal“, sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz. Der Konzern dürfte den Mangel besonders im September zu spüren bekommen; denn im August ruht die Produktion in vielen Fabriken wegen Werksferien.
Angesichts dieser Unwägbarkeiten fühlt sich das Handelsblatt Research Institute sich mit seiner Frühjahrsprognose von 2,7 Prozent Wachstum in diesem Jahr gut aufgestellt.
*** Höchste Inflation seit 1993 ***
Ein weiteres Risiko sind die rasant steigenden Preise. Für Juli meldete das Statistische Bundesamt 3,8 Prozent Inflation für Deutschland. Das war der höchste Wert seit 1993.
Sicher, ein Teil dieser Preissteigerung ist auf Sondereffekte wie die temporäre Mehrwertsteuersenkungen im zweiten Halbjahr 2020 zurückzuführen. Der rekordverdächtige Anstieg der Importpreise im Juni um fast 13 Prozent zeigt jedoch, dass vor allem die Notierungen an den globalen Rohstoff- und Vorleistungsmärkten förmlich explodiert sind.
*** Teuerung bei Vorprodukten ***
Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis diese Teuerung bei Vorprodukten an die Verbraucher weitergereicht wird. Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht die Inflation zum Jahresende „in Richtung fünf Prozent gehen“. Der künftige Pfad sei „unsicher“.
Mal schauen, wann diese Zahlen auch im EZB-Tower zur Kenntnis genommen werden. Bislang muss man dort nach Hinweisen, die auf Änderungen der Geldpolitik hindeuten könnten, mit der Lupe suchen.
*** Keine Lohn-Preis-Spirale in Sicht ***
Für eine längerfristige Verhaftung der Inflationsrate über zwei Prozent, dem neuen Inflationsziel der EZB, müssten die Löhne kräftig steigen. Dies ist nach Lage der Dinge nicht zu erwarten.
Denn nach Schätzungen des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung wird in 2021 erstmals seit zehn Jahren die um die Preissteigerung bereinigte reale Tariflohnentwicklung leicht negativ ausfallen.
In den vergangenen zwei Dekaden gab es lediglich drei Jahre, in denen die Tariflöhne langsamer als die Preise stiegen, nämlich 2006, 2007 sowie 2011. Ein markanter Lohnschub ist nicht in Sicht.
QUELLE: nicht verlinkbar.
Martin Greive: Nachgefragt – 30. Juli 2021: Steuern eines Millionärs: „Oh, das ist schon wenig“ – Der Millionär Ralph Suikat fordert höhere Steuern für Reiche. Geld geselle sich wie bei ihm zu Geld – während einfache Arbeiter höher besteuert würden als er – Der Chefökonom / HANDELSBLATT, 30.7.2021
Ralph Suikat gründete und führte über 20 Jahre das Softwareunternehmen STP. 2016 verkaufte er
STP, seitdem ist sein Konto ordentlich gefüllt. Suikat ist Millionär und findet, als solcher zahle er
viel zu wenig Steuern. Vor der Bundestagswahl hat Suikat daher den Appell „taxmenow“ ins Leben
gerufen. 40 Millionäre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich der Initiative
angeschlossen und plädieren für höhere Steuern für Vermögende.
F: Herr Suikat, viele Gutverdiener schimpfen über hohe Steuern. Sie dagegen flehen die Politik an,
Vermögende wie Sie höher zu besteuern. Warum?
A: Wir haben in Deutschland eine krasse Ungleichverteilung von Vermögen. Das ist nicht nur schlecht
für den ärmeren Teil der Bevölkerung, sondern für das ganze Land. Das reichste ein Prozent der
Bevölkerung besitzt zwischenzeitlich 35 Prozent des gesamten Vermögens in Deutschland. Die
ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen gerade einmal ein halbes Prozent des Gesamtvermögens finden Sie das gerecht?
F: Was denken Sie, wenn Sie Ihre eigene Steuererklärung anschauen?
A: Ich denke: Oh, das ist schon wenig. Das war nicht immer so. Schaut man sich die Historie an, fällt
auf, dass die Steuern, die Vermögende betreffen, sukzessive gesenkt wurden. Als ich zusammen mit
meinem Geschäftspartner 1993 unser Unternehmen gegründet hatte, lag der Spitzensteuersatz bei
53 Prozent. Das war völlig okay und hat auch damals niemanden vom Gründen eines Unternehmens
abgehalten.
F: Warum zahlen Sie so wenig?
A: Mein wesentliches Einkommen sind Kapitaleinkünfte, und die werden nur mit 25 Prozent plus Soli
besteuert. Immobilienvermögen spielt bei mir keine große Rolle, aber das ist ja häufig nach zehn
Jahren komplett steuerfrei gestellt. Menschen, die sich mit ihrer Hände Arbeit abrackern, zahlen
dadurch prozentual höhere Steuern als Vermögende, die nur ihr Geld arbeiten lassen. Das ist doch
nicht gerecht.2
F: Sie sagen, die soziale Schere gehe immer stärker auseinander. Woran machen Sie das fest?
A: Vermögen in Deutschland stammt inzwischen zu zwei Dritteln aus Erbschaften. Gleichzeitig
müssen in Deutschland zehn Millionen Menschen für weniger als zwölf Euro arbeiten gehen,
kämpfen aber mit steigenden Mieten. Viele Menschen können gar nicht daran denken, Vermögen
aufzubauen, geschweige denn Wohneigentum zu bilden. Und selbst wenn die Facharbeiterin 10.000
Euro auf dem Konto hat, zahlt sie darauf bald vielleicht auch noch Minuszinsen. Ohne Erbschaft
wird es immer schwieriger, ein Vermögen aufzubauen. Ein großes Vermögen hat ganz andere
Anlagemöglichkeiten und Renditen.
F: Mögen Sie uns verraten, wie sich Ihr Vermögen rentiert?
A: Allein mein Aktiendepot hat im Corona-Jahr 2020 fast 34 Prozent Rendite erbracht, in der ersten
Jahreshälfte 2021 schon wieder über 15 Prozent. Geld gesellt sich zu Geld. Wir müssen unbedingt
diese Schere wieder schließen und den in Deutschland geschaffenen Wohlstand gerechter verteilen.
F: Viel Geld bedeutet auch viel Macht. Manche sehen darin inzwischen eine Gefahr für die
Demokratie, insbesondere in den USA. Sie auch?
A: Hier gibt es diese Machtkonzentration auch, vielleicht ist sie auf den ersten Blick nicht so deutlich
sichtbar. Lobbyverbände wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) oder die Stiftung
Familienunternehmen machen zum Beispiel Stimmung gegen die Besteuerung von Vermögenden,
egal ob Erbschaft- oder Vermögensteuer. Wenn die INSM wie kürzlich eine millionenschwere
Anzeigenkampagne schaltet, in der sie Annalena Baerbock als eine Art Verbots-Moses darstellt,
trägt dies natürlich zur Verunsicherung von Wählern bei. Der Ab- und Rückbau von Steuern für
Vermögende in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland zeigt doch überdeutlich, wie
wirtschaftliche Macht die Politik zu ihren Gunsten beeinflusst.
F: Was sagen Ihre Millionärsfreunde zu Ihrer Forderung nach einer Vermögensteuer?
A: Es gibt viele, die finden, sie machten genug, bei diesen ernte ich zunächst Verwunderung. Auch hat
bei manchen von ihnen die Argumentationskette, eine Vermögensteuer zerstöre den Mittelstand und
wir müssten dann alles an die Chinesen verkaufen, zunächst verfangen. In Diskussionen haben sich
bisher alle sehr interessiert an den tatsächlichen Fakten und vor allem der Idee dahinter gezeigt.
Und nicht wenige ihre Meinung geändert. Viele Unternehmer finden auch, der Staat gehe mit seinen
Einnahmen nicht sorgsam genug um. Den Punkt wiederum kann ich in Teilen nachvollziehen. Hier
muss der Staat deutlich effizienter und müssen Politiker ehrlicher werden.
F: Laut Wirtschaftsverbände würde eine Vermögensteuer in der Spitze zu einer Steuerbelastung von
60 Prozent für Firmen führen. Ist das in Corona-Zeiten nicht gefährlich?
A: Natürlich dürfen Unternehmen durch eine Vermögensteuer nicht in Schieflage geraten. Aber wir
können zum Beispiel über Freibeträge kleinere Unternehmen komplett von der Steuer ausnehmen.
Und die großen Unternehmen sind in der Regel ertragsstark genug, sodass die Vermögensteuer aus
den Dividenden bezahlt werden kann. Wir müssen zu mehr Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit
kommen, ohne den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Das ist mit intelligenten Steuerkonzepten,
die Freibeträge, Stundungen und Öffnungsklauseln beinhalten, definitiv möglich.
F: Es stellt sich auch die Frage nach Aufwand und Ertrag. Der Fiskus muss bei einer Vermögensteuer
alle Vermögenswerte erfassen, bis hin zum Ferrari und Picasso. Ist das nicht Wahnsinn?
A: Es gibt Wege, den Aufwand gering zu halten und auch Bewertungsspitzen abzufedern. Wir können
zum Beispiel ein rollierendes Besteuerungsverfahren einführen, welches sich auf den
Durchschnittswert des Vermögens der letzten drei Jahre bezieht. Und ein Vermögender weiß ja
meist, was sein Unternehmen wert ist, auch sein Ferrari und sein Picasso, um im Klischee zu
bleiben. Er könnte beispielsweise mit seinem Steuerberater selbst eine Bewertung vornehmen, und
ein Betriebsprüfer macht später Stichproben.
F: Das klingt aufwendig …
A: Darüber hinaus bieten Start-ups an, den Wert von Immobilien zumindest grob innerhalb weniger
Minuten zu berechnen. Wir reden immer von Digitalisierung und sollten diese auch im Kontext
einer Vermögensteuer intelligent nutzen. Wenn wir in einem Jahr einen Impfstoff gegen Corona
entwickeln, werden wir es auch schaffen, ein intelligentes und schlankes Steuermodell für
Vermögende zu entwickeln.
F: Wie soll der Staat die Einnahmen aus Vermögensteuern einsetzen?
A: Die Vermögensteuer fällt den Bundesländern zu, die unter anderem für Bildung zuständig sind.
Mehr Geld könnte auch in die Infrastruktur fließen. Und ich finde den Vorschlag sehr interessant,
jedem Bürger mit Erreichen des 25. Lebensjahres eine staatliche „Erbschaft“ von zum Beispiel
125.000 Euro zukommen zu lassen. Mit dieser Summe könnte tatsächlich der häufig geforderte
Vermögensaufbau für alle betrieben werden. Grundsätzlich ist uns aber der demokratische
Grundgedanke wichtig, Mehreinnahmen durch gewählte Volksvertreter zu verteilen.
QUELLE: 3-Seiten-PDF