Views: 110
Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie letzte Woche ebenso – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball „supertoll“ geht: eine Erfolgsmeldung jagt die andere. Auch die Jagd an den Börsen geht weiter: höher, immer höher – the trend is your friend.
Dazu bekommt der brave Leser, die fleißige Leserin freihaus einen COMMENT:
Der Umwelt tut das forcierte Wirtschaftswachstum nicht gut: wir kurbeln mit Schulden den Konsum an, verschleudern dabei Ressourcen und heizen Mutter Erde ordentlich ein – auf die Dauer uns selbst.
Austerität? Welch‘ Schreckenswort! Nie und nimmer, da sei der Teufel vor. Hieß es. Heißt es. Das geht nun so seit Jahrzehnten – mit Keynes als Gewährsmann: kein Jahr ohne eine „alternativlose Staatsintervention“: der Staat als Investor muss dringend her, um dieses und jenes zu retten – und – pscht! nicht verraten! – um Wahlzuckerln zu finanzieren, wie gehofft wurde. Welch‘ trügerische Hoffnung.
BIP auf Pump hieß es letzte Woche hier in Frageform. Konsum auf Pump, Arbeitsplätze auf Pump, Klimawandel – jawohl: auch das auf Pump. Nun rächt sich – zumindest sehe ich das so – dieses Aufpumpen und Inflationieren des Konsums. So sozial war also die Idee mit dem Rezept des Vermögensverwalters und Börsenspekulanten Keynes vielleicht doch nicht.
Freundschaft? Solidarität? Humanität? Soziale Gerechtigkeit? Hehre Begriffe. Fürchterlich drohendes Ergebnis. Irgendwer schrieb da doch etwas vom Weg in die Knechtschaft, wenn auch in anderem, ähnlichem Kontext; die Zeit schritt voran. Auf dem Weg in die Knechtschaft befinden wir uns, so glaube ich, schon, der Digitalisierung sei Dank. Und das aber nicht erst seit gestern. New Monetary Theory als Hebel der Erdausbeutung und Knechtung der Massen? Wirtschaftswissenschaftler als Hybris-befangene Zauberlehrlinge der modern-wissenschaftlichen Art: wo aber bleibt der rettende Zauberer?
Und wohin gehen wir als Menschen, in welche Zukunft? Wohl bekomm’s!, möchte man sagen. Aber der Wunsch bleibt im Halse stecken: wohlbekömmlich dürfte das wissenschaftlich entworfene, von Politik-Handwerkern eifrig gezimmerte Gebäude nicht sein.
Respektvoll-behutsame Sparsamkeit in Selbstbeschränkung? Davon sind wir – schon der politisch alternativlosen Notwendigkeiten, wie es im Chor lautstark tönt – meilenweit entfernt. Die Angst vor der aufgebrachten Masse und dem Stimmenverlust bei der nächsten Wahl treiben. Wohl bekomm’s!
IN DEN VORDERGRUND schoben sich Fragen der Cybersicherheit, aufs Medienschild gehoben durch einen weltweit spürbaren Hackerangriff; in den Fokus rückten abermals Vermögensungleichheit samt Steuervorschlägen: die Staatsschulden drücken; weiters die steigenden Immobilienpreise weltweit und zunehmend notleidende Kredite; die Umwelt, wie sie weiter still, aber klimawirksam vor sich hin leidet, unverdrossen angeheizt durch politischen Interventionismus: Müll und Zwangsarbeit als Zoll; in den Fokus rückten auch die „gerechten“ Unternehmenssteuern weltweit und die abgezockten „kleinen Leute“ kongenial dazu; ebenso Frau Lagardes grüne EU-Kapitalmarktlandschaft, aber was nachhaltige Investments sind, bleibt unklar. Ach ja, dass ich nicht vergess: die Inflation. Die Türkei führt es vor, was Inflation für den kleinen Mann und die kleine Frau bedeuten.
ÜBERSICHT
- CYBERSICHERHEIT – INTERNETKRIMINALITÄT
- Wie der russische Militärgeheimdienst seit Monaten versucht, in die IT-Systeme von Behörden und Firmen einzudringen
- Rätselhafte Cyberattacke auf führenden IT-Anbieter in den USA legt weltweit IT lahm – Lösegeldforderungen: Ransomeware legt Dienstleister lahm – Womöglich tausende Dienstleister betroffen, unter anderem das schwedische Bahnunternehmen SJ, COOP Schweden, ein deutscher IT-Dienstleister => USA
- Nach Angriffen im letzten Jahr und heuer im Mai auf diverse US-Firmen: Cyberattacke auf US-IT-Firma – Russlan im Visier => USA
- Das Schweizer Stromnetz ist völlig ungenügend gegen Cyberangriffe geschützt => SCHWEIZ
- Ransomeware legt Kassen lahm: COOP-Filialen in Schweden nach Hackerangriff geschlossen – Schwedisches Bahnunternehmen SJ-AB ebenso betroffen => SCHWEDEN
- Wie lange dauert es, bis ein Hacker Ihr Passwort knackt? Fünf Tipps für ein sicheres Kennwort
UMWELT - CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 um elf Prozent gestiegen
- Erneuerbare Energien – Zwangsarbeit in China: Deutsche Solarbranche ist in Erklärungsnot –
Deutsche Anbieter sind auf chinesische Lieferanten angewiesen, die wegen Zwangsarbeit in Verruf geraten sind. US-Sanktionen erhöhen nun den Druck - Kunststoff Innovative Verpackungen: Es geht auch ohne Plastikmüll
Der Druck auf Konsumgüterhersteller steigt, nachhaltige Verpackungen einzuführen. Doch Alternativen wie Flaschen aus Papier haben ihre Tücken
VERMÖGENSUNGLEICHHEIT – VERMÖGENS-/ERBSCHAFTSSTEUER - Ungleiche Vermögensverteilung: Besserverdiener erben mehr – Menschen mit höherem Einkommen und mehr Vermögen erben in Deutschland deutlich mehr als Geringverdiener. Rentenlücken lassen sich durchs Erben deshalb kaum ausgleichen
- ‚Wer hat, dem wird gegeben‘ – Besserverdiener erben in Deutschland mehr
- IW: Vermögen des reichsten Prozents steckt überwiegend in Betrieben
- Studie des Verbandes der bayrischen Wirtschaft: Vorurteilen der Vermögensungleichheit auf der Spur / Brossardt: „Altersvorsorgeanwartschaften reduzieren Vermögensungleichheit um über 20 Prozent“ – Stabile Ungleichheit in Deutschland seit 2002 – Größere Ungleichheit in Ländern mit ausgedprägtem sozialem Sicherungsnetz – Vorschläge zur Förderung von privatem Vermögen – Einkommens-Ungleichheit in Deutschland seit 2005 stabil: sinkender Anteil der Mindestsicherungsbezieher*innen
- Steuerdebatte Vermögensverteilung in Deutschland: Weniger ungleich als gedacht – SPD, Grüne und Linke wollen die Vermögensteuer wieder einführen. Doch laut einer Studie ist die Vermögensungleichheit geringer als behauptet
- Wird man mit einem hohen IQ reich? Die Antwort überrascht: Der Zusammenhang ist schwach ausgeprägt – Entscheidend ist auch das Geburtsland
- Anderl: Eine Millionärssteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit => ÖSTERREICH
- Die reichsten Österreicher 2021: Milliardäre & Clans => ÖSTERREICH
INTERNATIONAL - Mehr Fairness: 130 Länder einigten sich auf Mindeststeuer – Anpassung an das Digitalzeitalter: Weltweit tätige Unternehmen sollen mindestens 15 Prozent Steuern zahlen
- COMMENT: Wie schön und gerecht – und alle Finanzminister dieser Welt waren sich nach dem G7-Vorschlag sofort einig: …
- Hans Bentzien: BIZ: weltweit lässt Corona Hauspreise ungewöhnlich stark steigen – Pandemie als Mitursache: veränderte Wohnpräferenzen, Niedrigzinspolitik – Anfälligkeit für größere Korrekturen am Immobilienmarkt: Langsamerer Anstieg der Mieten als jener der Hauspreise, stärkerer bei Hypothekarzinsen und Anleiherenditen – Ursache der Vermögensungleichheit laut BIZ zu simpel beurteilt: Messung von Vermögensungleichheit schwerer als die von Einkommensungleichheit, Anleihekäufe in Frankreich und Deutschland haben Vermögensungleichheit nicht deutlich vertieft
- Digitalisierung: Weltweit rechnen Manager mit dem Ende der Bankfilialen bis 2026
BÖRSEN - SENTIX-Sentiment: Da passt was bei den Anleihen nicht zusammen; Öl und China als Trigger für eine Korrektur?
- Nachhaltigkeitsstandards: Globale Aufseher wollen Anleger vor „Greenwashing“ schützen – ESG-Kriterien bei Anlegern zunehmend an Bedeutung. Doch Aufseher sind besorgt, was die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Informationen angeht
- Morgen Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs: Milliarden für die Aktionäre: US-Banken schütten großzügig Kapital aus
- US-Börsen – Wie 13 Amateure zu Superinvestoren wurden – und was dies mit den derzeitigen Börsen-Rekordständen zu tun hat – Nur wenn der Trend gefestigt ist: Trendfolgestrategie als Mittel zum Börsenerfolg
- Wiener Börse: Aufschwung am österreichischen Aktienmarkt sorgt im 1. Halbjahr weiter für hohe Aktienumsätze * ATX Total Return erreichte Allzeit-Hoch im Juni – Aktienumsatz mit 39 Mrd. EUR im 1. HJ 2021 stabil auf Vorjahresniveau – Drei Neuzugänge im direct market plus – Rekordstand bei Anleihen-Neulistings
ZENTRALBANKEN
– USA / FED - IWF empfiehlt: US-Notenbank soll Mitte 2022 mit Tapering beginnen
– EUROPÄISCHE UNION / EZB - Systemrisikorat (ESRB) warnt vor mehr Unternehmensinsolvenzen und NPL – erste Anzeichen für einen Anstieg der notleidenden Kredite (Non-performing Loans – NPL)
- EZB/Enria beklagt hohe Risikoneigung von Banken bei der Kreditvergabe an hoch verschuldete Unternehmen – ColateraIized Loan Obligations mit mmer weniger Covenants: abnehmende Verhaltenseinschränkungen von Kreditnehmern und somit abnehmender Schutz der Investoren – Jagd nach Rendite verbreitert Investorenbasis, direkte Bankenexposition gesunken, indirekte hingegen gestiegen – Zunehmend im Fokus der Bankenaufsicht: Banken mit verstärktem Engagement im Leveraged-Loan-Geschäft
- EZB-Präsidentin Lagarde sieht noch keinen nachhaltigen Aufschwung – Inflationsanstieg ist nur vorübergehend
- EZB/Lagarde sieht Chance grüner Kapitalmarktunion im Euroraum
- Lagarde: Board des Systemrisikorats (ESRB) könnte Empfehlung zu Dividendenverzicht zurücknehmen – Beratung dazu am 23.9.2021
- Angeloni: EZB-Reaktion auf fiskalische Notlagen erleichtern – Kooperation mit Regierungen nötig: neue Spannungen im Euroraum, wenn Anleihekäufe auslaufen – Angeloni: Politische Unabhängigkeit bleibt trotz Zusammenarbeit mit Regierungen gewahrt – EZB-Direktor Fabio Panetta: EZB dauerhaft eine gezielte Beeinflussung der Staatsanleihezinsen einzelner Euro-Länder ermöglichen
- EZB/Enria: Output Floors auf konsolidierter Ebene anwenden – Gegenwärtiger Versuch vor allem der deutschen und französischen Bankenindustrie, in Brüssel eine möglichst schonenden Umsetzung von Basel 3 in europäisches Recht zu erreichen
– ÖSTERREICH / OeNB - Forschungsprojekt erkundet Blockchain-Technologie für Anleiheemissionen und Abwicklung in Echtzeit mit Wholesale CBDC
USA - Defizit in der US-Handelsbilanz stärker als erwartet gestiegen – Exporte stiegen zum Vormonat um 0,6 Prozent, die Einfuhren um 1,3 Prozent
- Conference Board: Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im Juni auf – Verbrauchervertrauen auf höchstem Stand seit Corona-Pandemie-Beginn März 2020 – Aktuelle und künftige Lage werden besser eingeschätzt – Kurzfristige Inlfationserwartung gestiegen, keine Auswirkung auf künftige Kaufabsichten
- Die Supershopper werden immer optimistischer
- CBO rechnet mit 2021 mit höheren Wachstum, Inflation, Defiziten
- Auftragseingang der US-Industrie im Mai um 1,7 Prozent zum Vormonat gestiegen – Langlebige Güter: plus 2,3 Prozent
- Über der Wachstumsschwelle: Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Juni von 75,2 auf 66,1 Punkte zurück
- Weiteres Wachstum erwartbar: ISM-Index für US-Industrie fällt im Juni von 61,2 auf 60,6
- US-Industrie zeigt im Juni konstante Tendenz: IHS Markit Einkaufsmanagerindex verharrte wie im Mai bei 62,1 Punkten
- USA fallen bei E-Auto-Fertigung weiter hinter China und Europa zurück
- US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet
- USA: Bauausgaben sinken überraschend
- Weitere Beschleunigung: US-Immobilienpreise ziehen um 14,9 Prozent im Jahresvergleich weiter an – Case-Shiller-Index – So stark wie seit 30 Jahren nicht mehr: S&P sieht außergewöhnliche Hauspreisentwicklung – Boomender Häusermarkt dank Niedrigzins, geänderte Wohnpräferenzen, Wohnbedarf und sicherheitsbedingte Immobiliennachfrage – Kongeniales Zusammenwirken: Homeoffice und Wegzug aus Städten ins Grüne
- Rekordjagd setzt sich fort: US-Häuserpreise steigen immer stärker – FHFA: starke Nachfrage treibt, unterstützt von Niedrigzins und Häusermangel
- USA: Schwebende Hausverkäufe legen auf Jahres sicht auf 13,1 Prozent, auf Monatssicht auf 8,0 Prozent kräftig zu
- USA: Stundenlöhne steigen wie erwartet
- Commerzbank: US-Arbeitskostenindex zuverlässiger als Stundenlöhne
- US-Arbeitsmarkt mit überraschend starkem Wachstum
- Automatic Data Processing Inc (ADP): US-Privatsektor schafft mehr Stellen als erwartet
- Stärkere Abnahme als erwartet: Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken auf neues Pandemietief von 364.000 Arbeitslosen
- USA: Arbeitslosenquote steigt überraschend
- Rätselhafte Cyberattacke auf führenden IT-Anbieter in den USA legt weltweit IT lahm – Lösegeldforderungen: Ransomeware legt Dienstleister lahm – Womöglich tausende Dienstleister betroffen, unter anderem das schwedische Bahnunternehmen SJ, COOP Schweden, ein deutscher IT-Dienstleister
- Nach Angriffen im letzten Jahr und heuer im Mai auf diverse US-Firmen: Cyberattacke auf US-IT-Firma – Russlan im Visier
CHINA - Stärker gesunken als erwartet: ‚Caixin‘-Industriestimmung deutet trotz Rückgang auf Wachstum hin
ÄGYPTEN - Schiff frei: Einigung im Streit um Blockade des Sueskanals
TÜRKEI
Inflation in der Türkei: «Diesen Dollar müsste man irgendwo festbinden, damit er nicht weiter steigt!» – Wohlstandsverlust in breiten Schichten der Bevölkerung auf dem Vormarsch – Lebensmittelpreise steigen – Mittelklasse muss einsparen – Anhebung des Mindestlohns um mehr als 20 Prozent von der Inflation „aufgefressen“ – Ein Viertel der türkischen Bevölkerung lebt in Armut
GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich stärker ein als erwartet, bleibt aber auf Wachstumskurs
SCHWEIZ - Das Schweizer Stromnetz ist völlig ungenügend gegen Cyberangriffe geschützt
- Credit Suisse prüft Umbau des Private Banking – Insidern zufolge plant die Grossbank einen Umbau ihres Kerngeschäfts. Es soll mit reichen Privatkunden neu aufgestellt werden
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent, Kernrate auf 0,9 Prozent
- Euroraum-Wirtschaftsstimmung auf höchstem Stand seit 21 Jahren
- Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Mai von revidiert 8,1 für April auf 7,9 Prozent – Ausreißer nach oben: Griechenland (15.4 Prozent) und Spanien (15.3 Prozent) – Niedrige Arbeitslosenraten in den Niederlanden mit 3,3 und Deutschlande mit 3,7 Prozent
SCHWEDEN - Ransomeware legt Kassen lahm: COOP-Filialen in Schweden nach Hackerangriff geschlossen – Schwedisches Bahnunternehmen SJ-AB ebenso betroffen
FRANKREICH - Frankreich: Preise für Energie und für Tabakwaren treiben Inflation auf höchsten Stand seit Ende 2018: HVPI nimmt auf 1,9 Prozent auf Jahressicht zu
ITALIEN - Italien: Inflation steigt mit 1,3 Prozent auf höchsten Stand seit 2018
DEUTSCHLAND - Bundespräsident Steinmeier unterschreibt ESM-Gesetz nicht – In Schwebe beim Bundesverfassungsgericht: Hintergrund ist eine Klage von sieben FDP-Abgeordneten – Zeitung – Gesetz letztlich doch unterschrieben: EU-Aufbaufonds induzierte ähnlichen Vorgang wie jetzt im Frühjahr
- Deutschland – Preisschub bei Einfuhren beschleunigt sich: Einfuhrpreise im verteuerten sich um 11,8 Prozent – Basiseffekt und Energiepreise treiben – Ohne Energiepreise liegt Anstieg bei 6 Prozent, ohne Preise für Erdöl und Mineralölerzeugnisse bei 8 Prozent
- Deutsche HVPI-Inflation lässt im Juni nach: harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) steigt nur noch mit einer Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,4) Prozen
- Deutschland – Nach höchstem Stand im Mai seit fast zehn Jahren: Juni-Preisauftrieb schwächt sich etwas ab – Inflation bei 2,3 Prozent
- Ifo: Deutsche Industrie beklagt steigende Einkaufspreise – Lieferengpässe machen zu schaffen
- Deutsche Reallöhne sinken in 2021Q1 um 2 Prozent – Verbraucherpreis-Anstieg um 1,3 Prozent – Kurzarbeit beeinflusst Lohnentwicklung
- Markit: Deutsche Industrie zeigt im Juni Stärke – Punkteanstieg im Juni von 64,4 auf 65,1
- Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): Auftragseingang bleibt auf Wachstumskurs – Basiseffekt: real 47 Prozent Zuwachs zum Vorjahr, davon Inlandsaufträge plus 33 Prozent, Auslandsaufträge plus 55 Prozent – Deutscher Einzelhandel profitiert im Mai von Corona-Lockerungen mit Umsatzplus von 4,2 Prozent auf Monatssicht
- DIW: Konsum treibt Erholung der deutschen Konjunktur
- Kurzbericht: Lieferengpässe kosten deutsche Volkswirtschaft rund 25 Mrd. Euro – Industrie verliert derzeit rund 5 Prozent an Wertschöpfung, was rund 1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht – Ohne Lieferengpässe könnte deutsche Industrieproduktion mindestens 5 Prozent höher sein
- Bankenaufsicht entlastet kleinere Kreditinstitute
- Studie Deutsche Bankkunden müssen mit deutlich steigenden Gebühren rechnen –
Bankdienstleistungen kosten hierzulande derzeit deutlich weniger als im europäischen Durchschnitt. Das dürfte sich in Zukunft ändern. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für Kunden - Auch von Bestandskunden: ING verlangt künftig ab 50.000 Euro Strafzinsen – Die Direktbank drängt Kunden zur Zustimmung: kaum Auswege davor, Widerspenstigen droht Kündigung der Bankverbindung – Nach Welle der Kostenüberwältzung: zwei Fünftel der Bankkunden stimmen Überwälrzung zu
- Wirtschaftssensibler BA-Stellenindex erreicht Vorkrisenniveau vom März 2020: Arbeitskräfte-Nachfrage weiter im Aufwind – Gestiegene Nachfrage vor allem im verarbeitenden Gewerbe, Gastgewerbe, Information und Kommunikation
- Schulden öffentlicher Haushalte Deutschlands steigen im 1Q um 1,5%
- Scholz will große Mehrheit der Steuerzahler entlasten
ÖSTERREICH
– STATISTIK AUSTRIA - Erzeugerpreise des Produzierenden Bereichs im Mai 2021 um 6,0% über Vorjahresniveau
- Inflation im Juni 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 2,7%
- Konjunktur-Frühschätzung Mai 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich erholt (+38,6% zu Mai 2020); Umsatzplus von 5,0% im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Mai 2019
- Auftakt der Tourismus-Sommersaison 2021 mit kräftigem Nächtigungsplus im Vergleich zum Mai 2020, aber weit unter Vorkrisenniveau
- Rund 90% der 37.356 Unternehmensneugründungen des Jahres 2019 im Dienstleistungsbereich angesiedelt
- Öffentlicher Schuldenstand am 31. März 2021 bei 326,9 Mrd. Euro, um 11,7 Mrd. Euro höher als Ende des Jahres 2020
- 139 Verkehrstote bei Alleinunfällen im Jahr 2020; zwei Drittel aller Alleinunfälle von Lenkerinnen bzw. Lenkern einspuriger Fahrzeuge verursach
– MELDUNGEN - Institut für Höhere Studien: Lars Feld: Ein unbequemer Liberaler auf dem Weg zum IHS-Chef
- Zinshausmarkt in Österreich: Mehr Transaktionen, weniger Volumen – 2020 wurden mehr Zinshäuser verkauft als 2019, aber das Marktvolumen war geringer
- Eine Millionärssteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit
- Die reichsten Österreicher 2021: Milliardäre & Clans
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Martin Greive: Eine Vermögensteuer ist aus ökonomischer Sicht die dümmste aller Steuerideen
- Gerhard Schwarz: Mit der Geldpolitik die Welt retten? Die Überforderung der Notenbanken wird immer weiter getrieben
- Karl Leban: Das Dilemma der Notenbanker – Mit der Konjunktur geht es wieder aufwärts, die Inflation zieht an – EZB und Fed jedoch bleiben auf Kurs
…oooOOOooo…
CYBERSICHERHEIT – INTERNETKRIMINALITÄT
Lukas Mäder: Wie der russische Militärgeheimdienst seit Monaten versucht, in die IT-Systeme von Behörden und Firmen einzudringen – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021
Die amerikanischen und britischen Behörden warnen vor einer Angriffswelle, bei der russische Angreifer weltweit versuchen, schwache Passwörter auszunutzen.
Mit dem Schleppnetz sind russische Angreifer seit Monaten im Internet unterwegs, um an die Zugangsdaten von IT-Systemen interessanter Ziele heranzukommen. Sie versuchen dabei, über das Internet die Passwörter zu erraten – durch Ausprobieren. Wie der amerikanische Geheimdienst NSA zusammen mit anderen Behörden schreibt, soll die Aktion spätestens Mitte 2019 begonnen haben. Höchstwahrscheinlich sei sie noch immer im Gange.
Insgesamt sollen Hunderte von Organisationen angegriffen worden sein, hauptsächlich in den USA und in Europa. Zu den prominenten Zielen gehören Stellen der amerikanischen Regierung und insbesondere des Verteidigungsministeriums. Ganz allgemein stünden Behörden, Firmen im Energie- oder Verteidigungsbereich, akademische Einrichtungen, aber auch grosse Anwaltskanzleien oder Medienhäuser im Fokus. Ob und in welchen Fällen die Angreifer Erfolg hatten, lassen die Behörden offen.
Hinter der breit angelegten Aktion soll die Cybereinheit 26165 des russischen Militärgeheimdienstes GRU stehen, die auch unter den Bezeichnungen «Fancy Bear» oder APT 28 bekannt ist. Ihr werden etwa der Angriff auf den Deutschen Bundestag 2015, auf die Demokratische Partei in den USA 2016 oder auf die Anti-Doping-Behörde Wada (https://www.nzz.ch/international/die-jagd-nach-putins-agenten-wie-ein-spionagefall-in-lausanne-zu-einem-fiasko-des-russischen-geheimdiensts-fuehrte-ld.1429047) im selben Jahr zugeschrieben.

GRAPHIK: https://q-images.nzz.ch/2021/04/29/RussischeHackerBarencw@3x-90036251d15cd0a08f42eef656335b17.png?width=640&format=webply
Die Angreifer konzentrierten sich auf den Cloud-Dienst Office 365 von Microsoft. Mit sogenannten Brute-Force-Attacken versuchten sie, die Zugangsdaten zu erraten. Dabei werden zahlreiche Varianten von Passwörtern ausprobiert. Verwendet ein Nutzer ein Passwort, das leicht zu erraten ist, kann der Angreifer auf dessen Account zugreifen.
Im konkreten Fall verwendete APT 28 laut den Behörden auch Kombinationen von Benutzernamen und Passwort, die von anderen Plattformen stammen und auf illegalen Marktplätzen im Darknet erhältlich sind. Zudem probierten sie Variationen der geläufigsten Passwörter aus.
*** Office 365 war Ausgangspunkt für weiteres Eindringen ***
Die Angreifer haben die Zugangsdaten, die sie erraten haben, laut den Behörden verwendet, um tiefer in die IT-Systeme einzudringen. Office 365 ist dafür geeignet, weil diese Anwendung in vielen Unternehmen und Behörden eine zentrale Rolle spielt. Mit den Zugangsdaten konnten die Cyberspione zum Beispiel auf E-Mails zugreifen, Informationen über das Netzwerk sammeln, in weitere Systeme eindringen oder Abwehrmechanismen umgehen. Dabei nutzten die Angreifer auch bekannte technische Schwachstellen aus.
Diese langfristige Operation hat dem GRU vermutlich als Grundlage für die eigentlichen Cyberangriffe gedient. APT 28 hat für die Brute-Force-Attacken eine ausgeklügelte technische Lösung entwickelt. Diese konnte die Gruppierung bei verschiedenen Zielen einsetzen, um einen möglichen Einstiegspunkt für eine Spionageaktion zu finden. Nicht ausgeschlossen ist, dass APT 28 auch Zugangsdaten gesammelt hat, die gar nicht alle unmittelbar verwendet wurden.
Das Vorgehen von APT 28 zeigt, dass selbst staatliche Akteure, die über viel technisches Wissen und grosse personelle Ressourcen verfügen, nicht ausschliesslich auf komplexe Schwachstellen setzen. Sie verwenden auch rudimentäre Methoden wie das Erraten von Passwörtern. Offensichtlich haben sie mit dieser Methode Erfolg.
*** Auch Cyberkriminelle bedienen sich dieser Angriffsmethode ***
Dass Passwörter zu schwach sind, auf mehreren Plattformen wiederverwendet werden oder nicht mit einem zusätzlichen Faktor abgesichert sind, ist ein grosses Problem für die IT-Sicherheit. Wie schwerwiegend die Folgen sein können, zeigt nicht nur der jüngste Fall. Auch der Angriff von Cyberkriminellen auf die Colonial-Pipeline in den USA, der zu Treibstoffknappheit an der Ostküste führte, war laut Bloomberg darauf zurückzuführen.
Dass die amerikanischen und britischen Behörden die technischen Details der Operation nun veröffentlicht haben, hilft IT-Sicherheitsverantwortlichen, diese Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Damit erschweren die Behörden den russischen Angreifern die Arbeit, was eine moderne Form der Spionageabwehr ist.
QUELLE (ZAHLFPFLICHT): https://www.nzz.ch/technologie/wie-der-russische-militaergeheimdienst-seit-monaten-versucht-in-die-it-systeme-von-behoerden-und-firmen-einzudringen-ld.1633583
SIEHE AUCH
=> Intratext-Link
https://www.nzz.ch/international/die-jagd-nach-putins-agenten-wie-ein-spionagefall-in-lausanne-zu-einem-fiasko-des-russischen-geheimdiensts-fuehrte-ld.1429047
FERNER:
Vor Unabhängigkeitstag am 4.7.2021: Rätselhafte Cyberattacke auf führenden IT-Anbieter in den USA legt weltweit IT lahm – Lösegeldforderungen: Ransomeware legt Dienstleister lahm – Womöglich tausende Dienstleister betroffen, unter anderem das schwedische Bahnunternehmen SJ, COOP Schweden, ein deutscher IT-Dienstleister => USA
Nach Angriffen im letzten Jahr und heuer im Mai auf diverse US-Firmen: Cyberattacke auf US-IT-Firma – Russlan im Visier => USA
Das Schweizer Stromnetz ist völlig ungenügend gegen Cyberangriffe geschützt => SCHWEIZ
Ransomeware legt Kassen lahm: COOP-Filialen in Schweden nach Hackerangriff geschlossen – Schwedisches Bahnunternehmen SJ-AB ebenso betroffen => SCHWEDEN
Lukas Mäder: Wie lange dauert es, bis ein Hacker Ihr Passwort knackt? Fünf Tipps für ein sicheres Kennwort – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021
Dank immer leistungsfähigeren Rechenzentren werden Passwörter mit weniger als sechs Zeichen innerhalb von einer Sekunde erraten. Was macht ein Passwort stark? Wie soll man sich unzählige Passwörter merken? Und erkennt man, dass man gehackt wurde?
An einem ganz normalen Morgen wurde Serge Malenkovichs Kreditkarte gehackt. Er liess sie sofort sperren, bestellte eine neue Karte und dachte, damit sei das Problem behoben. Doch in den zwei folgenden Wochen erhielt er immer wieder Warn-SMS seiner Bank: Die alte Karte wurde bei mehreren Online-Händlern registriert und in Mexiko für eine Zahlung verwendet. So schildert er es auf dem Blog einer Cybersicherheitsfirma.
Der Fall zeigt: Kreditkartenbetrug wird unter Umständen von gut organisierten, internationalen Banden verwaltet. Nicht jeder Kreditkartenhack beginnt mit einem schwachen Passwort. Doch wer seine Daten im digitalen Raum weniger gut schützt als andere, ist ein einfacheres Ziel. Deshalb lohnen sich ein paar Überlegungen bei der Passwort-Wahl.
# Mindestens 10 Zeichen: Schweizer Strafverfolgungsbehörden können Passwörter mit 5 Zeichen innerhalb von 0,03 Sekunden erraten. Kurze Passwörter können mit einem Algorithmus geknackt werden, der den Login so lange mit unterschiedlichen Passwörtern ausprobiert, bis er per Zufall die richtige Zeichenfolge findet. Dieses Vorgehen basiert auf einer hohen Rechenleistung und wird als Brute-Force-Angriff bezeichnet. Mit jedem zusätzlichen Zeichen wird es schwieriger, ein Passwort mit dieser Methode zu erraten. Hat es 9 Zeichen, brauchen Schweizer Strafverfolgungsbehörden 9,1 Jahre. Um ein Kennwort mit 12 Zeichen zu erraten, bräuchten sie 7,5 Millionen Jahre.
# Eigenes Passwort für jedes Konto: Gerade weil mittlerweile überall ein Passwort nötig ist, greifen viele Leute aus Bequemlichkeit auf die gleichen Kennwörter zurück. Das ist gefährlich. Ist das Passwort einmal geknackt, sind alle Konten zugänglich. Es ist wie in der analogen Welt: Dort hat ja auch jede Tür einen eigenen Schlüssel.
# Keine Wörter aus dem Wörterbuch: Das sicherste Kennwort ist eine rein zufällige Abfolge verschiedener Zeichen. Da es schwierig ist, sich diese zu merken, gibt es einen Trick: Nehmen Sie einen Satz, den Sie sich merken können, und bilden Sie ihr Passwort aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben und Ziffern. Aus «Mein Vater Markus hat am 3. November Geburtstag, und wird leider immer dicker!» wird somit «MVMha3.NG,uwlid!».
# Verzichten Sie auf Namen und Adressen: Die einfachste und gängigste Methode, ein Passwort zu knacken, ist, es zu erraten. Deshalb sollten Sie niemals ein real existierendes Wort benutzen. Der Name des Ehepartners, des Hundes oder der Strassenname des Wohnorts sind tabu. Auch von den häufigsten Passwörter der Schweiz «123456», «hallo», «blabla», «sommer» oder «passwort» ist abzusehen.
# Zwei-Faktor-Authentifizierung: Logins, die über zwei Konten oder zwei Geräte geschützt werden, gelten als besonders sicher. Moderne Dienste geben ihren Nutzern daher die Möglichkeit, eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für die Authentifizierung zu hinterlegen.
Die perfekten Passwörter sind also lang, komplex, einzigartig – und schwierig zu merken. Man könnte sich die Passwörter notieren, wovon jedoch abgeraten wird. Wer das trotzdem macht, sollte das Dokument an einem sicheren Ort aufbewahren, aber nicht online speichern.
Eine Alternative stellen Passwort-Manager dar. Dabei handelt es sich um Programme, die Passwörter verschiedener Dienste verwalten und diese über mehrere Geräte hinweg synchronisieren. Nutzer müssen sich lediglich ein zentrales Masterkennwort merken, um Zugriff auf alle Konten zu erhalten.
Wie merke ich, dass mein Passwort gehackt wurde? Und was soll ich tun?
Viele Dienste melden es ihren Nutzern, falls von einer auffälligen Quelle auf ein Konto zugegriffen wird. Betroffene sollten dann ihre Passwörter ändern und eine zusätzliche Sicherheitsstufe einfügen, zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierug. Mit dem Dienst Haveibeenpwned.com kann getestet werden, ob E-Mail-Adressen gehackt wurden.
Häufige Anzeigen für Hacks sind ausserdem gefälschte Warnmeldungen von Virenscannern. Plötzlich poppt ein Banner auf, das nicht so aussieht, wie es Viren-Meldungen normalerweise tun. Klickt der Nutzer dann auf «Nein» oder «Abbrechen», lädt er damit unter Umständen eine Schadsoftware herunter — falls sie sich noch nicht schon vorher auf dem Rechner eingenistet hatte.
Cybersicherheitsexperten raten dann, den Rechner so schnell wie möglich herunterzufahren. Er kann dann im abgesicherten Modus neu gestartet werden, ohne Netzwerkverbindung. Die neu installierte Software kann dann meist deinstalliert werden. Damit sollten die gefälschten Warnhinweise des Virenscanners verschwinden. Danach empfiehlt sich ein umfassender Systemtest und ein kompletten Virenscan, um die letzten Reste der Malware zu entfernen. Dieses Vorgehen hilft auch oft, falls sich der Mausanzeiger von selbst bewegt.
Weiter erkennen Nutzerinnen und Nutzer einen Hack daran, dass im Browser plötzlich neue Schaltflächen oder neue Symbolleisten («Toolbars») auftauchen. In den meisten Browsern lassen sich alle installierten Toolbars anzeigen. Betroffene sollten dann alle Toolbars entfernen, die sie nicht unbedingt behalten möchten. Lässt sich die neue Toolbar nicht deinstallieren, oder wird sie gar nicht aufgelistet, sollte der Browser auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.
Nach einem Hack kann dem infizierten Gerät nie mehr zu hundert Prozent vertraut werden. Wer nach einem Hack das Betriebssystem neu aufsetzen will, dem helfen regelmässige Backups oder automatische Funktionen zur Systemwiederherstellung.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/technologie/wie-lange-dauert-es-bis-ein-hacker-ihr-passwort-knackt-fuenf-tipps-fuer-ein-sicheres-kennwort-ld.1383109
UMWELT
CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 um elf Prozent gestiegen – Science-APA, 29.6.2021
Eine Bestandsaufnahme der Verursacher von Treibhausgasemissionen hat ein Forschungsteam mit Wiener Beteiligung vorgenommen: Entgegen aller politischen Beteuerungen, stieg der Studie im Fachblatt „Environmental Research Letters“ zufolge der weltweite CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 um elf Prozent. Die größten Treiber der bedenklichen Entwicklung sind demnach alte Bekannte wie der Fracht- und Privatverkehr, der Fleischkonsum, Entwaldung oder Strom aus Kohle.
Unter der Leitung des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) gingen über 30 Wissenschafter weltweit an die umfassende Bestandsaufnahme, darunter auch Shonali Pachauri vom Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien und Dominik Wiedenhofer vom Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien. „Wir wollten Sektor für Sektor die Herausforderungen in Bezug auf den schnellen, tiefgreifenden Umbau verstehen, der jetzt offensichtlich zur Lösung der Klimakrise erforderlich ist“, so Wiedenhofer. Man habe sich dabei auf verschiedenste Datenquellen zu Klimagas-Emissionen vor allem vom Jahr 2010 bis 2018 konzentriert.
*** Positiver Ausreißer: Energiesektor in Europa ***
Insgesamt sind demnach die globalen Treibhausgas-Emissionen in dem Zeitraum um elf Prozent gestiegen, heißt es in einer Aussendung der Boku und des MCC. Ein Ausreißer in die positive Richtung ist demnach der Energiesektor in Europa, der im Vergleich zu den Zeiträumen zwischen 1990 und 2009 für weniger CO2-Ausstoß verantwortlich zeichnete. Allerdings sei vor allem in Asien die besonders klimaschädliche Kohleverstromung stark im Vormarsch befindlich. Zudem stiegen nahezu in allen Großregionen der Erde die Emissionen im Gebäudebereich, wo die Wohnflächen im Schnitt gestiegen sind, und im Verkehrssektor, wo vor allem der Frachtverkehr in den vergangenen beiden Jahrzehnten emissionstechnisch stark zulegte (plus 68 Prozent).
Am meisten ins Gewicht fällt allerdings der Industriesektor. Im Jahr 2018 war dieser für 35 Prozent des Gesamtausstoßes verantwortlich – Tendenz seit 2010 steigend. Oft vernachlässigt würde die Landnutzung, wo in den untersuchten nahezu 30 Jahren mehr als sieben Millionen Quadratkilometer ursprünglicher Wald abgeholzt wurden. Eine Fläche, die fast jener Australiens entspricht, heißt es. Auf den Land-Sektor entfällt demnach mittlerweile rund ein Viertel der klimabelastenden Ausstöße. Ein großer Treiber dieser Entwicklung ist der zunehmende Hunger auf fleischreiche Nahrung. Um diese Lebensmittel etwa für Europa oder China zu produzieren sind immer größere landwirtschaftliche Flächen notwendig. Diesen müssen oft tropische Waldflächen weichen, die davor viel Kohlenstoff gespeichert haben.
*** Kleine Ausstoß-Delle durch Pandemie ***
Auch wenn es eine kleinere Ausstoß-Delle durch die Coronamaßnahmen seit 2020 gebe, „zeigen die Sektor-Trends im Jahrzehnt vor Corona nur wenig Fortschritt in Richtung Dekarbonisierung“, so der Erstautor der Untersuchung, William Lamb, vom MCC und der University of Leeds (Großbritannien): „Weltweit wurden Emissionsminderungen infolge technischen Fortschritts meist durch das Wirtschaftswachstum überkompensiert – auch wenn sich in immer mehr Ländern zeigt, dass erfolgreiche Klimapolitik und Wettbewerbsfähigkeit oft Hand in Hand gehen. Um die Erderhitzung gemäß Weltklimaabkommen zu limitieren, müssen wir eine nachhaltige Landnutzung sicherstellen, exzessive Nachfragen begrenzen, ein hohes Maß an Energieeffizienz erreichen und schnell aus der Nutzung fossiler Brennstoffen aussteigen.“
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/7509171612558079859
SIEHE DAZU:
=> W.F. Lamb et al.: A review of trends and drivers of greenhouse gas emissions by sector from 1990 to 2018 –
Environ. Res. Lett. 16 073005
QUELLEN:
https://doi.org/10.1088/1748-9326/abee4e
(32-Seiten-PDF): https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abee4e/pdf
Erneuerbare Energien – Zwangsarbeit in China: Deutsche Solarbranche ist in Erklärungsnot –
Deutsche Anbieter sind auf chinesische Lieferanten angewiesen, die wegen Zwangsarbeit in Verruf geraten sind. US-Sanktionen erhöhen nun den Druck – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 2.7.2021
Es gibt Zwickmühlen, die sind so gemein, dass sie sich nur die Realität ausdenken kann: Da wollen wir nun alle gute grüne Bürger sein und setzen Solaranlagen auf jedes halbwegs geeignete Hausdach zwischen Flensburg und Füssen. Und dann stellt sich raus: Das darin massenhaft verwendete Silizium wird offenbar häufig von chinesischen Zwangsarbeitern gefördert – und vor Ort auch noch mit Energie aus schmutzigem Kohlestrom verarbeitet.
Ausweichen auf andere Lieferländer? Schwierig bis unmöglich. Also um der Menschenrechte willen doch lieber weiter mit Öl heizen? Irgendwie auch keine Lösung – die deutsche Solarbranche steht dem Problem einigermaßen ratlos gegenüber, wie unser Tagesthema zeigt
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energien-zwangsarbeit-in-china-deutsche-solarbranche-ist-in-erklaerungsnot/27383854.html
Katrin Terpitz und Kollegin: Kunststoff Innovative Verpackungen: Es geht auch ohne Plastikmüll
Der Druck auf Konsumgüterhersteller steigt, nachhaltige Verpackungen einzuführen. Doch Alternativen wie Flaschen aus Papier haben ihre Tücken. – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 2.7.2021
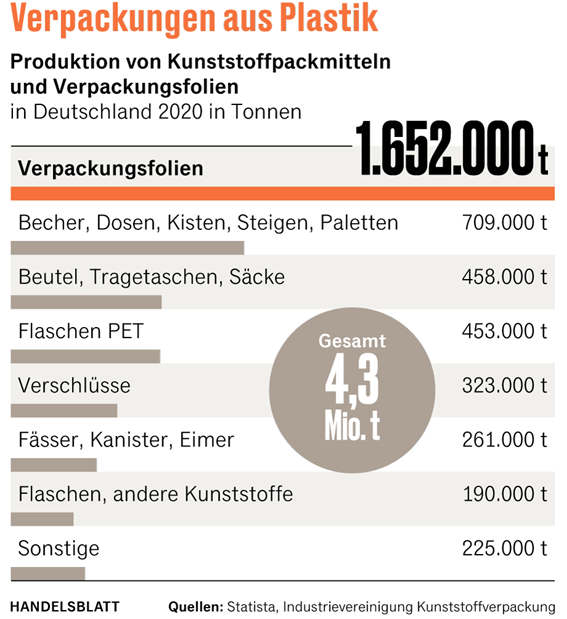
Ein ganz ähnliches Dilemma [wie hinsichtlich des Einsatzes von Solarzellen] erlebt jeder, der einmal versucht, statt Hack vom Metzger Fleischersatzprodukte aus dem Bio-Regal zu verwenden. Jeder einzelne Bratling steckt in einer Art Hartschalenkoffer aus Plastik. Nach dem Veggie-Burgeressen mit der Familie quillt die gelbe Tonne über, und schon wieder erleidet das grüne Gewissen einen empfindlichen Dämpfer. Gut zu wissen, dass immer mehr Lebensmittelhersteller nun zumindest damit experimentieren, Plastikverpackungen durch solche aus Papier zu ersetzen. Der Coca-Cola-Konzern testet in Ungarn sogar eine Papierflasche
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/kunststoff-innovative-verpackungen-es-geht-auch-ohne-plastikmuell/27381886.html
VERMÖGENSUNGLEICHHEIT
Ungleiche Vermögensverteilung: Besserverdiener erben mehr – Menschen mit höherem Einkommen und mehr Vermögen erben in Deutschland deutlich mehr als Geringverdiener. Rentenlücken lassen sich durchs Erben deshalb kaum ausgleichen – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.6.2021
So haben rund 18 Prozent der Männer ab 55 Jahren mit einem Nettoeinkommen über 2500 Euro zuletzt innerhalb von 15 Jahren geerbt – aber nur 5 Prozent derjenigen mit einem Einkommen unter 1000 Euro. Das zeigt eine von der Deutschen Rentenversicherung präsentierte Studie.
Bei den Frauen ab 55 waren es rund 15 Prozent derjenigen mit mehr als 2500 und 6 Prozent mit unter 1000 Euro. Beim Erben gelte das «Matthäus-Prinzip», sagte die Sozialforscherin Claudia Vogel unter Anspielung auf einen ans Matthäusevangelium angelehnten Spruch: «Wer hat, dem wird gegeben.»
*** Wer erbt? ***
«Die Erbengeneration, die jetzt Geld und Erbschaften erhält, das sind die Babyboomer», sagte Vogel. Durch Deutschland rolle eine «Erbschaftswelle», wobei die Erblasser ihren Wohlstand oft in den 50er und 60er Jahren angehäuft hätten. Insgesamt haben innerhalb von 15 Jahren zuletzt 7,3 Prozent der Menschen geerbt, wobei der Anteil bei den Frauen leicht höher liegt. Erbschaften können dabei zur Alterssicherung beitragen – aber mögliche Rentenlücken keineswegs in der breiten Masse stopfen: Am häufigsten haben 55- bis 74-Jährige nach eigenen Angaben eine Erbschaften bekommen – allerdings auch in diesen Jahrgängen nur etwas mehr als jede und jeder Zehnte.
*** Wie viel wird geerbt? ***
Insgesamt eine ganze Menge. Nach Schätzungen des Instituts DIW Berlin werden jedes Jahr bis zu 400 Milliarden Euro in Deutschland vererbt oder verschenkt. Im Schnitt waren es binnen 15 Jahren inflationsbereinigt 85.000 Euro pro Erbschaft, so das DIW in einer bereits im Februar vorgestellten Studie. Die Hälfte der Erbinnen und Erben bekam nur Summen unter 31.000 Euro. Weniger als 5 Prozent erhielten Beträge über 400.000 Euro.
*** Einkommen der Erben ***
Je höher das Einkommen – desto besser die Erbchancen. Vor allem auf Männer trifft das zu. So befanden sich unter den Männern mit Nettoeinkommen von 1000 bis 1499 Euro rund 5 Prozent Erben, 7 Prozent waren es bei jenen mit 1500 bis 1999 Euro und 29 Prozent bei denen mit mehr als 2000 Euro. Bei den Frauen konnten sich knapp 12 Prozent derjenigen mit 1000 bis 1499 Euro über ein Erbe freuen, 13 Prozent derjenigen mit 1500 bis 1999 Euro und ebenfalls rund 29 Prozent bei denen mit über 2000 Euro. Dass mehr Frauen als Männer mit geringeren Einkommen von Erbschaften profitieren, liegt laut Studienautorin Vogel daran, dass Frauen oft weniger verdienen. Erhoben worden war die Erbquote hierbei bei den Über-55-Jährigen, die noch nicht im Ruhestand sind. Insgesamt verdienten die Menschen in Deutschland im Mittel zuletzt 1871 Euro.
*** Vermögen der Erben ***
Das Vermögen von Menschen, denen die vorangegangene Generation etwas vererbt oder schenkt, war zuletzt deutlich höher als das von Menschen ohne solche Transfers. So lag das individuelle Nettovermögen dieser Personen laut DIW um 142.000 Euro höher. Sozialforscherin Vogel sagte, «dass die Erbschaften, so wie sie in Deutschland fließen, die absolute Vermögensungleichheit vergrößern».
*** Vorschläge gegen ungleiche Verteilung ***
Vogel stellte fest, dass es in der Politik unbeliebt sei, an der Erbschaftssteuer-Schraube zu drehen. Die Familien, das von den Eltern und Großeltern erwirtschaftete Hab und Gut – bei solchen Themen seien viele sehr sensibel. Allerdings könne man sich fragen, ob die Regeln noch zu den vielfältiger gewordenen Familienverhältnisse passen. So gilt ein Freibetrag von 400.000 Euro für jedes Kind des Verstorbenen – für das Kind des Partners sind es nur 20.000 Euro. Denkbar wäre laut Vogel auch, die geltende Zehn-Jahres-Frist bei Schenkungen auszusetzen. Derzeit können alle zehn Jahre Freibeträge in Anspruch genommen werden. Doch Vogel würde einen anderen Weg favorisieren: «Ich halte Ansätze der Vermögensbesteuerung für viel sinnvoller, um etwas gegen Ungleichheit zu tun.» (© dpa-infocom, dpa:210630-99-208284/2)
‚Wer hat, dem wird gegeben‘ – Besserverdiener erben in Deutschland mehr – dpa-AFX, 30.6.2021
Menschen mit höherem Einkommen erben in Deutschland deutlich mehr als Geringverdiener. So haben rund 18 Prozent der Männer ab 55 Jahren mit einem Nettoeinkommen über 2500 Euro zuletzt innerhalb von 15 Jahren geerbt, aber nur 5 Prozent derjenigen mit einem Einkommen unter 1000 Euro. Das zeigt eine am Mittwoch von der Deutschen Rentenversicherung präsentierten Studie.
Bei den Frauen waren es rund 15 Prozent derjenigen mit mehr als 2500 Euro und 6 Prozent mit unter 1000. Beim Erben gelte das „Matthäus-Prinzip“, sagte die Studienautorin, die Neubrandenburger Sozialforscherin Claudia Vogel: „Wer hat, dem wird gegeben.“ Die in Deutschland fließenden Erbschaften vergrößerten die Vermögensungleichheit. Erhoben worden war die Erbquote bei jenen, die noch keinen Rentenbezug aufweisen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53289274-wer-hat-dem-wird-gegeben-besserverdiener-erben-in-deutschland-mehr-016.htm
IW: Vermögen des reichsten Prozents steckt überwiegend in Betrieben – Oldenburger Zeitung, 3.7.2021
Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) entfallen vom Vermögen des reichsten Prozents der Bevölkerung bis zu 65 Prozent auf Betriebsvermögen. Das ist das Ergebnis einer IW-Analyse im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, über das die „Welt am Sonntag“ vorab berichtet.
Die Deutsche Bundesbank ging bislang aufgrund einer Umfrage nur von einem Anteil von 39 Prozent für das oberste Prozent aus. Die Wirtschaftsforscher des IW gehen davon aus, dass von Privatleuten insgesamt statt 1,1 Billionen Euro bis zu 3,1 Billionen Euro Betriebsvermögen gehalten wird. Das IW warnt davor, das Betriebsvermögen durch eine Wiedereinführung der Vermögensteuer zu belasten. „Insbesondere in Krisenzeiten mit niedrigen oder ausbleibenden Gewinnen wäre dadurch ein Substanzverzehr möglich oder wahrscheinlich. Dann müssten zum Beispiel Maschinen verkauft oder Investitionen zurückgestellt werden, um Liquiditätsengpässe zu verhindern“, heißt es in der Studie.
Das von Privatleuten gehaltene Betriebsvermögen wurde laut der „Welt“ näherungsweise aus einer Stichprobe von knapp 4.500 Unternehmen ermittelt.
QUELLE: https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/iw-vermoegen-des-reichsten-prozents-steckt-ueberwiegend-in-betrieben-67203.html
Studie des Verbandes der bayrischen Wirtschaft: Vorurteilen der Vermögensungleichheit auf der Spur / Brossardt: „Altersvorsorgeanwartschaften reduzieren Vermögensungleichheit um über 20 Prozent“ – Stabile Ungleichheit in Deutschland seit 2002 – Größere Ungleichheit in Ländern mit ausgedprägtem sozialem Sicherungsnetz – Vorschläge zur Förderung von privatem Vermögen – Einkommens-Ungleichheit in Deutschland seit 2005 stabil: sinkender Anteil der Mindestsicherungsbezieher*innen – Bayrische Wirtschaft, 2.7.2021
Die Vermögensungleichheit in Deutschland ist seit 2002 nicht gestiegen. Das ist eines der Ergebnisse der Studie der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. „Gerechtes Deutschland – Die Rolle der Vermögen“. Die Studie wurde vom Institut der Deutschen Wirtschaft für die vbw erstellt und befasst sich mit dem Einfluss der sozialen Sicherungssysteme auf die Vermögensverteilung. „Bei der Verteilung der Vermögen muss man genau hinschauen. Für eine Ungleichverteilung der Vermögen gibt es verschiedene Gründe, entscheidenden Einfluss auf die Vermögensverteilung hat zum Beispiel die Ausprägung des Sozialstaats“, führte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt aus.
Auch im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Länder mit einem größeren sozialen Sicherungsnetz generell ein höheres Maß an Ungleichverteilung aufweisen als Staaten, deren soziale Sicherung weniger stark ausgeprägt ist. „Dazu gehören auch Länder wie Dänemark, Norwegen und Schweden, die sonst als überaus gerecht wahrgenommen werden. In Ländern mit starker sozialer Sicherung besteht ein geringerer Anreiz zur privaten Vorsorge. Das schlägt sich auf die Vermögensbildung nieder und führt zu einem im internationalen Kontext niedrigeren Vermögensaufbau. Zumal entsprechend hohe Steuer- und Abgabenlasten diesen noch zusätzlich erschweren“, erklärte Brossardt.
Bezieht man beispielsweise Anwartschaften aus gesetzlichen, privaten und betrieblichen Altersvorsorgesystemen in die individuellen Vermögenspositionen mit ein, steigt das Vermögen. Die Vermögensungleichheit in Deutschland reduziert sich dadurch gleichzeitig um 22 Prozent. „Insbesondere die statistisch nicht erfasste Gesetzliche Rentenversicherung schlägt hier ins Gewicht. Wird diese berücksichtigt, dann verbessert sich in jüngeren Altersgruppen zwischen 18 und 35 Jahren, die noch wenig eigenes Vermögen bilden konnten, die Situation deutlich. Hier beträgt der Vermögensanstieg das 2,6 fache“, betonte Brossardt.
Um breiten Teilen der Bevölkerung Chancen auf Vermögensaufbau zu eröffnen, nennt Brossardt daher drei Forderungen: „Erstens müssen wir den Einzelnen wieder mehr Spielraum zum Vermögensaufbau lassen und konsequent die Steuer- und Abgabenbelastung senken. Zweitens müssen wir alles daransetzen, nach der Corona-Krise an die Arbeitsmarkterfolge der letzten Jahre anzuknüpfen und Beschäftigungsperspektiven zu schaffen. Drittens muss Wohnraum gezielt gefördert werden, denn die eigene Immobilie macht einen bedeutenden Anteil am Vermögen eines Haushalts aus.“ Eine klare Absage erteilte Brossardt den Plänen zur Einführung einer Vermögenssteuer.
„Der Rückhalt für unser Wirtschaftssystem der Sozialen Marktwirtschaft hängt maßgeblich davon ab, wie gerecht unsere Gesellschaft eingeschätzt wird. Bei der Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen gilt es daher, die klaffende Lücke zwischen Wahrnehmung und Realität zu schließen. Der Blick auf die Daten zeigt, dass die Lage wesentlich besser ist als häufig angenommen“, erklärte Brossardt. So ist zum Beispiel die Verteilung der Nettoeinkommen in Deutschland seit 2005 stabil. Verantwortlich hierfür ist unter anderem der Beschäftigungsaufbau der letzten Jahre. „Dieser hat dazu geführt, dass immer weniger Menschen in Deutschland Leistungen der Mindestsicherung beziehen oder sich über Gebühr einschränken müssen. Die Quote sinkt seit 2013 deutlich“, so Brossardt.
QUELLE: https://www.vbw-bayern.de/vbw/PresseCenter/vbw-Studie-Vorurteilen-der-Verm%C3%B6gensungleichheit-auf-der-Spur.jsp
SIEHE DAZU:
=> Studie
QUELLE: https://www.vbw-bayern.de/gerechtes_deutschland
FERNER
=> Gerechtes Deutschland – Die Rolle der Vermögen – Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 29.6.2021
Vermögen sind ungleicher verteilt als Einkommen. Dieser Sachverhalt ist unumstritten und gilt sowohl in Deutschland als auch in anderen Industrieländern, sodass Deutschland hierbei keine Sonderrolle einnimmt.
QUELLE: https://www.iwkoeln.de/studien/gutachten/beitrag/judith-niehues-jochen-pimpertz-maximilian-stockhausen-gerechtes-deutschland-die-rolle-der-vermoegen.html
=> Stellungnahme zum 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung – Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 21.6.2021
Mit dem 6. Armuts- und Reichtumsbericht (ARB) kommt die Bundesregierung ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach zur Mitte einer jeden Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag Bericht über fundamentale Kennzahlen zur Entwicklung von Armut und Reichtum in Deutschland zu erstatten.
QUELLE: https://www.iwkoeln.de/studien/iw-reports/beitrag/maximilian-stockhausen-stellungnahme-zum-6-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung.html
=> Armut- und Reichtumsbericht: Größtenteils gute Nachrichten – Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 12.5.2021
Judith Niehues, Maximilian Stockhausen: Rekordbeschäftigung, sinkende Langzeitarbeitslosigkeit, steigende Realeinkommen und eine recht stabile Verteilung – die positiven Entwicklungen der Jahre vor der Pandemie spiegeln sich auch im sechsten Armuts- und Reichtumsberichts (ARB) wider, der heute dem Bundeskabinett vorgelegt wurde. Eine Einordnung der wichtigsten Ergebnisse.
QUELLE: https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/beitrag/judith-niehues-maximilian-stockhausen-groesstenteils-gute-nachrichten.html
Martin Greive: Steuerdebatte Vermögensverteilung in Deutschland: Weniger ungleich als gedacht – SPD, Grüne und Linke wollen die Vermögensteuer wieder einführen. Doch laut einer Studie ist die Vermögensungleichheit geringer als behauptet – Handelsblatt, 1.7.2021
Die Initiative „taxmenow“ hat einen ungewöhnlichen Wunsch. Das Bündnis von Millionären aus Deutschland und Österreich fleht den Staat an, endlich stärker besteuert zu werden.
Seit Jahrzehnten nehme die Ungleichheit in Deutschland zu, die Machtkonzentration in Form von Kapital und Einfluss sei sogar „demokratiegefährdend“, schreiben sie in ihrem Onlineappell und fordern unter anderem die Wiedereinführung der Vermögensteuer.
Doch die These von der zunehmenden Ungleichheit ist umstritten: Ein Gutachten des IW Köln im Auftrag der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), die dem Handelsblatt vorliegt, kommt zu dem Schluss: Die Vermögensungleichheit in Deutschland wird überschätzt, weil zu viele Faktoren außer Acht gelassen werden.
Werden etwa Rentenansprüche berücksichtigt, sinkt allein dadurch die Vermögensungleichheit um 22 Prozent. „Durch die Hinzurechnung von Ansprüchen an Altersvorsorgesysteme nimmt das durchschnittliche Nettovermögen deutlich zu“, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Zudem nehme die Vermögensungleichheit immer stärker ab, je mehr Altersgruppen ans Rentenalter heranrückten. All diese Effekte sind in der Diskussion um die Vermögensverteilung zu beachten, um auf einer sachlich fundierten Grundlage Handlungsoptionen zu prüfen“, so Brossardt.
Jahrzehntelang hatte es in Deutschland eine Vermögensteuer gegeben, bis das Bundesverfassungsgericht 1995 in einem Urteil bemängelte, Immobilien würden wegen veralteter Bewertungsmaßstäbe bei der Vermögensteuer deutlich bevorzugt.
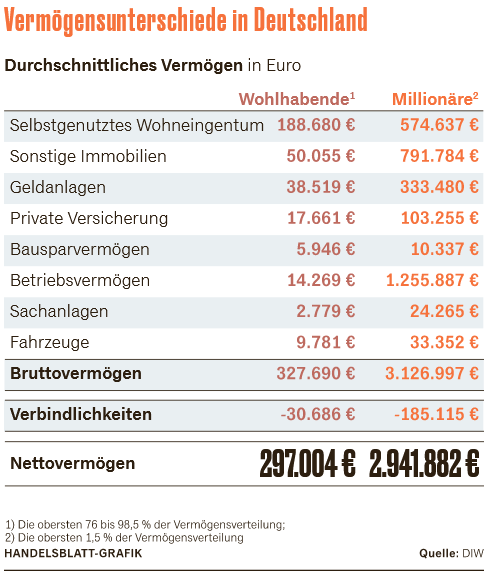
Die damalige Bundesregierung unter Helmut Kohl (CDU) handelte nicht, ab 1997 wurde die Steuer nicht mehr erhoben und verschwand erst einmal in der Schublade. In den vergangenen Jahren erlebte die Diskussion über die Steuer mit dem Aufkommen einer neuen Ungleichheitsdebatte in Deutschland ein Comeback.
In genau dieser Diskussion gerät allerdings vieles durcheinander. So ist die Schere bei den Nettoeinkommen hierzulande vergleichsweise gering, weil der Staat über das Steuersystem sehr viel umverteilt.
*** Bei Vermögensungleichheit ist Deutschland an der Spitze ***
Die Vermögensungleichheit in Deutschland ist im internationalen Vergleich dagegen tatsächlich sehr hoch. Unter 29 Staaten ist die Schere laut Credit Suisse nur in fünf anderen Ländern größer.
Dieser Umstand allein sagt noch nicht viel aus. So sind etwa die Vermögen in Dänemark oder Schweden noch ungleicher verteilt als in Deutschland. Und ausgerechnet diese Länder gelten insbesondere im linken Lager eigentlich als Vorbild in Sachen soziale Gerechtigkeit.
Gegenstand hitziger Debatten ist auch immer wieder, was die Ursache von Vermögensungleichheit ist und wie sie gemessen wird. So glauben viele, die Vermögensungleichheit in Deutschland sei eigentlich noch höher als bekannt, weil hohe Vermögen unzureichend erfasst werden und die Vermögenskonzentration dadurch systematisch unterschätzt werde.
Ein Indiz, dass da etwas dran sein könnte, lieferte im Vorjahr eine DIW-Studie. Auf Basis neuer Daten kamen die Forscher zu dem Schluss, das reichste Prozent der Bevölkerung vereine in Deutschland nicht 22, sondern rund 35 Prozent des Nettovermögens auf sich.
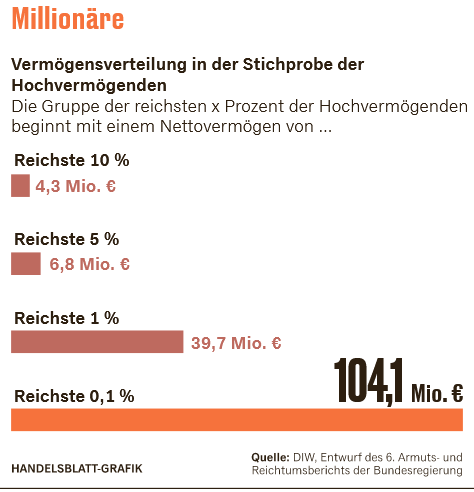
Auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die die Ungleichheit in Deutschland besonders in die Höhe treiben, allen voran die Wiedervereinigung. Viele Ostdeutsche fingen nach der Wende bei null an und bauen seitdem erst Vermögen auf.
Eine weitere Frage ist, was in die Betrachtung bei der Messung von Vermögensungleichheit einfließt. Hier setzt auch die IW-Studie im Auftrag der bayerischen Wirtschaft an. Insbesondere wenn Rentenanwartschaften einbezogen werden, ändert sich laut Studie das Bild vom „Ungleichland“.
*** Ungleichheit unter älteren Altersgruppen geringer ***
Werden Rentenansprüche berücksichtigt, verbessert sich in der Altersgruppe zwischen 18 und 35 Jahren, die noch wenig eigenes Vermögen bilden konnten, die Situation deutlich. Hier beträgt der Vermögensanstieg laut Studie das 2,6-Fache. Die Vermögensverteilung variiert zudem nach Altersgruppen. So ist die Ungleichheit der Vermögen innerhalb älterer Altersgruppen deutlich geringer.
Um zu den obersten zehn Prozent der jüngsten Altersgruppe von unter 30 Jahren zu gehören, muss ein Haushalt mindestens über das 14-Fache des mittleren Vermögens verfügen. Bei den 55- bis 59-Jährigen reicht hingegen das Fünffache.
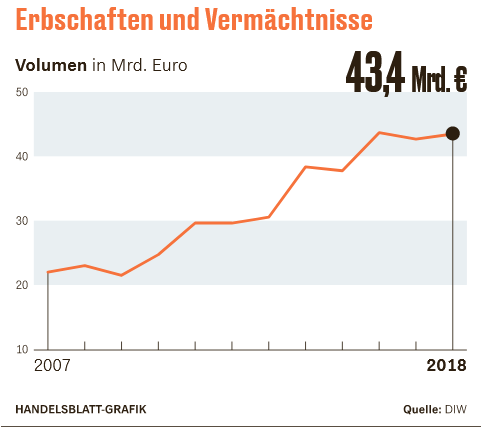
Die linken Parteien hält das aber nicht davon ab, Vermögen steuerlich stärker belasten zu wollen. Sie verweisen neben der hohen Vermögensungleichheit auch auf die im internationalen Vergleich geringe Vermögensbesteuerung in Deutschland.
Vermögensbezogene Steuern, unter die etwa die Erbschaft- oder die Grundsteuer fallen, machen hierzulande nur einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 1,1 Prozent aus. Im OECD-Durchschnitt sind es dagegen 1,9 Prozent.
Und Corona hat aus Sicht der Parteien die Ungleichheit noch verschärft. Während viele Geringverdiener Einkommenseinbußen zu verkraften hatten, etwa weil sie in Kurzarbeit waren, mehrte sich das Vermögen vieler Wohlhabender dank steigender Immobilienpreise und Aktienkurse auch in der Krise immer weiter.
*** Hohe Steuerbelastung für Unternehmen
Die SPD will deshalb Nettovermögen ab zwei Millionen Euro mit einem Prozent besteuern, Vermögen ab einer Milliarde Euro mit zwei Prozent. Zwischen 17 und 24 Milliarden Euro würde die Steuer nach DIW-Berechnungen im Jahr einspielen, bei Freibeträgen für Unternehmen etwas weniger. Die Pläne der Grünen sehen ähnlich aus, das Konzept der Linken sieht vor, Vermögen ab einer Million Euro mit ein bis fünf Prozent zu besteuern.
Auch wenn diese Steuersätze zunächst gering erscheinen, die Belastung für einzelne Unternehmen fiele hoch aus. So rechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor, durch die Vermögensteuerpläne etwa der SPD stiege die Steuerbelastung für Unternehmen inklusive anderer Steuern auf bis zu 79 Prozent. Und: Ausgerechnet ertragsschwächere Unternehmen wären besonders betroffen.
Ein weiteres Gegenargument gegen die Wiederbelebung der Vermögensteuer ist der Bürokratieaufwand. Anders als etwa bei der Erbschaftsteuer fällt die Erfassung des Vermögens nicht alle paar Jahrzehnte, sondern jedes Jahr an. Alle Vermögensgegenstände zu erfassen, etwa den Picasso an der Wand oder die Jacht, sei extrem aufwendig und rechtlich angreifbar.
Befürworter einer Vermögensteuer sehen dagegen keine gravierenden Probleme. So könne sich Deutschland ein Beispiel an der Schweiz nehmen, wo es eine Vermögensteuer gibt. Dort werde Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage die Steuer gestundet.
Auch die Bewertungsprobleme ließen sich lösen, insbesondere die von Immobilien, wegen der die Vermögensteuer 1995 gekippt wurde. So werden im Zuge der Grundsteuerreform in den nächsten Jahren ohnehin der aktuelle Wert sämtlicher Immobilien in Deutschland neu erfasst.
Die IW-Autoren warnen dagegen in ihrer Studie, die Einführung einer Vermögensteuer könnte sogar ungewollt zu mehr Ungleichheit führen. So zeigten vermögensbezogene Steuern „regelmäßig eine begrenzte umverteilende Wirkung auf“, schreiben die Forscher.
Zugleich ziehe die Besteuerung von Betriebsvermögen „negative Beschäftigungseffekte nach sich“, weil Investoren ihre Standortentscheidungen hinterfragten. Dadurch drohten nicht nur Einbußen bei Einkommen, sondern auch bei Rentenansprüchen – dabei würden gerade die die Ungleichheit reduzieren.
Immobilien spielen entscheidende Rolle
Auch die diskutierte Stabilisierung des höheren Rentenniveaus sehen die Forscher unter Ungleichheits-Gesichtspunkten kritisch. Denn dafür seien höhere Rentenbeiträge notwendig, die wiederum den privaten Vermögensaufbau erschwerten.
Um breiten Teilen der Bevölkerung Chancen auf Vermögensaufbau zu eröffnen, müssten Steuern und Abgaben eher sinken, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt.
„Zweitens müssen wir alles daransetzen, nach der Coronakrise an die Arbeitsmarkterfolge der letzten Jahre anzuknüpfen und Beschäftigungsperspektiven zu schaffen“, so Brossardt. Und drittens müsse die Politik gezielt Wohnraum fördern.
Tatsächlich spielen gerade Immobilien bei der Vermögensverteilung in Deutschland eine wichtige Rolle. Deshalb liege „es nahe, die Einstiegshürden durch die insbesondere in einigen deutschen Bundesländern hohe Grunderwerbsteuer in den Blick zu nehmen“, schreiben etwa auch die Steuerrechtler Peter Hongler und Mattias Valta in einem neuen Fachaufsatz zur Vermögensteuer.
Mit anderen Worten: Ausgerechnet die Grunderwerbsteuer, die Vermögen besteuern soll, könnte die Vermögensungleichheit verschärfen.
QUELLE: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/steuerdebatte-vermoegensverteilung-in-deutschland-weniger-ungleich-als-gedacht/27382576.html
Wird man mit einem hohen IQ reich? Die Antwort überrascht: Der Zusammenhang ist schwach ausgeprägt – Entscheidend ist auch das Geburtsland – Cash-online, 2.7.2021
Der US-amerikanische Unternehmer Robert T. Kiyosaki sagte einmal: „Intelligenz löst Probleme und bringt Geld“. Aber wie stark ist tatsächlich die Verbindung zwischen Gehirnleistung und der Größe des Bankkontos?
Nicht sehr stark, wie Moneytransfers.com herausfand. Die Plattform verglich die durchschnittlichen IQ-Werte von verschiedenen europäischen Ländern mit dem durchschnittlichen Vermögen ihrer Einwohner und untersuchte die Ergebnisse.
Die Deutschen lagen beim IQ einen Punkt hinter Spanien, aber das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf war in Deutschland um 16.903 USD höher.
Einige Länder zeigten einen starken Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen IQ und dem Pro-Kopf-Einkommen, aber äußere Einflüsse, die weiter unten erklärt werden, scheinen dabei einen größeren Effekt zu haben. Nach den Untersuchungen von Moneytransfers.com führt ein höherer IQ nicht unbedingt dazu, dass man mehr Geld verdient. Wie frühere wissenschaftliche Studien schon gezeigt haben, kann das jeweilige Geburtsland einen weitaus größeren Einfluss darauf haben. …
QUELLE: https://www.cash-online.de/investmentfonds/2021/wird-man-mit-einem-hohen-iq-reich-die-antwort-wird-sie-ueberraschen/569404
SIEHE UNTER ÖSTERREICH
1) Anderl: Eine Millionärssteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit – Arbeiterkammer, 25.6.2021
QUELLEN
https://www.arbeiterkammer.at/millionaerssteuer
(verdeckt verlinkt): https://www.arbeiterkammer.at/millionaerssteuer#heading_Trend_Ranking_zeigt_wie_die_Super_Reichen_in_einem_Jahr__das_von_Rekordarbeitslosigkeit_gepraegt_war__noch_reicher_wurden
SIEHE DAZU: https://soreichistoesterreich.ak.at/
2) Die reichsten Österreicher 2021: Milliardäre & Clans – Trend, 25.6.2021
QUELLE: https://www.trend.at/wirtschaft/oesterreicher-milliardaere-clans-12143947
INTERNATIONAL
Mehr Fairness: 130 Länder einigten sich auf Mindeststeuer – Anpassung an das Digitalzeitalter: Weltweit tätige Unternehmen sollen mindestens 15 Prozent Steuern zahlen – Wiener Zeitung, 1.7.2021
Mehr als 130 Länder der Welt haben sich auf eine umfassende Steuerreform geeinigt. Dazu gehöre eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung der Staaten. Sie hatten unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD seit Jahren darüber verhandelt. Einige noch offene Details sollen bis Oktober geklärt werden.
Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz sprach bei einem Besuch in Washington von einem kolossalen Fortschritt. „Die Sache ist jetzt auf dem Gleis.“ Es sei auf internationaler Bühne der größte Durchbruch in den vergangenen 20 Jahren. Für Deutschland werde die Vereinbarung am Ende mehr Steuereinnahmen bedeuten.
Auch der heimische Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zeigte sich erfreut. „Eine globale Lösung sorgt dafür, dass mehr Fairness in der Besteuerung und zwischen den Ländern erreicht wird. Österreich wird von der globalen Steuerreform in einem erheblichen Maße profitieren und hat immer eine Vorreiterrolle eingenommen“, hieß es in einem Statement.
Die sieben führenden Industriestaaten (G7) hatten sich zuletzt bereits auf ein Grundgerüst geeinigt – mit einer Mindeststeuer für weltweit tätige Unternehmen von 15 Prozent und einer neuen Verteilung der Steuereinnahmen der 100 größten und profitabelsten Konzerne zugunsten von Ländern, in denen diese Unternehmen besonders viel Geschäft machen. Davon dürften vor allem große Schwellenländer profitieren.
Mit der geplanten Jahrhundert-Reform der OECD sollen die Steuerregeln an das Digitalzeitalter angepasst werden. Denn global agierende Konzerne verlegen seit Jahrzehnten Gewinne geschickt in Länder, die sie mit immer niedrigeren Steuersätzen anlocken – und zahlen am Ende vergleichsweise wenig Steuern, meist deutlich weniger als etwa Mittelständler. Vor allem Technologiekonzerne verlagern besonders häufig Gewinne aus Patenten, Software oder Lizenzeinnahmen, die auf geistigem Eigentum basieren. (apa/reuters)
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110933-130-Laender-einigten-sich-auf-Mindeststeuer.html
SIEHE DAZU:
=> 130 countries and jurisdictions join bold new framework for international tax reform – OECD, 1.7.2021
QUELLE: https://www.oecd.org/tax/beps/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
=> Statement
QUELLE (5-Seiten-PDF): https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
COMMENT: Wie schön und gerecht – und alle Finanzminister dieser Welt waren sich nach dem G7-Vorschlag sofort einig: jetzt endlich geht es den pösen, pösen IT-Unternehmen und anderen an den Kragen, die sollen mal endlich ordentlich da Steuer blechen, wo sie ihre Unternehmenseinkommen generieren. Prima, das ist würdig und recht, gell?
Doch halt, wer profitiert? Die Fiskalbehörden der händeaufhaltenden, finanzklammen Staaten.
Und die betroffenen Unternehmen leiden nun und darben? Aber geh: die sehen Steuern als Kosten.
Wer bezahlt die Kosten?
Richtig: die Kosumentinnen und Konsumenten rund um die Welt.
Mithin: die Kosument*innen zahlen brav die Steuern in die Kassen der geldhungrigen Staaten über neue, höhere Dienstleistungs- und Warenpreise.
Aus den Steuereinnahmen werden dann die Subventionen an die p.t. Staatsbürgerschar ausbezahlt.
Die staatlichen Wohltaten zahlt also wer?
Richtig: die Wohltatenempfänger*innen selbst.
Welch‘ wahrhafte Gerechtigkeit!
Und dazu noch ein kleiner, nicht unbedeutender Nebeneffekt: steigende Preise, steigende Inflation.
Schuldschrumpfungseffekt für die hoch verschuldeten Staaten, Entreicherung für die braven Staatsbürger*innen.
Na, aber hallo! Wenn das nicht gerecht ist, wahrhaft würdig und recht?
Aber Unternehmensmonopole zerschlagen, Oligopole von Beginn an verhindern? Aber nein, das bringt doch Steuereinnahmen und nationalen Einfluss weltweit via transnationaler Unternehmen – auch wenn man sich als Staat später dann genau an diese verkauft – und bereits verkauft hat. Ein ungeheures Staatsversagen, Resultat fehlgeleiteten politischen Handelns in der Vergangenheit.
Wer zahlt es?
Menschen.
Welches ist die Münze?
Dieser Menschen Freiheit.
Hans Bentzien: BIZ: weltweit lässt Corona Hauspreise ungewöhnlich stark steigen – Pandemie als Mitursache: veränderte Wohnpräferenzen, Niedrigzinspolitik – Anfälligkeit für größere Korrekturen am Immobilienmarkt: Langsamerer Anstieg der Mieten als jener der Hauspreise, stärkerer bei Hypothekarzinsen und Aneliherenditen – Ursache der Vermögensungleichheit laut BIZ zu simpel beurteilt: Messung von Vermögensungleichheit schwerer als die von Einkommensungleichheit, Anleihekäufe in Frankreich und Deutschland haben Vermögensungleichheit nicht deutlich vertieft – DJN, 29.6.2021
Die Corona-Pandemie hat zu einem weltweit Anstieg der Hauspreise geführt, der nach Einschätzung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in vielen Fällen stärker als fundamental gerechtfertigt ausfiel – auch in Deutschland. Dies berge das Risiko späterer großer Preiskorrekturen und könnte das mittelfristige Wirtschaftswachstum mindern, mahnte die BIZ.
„Ein Anstieg der Hauspreise während einer Rezession ist nichts Ungewöhnliches, unter anderem, weil die akkommodierende Geldpolitik zur Ankurbelung der Wirtschaft auch die Preise von Vermögenswerten stützt, aber die jüngsten Anstiege waren ungewöhnlich hoch“, schreibt die BIZ in ihrem Jahresbericht. Im Durchschnitt der Industrieländer erhöhten sich die Hauspreise demnach um 8,0 Prozent.
Dahinter steckte laut BIZ zum einen die Pandemie selbst. Die Zahl der Hausverkäufe stieg nach einem starken Rückgang Anfang 2020 zum Jahresende und Anfang 2021 deutlich, worin auch veränderte Wohnpräferenzen zum Ausdruck kamen. Viele Haushalte bewerteten aufgrund von Lockdowns und vermehrter Heimarbeit die Kosten eines Pendelns zwischen Wohn- und Arbeitsort neu.
Zum anderen machten es niedrigere Zinsen nicht nur billiger, einen Hauskredit zu bedienen, sie erhöhen auch den Barwert zukünftiger Wohndienstleistungen, was den Wert von Wohneigentum gegenüber der Miete erhöht. Allerdings fiel der Anstieg der Hauspreise in den meisten Ländern deutlich stärker aus, als fundamentale Faktoren wie Zinsen oder Mieten das nahelegten.
So stiegen die Mieten während der Pandemie in den meisten Ländern langsamer, während zugleich Hypothekenzinsen und Anleiherenditen bis Anfang 2021 sanken. „Diese offensichtliche Divergenz zwischen den Hauspreisen und ihren fundamentalen Bestimmungsgrößen könnte die Preise anfälliger für größere Korrekturen in der Zukunft machen, insbesondere wenn die finanziellen Bedingungen weniger günstig werden“, warnt die BIZ.
Zu den Ländern mit ungewöhnlich starken Preissteigerungen zählt die BIZ Deutschland. Aus einer Grafik des Jahresberichts geht hervor, dass der Anstieg der deutschen Hauspreise um knapp 7 Prozentpunkte stärker ausfiel als auf Basis historischer Erfahrungen zu erwarten gewesen wäre. In Frankreich betrug diese Differenz rund 6 Punkte, in Italien 1,5 und in Spanien 2 Punkte.
Dass Zentralbanken über den steigenden Wert von Wohnimmobilien die Vermögensungleichheit in der Bevölkerung verstärkten, diesen Vorwurf schließt sich die BIZ nicht vorbehaltlos an. „Vermögensungleichheit ist schwerer zu messen als Einkommensungleichheit“, gibt sie zu bedenken. Zumindest in Deutschland und Frankreich hätten die groß angelegten Anleihekäufe in der Finanzkrise die Ungleichheit nicht deutlich gesteigert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53278125-biz-corona-laesst-hauspreise-ungewoehnlich-stark-steigen-015.htm
Digitalisierung: Weltweit rechnen Manager mit dem Ende der Bankfilialen bis 2026 – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 29./30.6.2021
Die Mehrheit der Banker rechnet laut einer aktuellen Umfrage in den nächsten fünf Jahren mit einem Aussterben filialbasierter Geschäftsmodelle.
In der Coronakrise haben etliche Menschen die Erfahrung gemacht, dass sich die allermeisten Bankgeschäfte ohne den Besuch einer Filiale erledigen lassen. Auch bei vielen Finanzmanagern hat deshalb ein Umdenken stattgefunden.
In einer Umfrage unter 305 Bankmanagern weltweit gaben 65 Prozent an, dass sie es für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich halten, dass filialbasierte Geschäftsmodelle in den kommenden fünf Jahren aussterben. Vor vier Jahren lag die Zustimmung zu dieser Aussage lediglich bei 35 Prozent.
Die Umfrage wird jährlich von der Research-Abteilung des britischen Economist durchgeführt und vom Softwarekonzern Temenos bezahlt. Bei der Umfrage gaben vor allem Spitzenmanager aus Nordamerika (70 Prozent), Europa (69 Prozent) und Afrika (68) an, dass sie den Tod klassischer Filialbanken in den nächsten fünf Jahren für wahrscheinlich halten. In Lateinamerika (58 Prozent) und der Region Asien-Pazifik (55 Prozent) fiel die Zustimmung geringer aus.
QUELLE: (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/digitalisierung-manager-rechnen-mit-dem-ende-der-bankfilialen-bis-2026-/27364972.html
BÖRSEN
SENTIX-Sentiment: Da passt was bei den Anleihen nicht zusammen; Öl und China als Trigger für eine Korrektur? – SENTIX, 4.7.2021
Die Rentenkurse scheinen stabil. Im Hintergrund ist jedoch das strategische Grundvertrauen abgesackt, die Positionierung ist umgekehrt viel zu hoch. Diese Entwicklungen passen nicht zusammen, zumal die jüngsten Konjunkturzahlen Öl ins Feuer gießen. Die neuesten Juli-Daten vom „first mover“ weisen den Weg. Apropos Öl: Beim schwarzen Gold steigen die Risikofaktoren erneut an. Deutlich entspannter sieht es bei den Edelmetallen aus.
Weitere Ergebnisse: * Aktien: Störfaktor China * Rohöl: Risikoradar mit negativem Signal
QUELLE: https://www.sentix.de/
Nachhaltigkeitsstandards: Globale Aufseher wollen Anleger vor „Greenwashing“ schützen – ESG-Kriterien bei Anlegern zunehmend an Bedeutung. Doch Aufseher sind besorgt, was die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Informationen angeht – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 30.6.2021
Nachhaltige Investments boomen. Doch wie nachhaltig ist das Geld wirklich angelegt? Die Beantwortung dieser Frage gestaltet sich überraschend schwierig. Denn bei den Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen geht es bunt durcheinander, je nachdem, welche der darauf spezialisierten Agenturen ihr Urteil abgibt.
# Ein wichtiger Grund für die abweichenden Urteile sind unterschiedliche Schwerpunkte bei den drei Nachhaltigkeitsthemen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. „Manche schauen mehr auf Ökologie, andere stärker auf Soziales, wieder andere auf Unternehmensführung“, erklärt Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit bei Union Investment.
# Eine weitere Rolle spielen unterschiedliche Messweisen für einzelne Kriterien. Das Thema Fortbildung, ein Unterpunkt für die soziale Bewertung, bewertet Sustainalytics anhand der Anzahl von Fortbildungsteilnehmern, S&P wiederum mit den pro Teilnehmer eingesetzten Stunden.
# Ein gutes Beispiel für unterschiedliche Einschätzungen durch unterschiedliche Sichtweisen ist Tesla. Manche Häuser benoten den E-Autobauer schlecht, etwa wegen Treibhausgasemissionen bei der Lithiumförderung zur Batterieproduktion und den Recyclingprobleme bei den Batterien. Andere Bewerter stufen Tesla genau wegen dieses Geschäftsmodells gut ein, während die Autobranche insgesamt noch von Verbrennern abhängt.
Wichtig ist: Alle Beurteilungen sind nur Momentaufnahmen. Wenn es um die Beurteilung von Unternehmen geht, rät Louis Larere, Fondsmanager bei Zadig Asset Management, öffentlich vorliegende Informationen wie Bilanzen und Nachhaltigkeitsberichte zu durchforsten. Mindestens einen Nachteil habe dieser Ansatz aber: „Das ist zeitaufwendig“. QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/nachhaltigkeitsstandards-globale-aufseher-wollen-anleger-vor-greenwashing-schuetzen/27379768.html
Astrid Dörner und Kollegen: Morgen Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs: Milliarden für die Aktionäre: US-Banken schütten großzügig Kapital aus – HANDELSBALTT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 28./30.6.2021
Die großen Wall-Street-Häuser starten nach der Freigabe durch die US-Notenbank mit umfangreichen Kapitalausschüttungen. Auch in Europa zeichnen sich Lockerungen ab. Experten warnen.
Amerikas Banken sind als große Gewinner aus der Coronakrise hervorgegangen und haben großzügige Dividenden für ihre Aktionäre verkündet. Insgesamt stockten die Banken laut Berechnungen von Experten die Ausschüttungen um rund zwei Milliarden Dollar auf:
# Morgan Stanley will die Dividende im dritten Quartal auf 0,70 Dollar pro Aktie verdoppeln. Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Erhöhung auf etwa 50 US-Cent pro Aktie von derzeit 35 US-Cent gerechnet. Die Bank kündigte außerdem an, die Ausgaben für Aktienrückkäufe um 20 Prozent auf zwölf Milliarden Dollar zu erhöhen.
# Auch der Rivale JP Morgan zahlt seinen Anteilseignern mehr aus: Die größte Bank der USA kündigte an, die Ausschüttung im dritten Quartal von 90 US-Cent auf 1,00 Dollar pro Aktie anzuheben.
# Goldman Sachs teilte mit, statt 1,25 Dollar pro Aktie nun 2,00 Dollar auszuschütten. Die Bank of America wird ab dem dritten Quartal den Investoren 17 Prozent mehr pro Anteilschein zahlen: Die Dividende steige auf 21 US-Cent pro Aktie.
QUELLE: (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/morgen-stanley-jp-morgan-goldman-sachs-milliarden-fuer-die-aktionaere-us-banken-schuetten-grosszuegig-kapital-aus/27372848.html
Patrick Herger: US-Börsen – Wie 13 Amateure zu Superinvestoren wurden – und was dies mit den derzeitigen Börsen-Rekordständen zu tun hat – Nur wenn der Trend gefestigt ist: Trendfolgestrategie als Mittel zum Börsenerfolg – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021
Die Wette eines Börsen-Tycoons mit einem befreundeten Händler war der Startpunkt für eine der bedeutsamsten Wall-Street-Legenden. Was sie mit Trendfolge-Strategien und den momentanen Rekordständen von Börsenindizes zu tun hat.
Zwei Dinge begründeten den Ruf von Richard Dennis als Börsen-Superstar: sein Erfolg und sein Reichtum in jungen Jahren. Zu Beginn der achtziger Jahre soll der damals 31-jährige Commodity-Trader ein Vermögen von 400 Mio. $ besessen haben, erwirtschaftet innerhalb eines Jahrzehnts mit einem Startkapital von weniger als 2000 $. Ein befreundeter Investor, William Eckhardt, war deshalb der Meinung, dass Dennis von der Natur mit einem aussergewöhnlichen Investment-Talent ausgestattet worden sei.
Dennis selbst sah die Sache anders. Er glaubte, dass Begabung nur wenig mit Börsen-Erfolg zu tun habe. Erfolgreiche Händler liessen sich, meinte Dennis, so schnell und effizient produzieren wie Schildkröten auf Schildkrötenfarmen; er könne praktisch jeden in einen erfolgreichen Trader verwandeln. Diese Ansicht war der Ausgangspunkt für die Wall-Street-Legende über die sogenannten «Turtle Traders».
Dennis und Eckhardt schlossen nämlich eine Wette ab, ob Talent für Börsenerfolg notwendig sei oder Handwerk ausreiche. Um die Wette zu entscheiden, schalteten sie im «Wall Street Journal» und in der «New York Times» Anzeigen, dass Dennis einige wenige Interessierte zu Tradern ausbilden wolle. Der jugendliche Rohstoff-Händler wählte schliesslich 13 Personen aus, die ursprünglichen Turtle-Trader, die in einem 14-tägigen Lehrgang ein einfaches System von Handelsregeln lernten (später kamen noch zehn weitere Personen dazu, einer der Gründe, warum verschiedene Angaben über die Zahl der Trader existieren).
*** Wie erfolgreich waren die Turtle-Trader? ***
Die 13 Amateure erzielten laut Aussage von Curtis Faith, einem der ursprünglichen Turtle-Trader, in den knapp fünf Jahren des Experiments einen Gewinn von durchschnittlich 80% im Jahr. Wie haben sie das angestellt, welche Regeln verhalfen ihnen zu diesen Superrenditen? Mittlerweile finden sich im Internet mehrere Quellen, in denen die Strategie beschrieben ist, welcher die Turtle-Trader folgten.
Im Prinzip handelte es sich um ein einfaches Trendfolge-System, wobei die Trader sich auf Futures-Märkte konzentrierten. Sie wetteten sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse, wenn durch die Preise ein Signal entstand, das die Etablierung eines entsprechenden Trends anzeigte. Allerdings sehen manche Investoren in dieser Legende eher eine Mahnung als eine Erfolgsgeschichte.
Denn die Strategie der Turtle-Trader funktionierte nur gerade bis zum Ende des Experiments gut. Danach waren die Renditen deutlich kleiner oder, wie bei S&P Futures zwischen 2000 und 2019, sogar negativ. Dennis selbst erlitt im Jahr 1987 hohe Verluste. Sein Ansatz war besonders anfällig für die Art Crash, die sich 1987 abspielte. Bis im August 1987 hatte der Dow Jones einen Rekord nach dem anderen verbucht. Im Oktober kam der Crash; der US-Index verlor am «schwarzen Montag» innerhalb eines Tages 23% an Wert.
*** Auf hohe Preise folgen im Normalfall noch höhere Preise ***
Manche Investoren sehen Parallelen zwischen der Börsensituation von 1987 und heute, weshalb sie einen starken Rückgang für möglich halten. Tatsächlich verzeichnen die Leitindizes der USA, der Dow Jones und der S&P 500, im bisherigen Jahresverlauf Rekord um Rekord. Ist es daher überdurchschnittlich riskant und angesichts der hohen Kurse unvorsichtig, jetzt auf Trendfolge-Strategien zu setzen?
Um diese Frage zu beantworten, gilt es zu bedenken, dass viele Trendfolge-Systeme weniger Crash-anfällig sind als dasjenige von Richard Dennis. Ausserdem ziehen hohe Preise oft noch höhere Preise nach sich. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn die Börsen Rekordstände erreichen. Der S&P 500 etwa hatte seit 1950 in rund der Hälfte der Zeit ein Niveau, das weniger als 5% von einem Rekordhoch entfernt war. Nun könnte es allerdings sein, dass sich die Renditen je nach Indexniveau unterscheiden.

Dem ist aber nicht so. Wenn sich der S&P 500 nahe bei seinem Rekordhoch befindet, sind die Renditen über die folgenden 12 Monate ähnlich denen, die er erzielt, wenn er weiter als 5% vom Rekordhoch entfernt ist. Schaut man sich die Performance über die nachfolgenden drei Jahre an, schneidet der S&P 500 sogar besser ab, wenn er nahe an einem Rekordhoch notiert.
*** Einfachheit ist Trumpf: eine erstaunliche Strategie aus dem Internet ***
Dass es für aktive Investoren, die schnell auf veränderte Marktlagen reagieren, eine gute Idee sein kann, bei Höchstkursen einzusteigen, verdeutlicht eine simple Strategie, die vor einiger Zeit im Internet die Runde machte. Dabei investiert ein Investor nur in einen Index, wenn dieser am Ende des Monats auf einem Rekordhoch liegt, sonst investiert er in Obligationen. Immer am Ende des Monats wiederholt der Investor diese Entscheidung. Es zeigte sich, dass diese Strategie in der Vergangenheit bei einem tieferen Risiko bessere Ergebnisse lieferte als Kaufen und Halten (Buy and Hold), egal ob man US-Aktien, internationale Aktien, Rohstoffe, Gold oder REIT betrachtet. Allerdings sind die Transaktionskosten bei einer solchen Strategie einzurechnen.
Die Finanzmarktforschung zeigt ebenfalls, dass Trendfolge-Strategien Überrenditen erzielen. Die grundlegendste Trendfolge-Strategie ist das Zeitreihen-Momentum – ein Investor setzt in Märkten mit einer in der Vergangenheit positiven Preisentwicklung auf weiterhin steigende Kurse, in Märkten mit einer in der Vergangenheit negativen Preisentwicklung auf weiterhin fallende Kurse. Dabei wird meist die Preisentwicklung der vergangenen ein bis 12 Monate herangezogen. Privatinvestoren setzen diesen Ansatz häufig mit einem monatlichen Rebalancing um. Sie passen das Portfolio also an jedem Monatsende an ein eventuell verändertes Momentum an.
*** Umfassende Studie: Was die Wissenschaft zu Trendfolge-Strategien sagt ***
Eine der umfassendsten Studien zu dieser simplen Momentum-Variante ist «A Century of Evidence on Trend-Following Investing», wobei die Erkenntnisse in einer erweiterten Folgestudie bestätigt wurden. Die Autoren Brian Hurst, Yao Hua Ooi und Lasse Heje Pedersen verwenden Daten, die bis 1880 zurückreichen. Ausserdem betrachten sie 67 Märkte in den vier wichtigsten Anlageklassen: 29 Rohstoffe, 11 Aktienindizes, 15 Anleihenmärkte und 12 Währungspaare. Für ihre Studie kombinierten sie nicht nur eine grosse Anzahl vorhandener Datensätze, sondern sammelten auch neue Daten, die der Forschung zuvor nicht zur Verfügung standen. Was sind die Ergebnisse der Studie?
In jedem betrachteten Jahrzehnt seit 1880 finden sich Überrenditen für Momentum. Diese Renditen haben es allerdings in sich. Sie sind ausserordentlich gross. So gross, dass selbst dann noch positive Renditen bestehen, wenn man von den erzielten Bruttorenditen Kosten, sehr hohe Gebühren sowie den risikofreien Zins abzieht.
Vielleicht noch erstaunlicher ist allerdings der Umstand, dass Momentum gerade in Krisenzeiten besonders gut zu funktionieren scheint, deutlich besser etwa als ein «Buy-and-hold-»Portfolio, das zu 40% aus Obligationen und zu 60% aus Aktien besteht. So zeigt die Studie, dass Momentum in den zehn grössten Börsencrashs nur in zwei Fällen eine Negativrendite zu verzeichnen hatte: in der Rezession von 1937 und beim Börsencrash 1987. Während der Weltwirtschaftskrise oder der globalen Finanzkrise waren die Renditen von Momentum jedoch deutlich positiv. Insofern bestätigt sich also, dass Richard Dennis das grosse Pech hatte, auf eine Krise zu treffen, die für Momentum im Allgemeinen und seine Art im Speziellen besonders nachteilig war.
*** Was heisst das für Privatinvestoren? ***
Die Finanzmarktforschung zeigt, dass Trendfolge-Strategien gut mit hohen Kursen umgehen können, insbesondere, weil die Chance gross ist, dass hohe Kurse noch höheren Kursen Platz machen. Ausserdem sind Trendfolge-Strategien besonders erfolgreich, wenn die Börsen grosse Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen verzeichnen.
So könnten sie auch im gegenwärtigen Börsenklima eine gute Wahl für aktive Privatanleger sein. Auf der einen Seite verlangsamen die Markteingriffe der Zentralbanken die Geschwindigkeit, mit der bestimmte Informationen in die Kurse eingepreist werden; das begünstigt das Entstehen von Trends. Auf der anderen Seite besitzen viele Trendfolge-Strategien immanente Absicherungseigenschaften gegen grosse Negativ-Ereignisse. Wer daher einen Teil seines Portfolios für Trendfolge-Strategien reserviert, senkt häufig dessen Volatilität, während die Rendite gleich bleibt oder steigt.
Für Anleger, die an Investment-Strategien interessiert sind, kann es sich zudem lohnen, eingehender die Investment-Regeln zu studieren, die Richard Dennis für die von ihm trainierten Händler festgelegt hat. Sie bieten lehrreiches Anschauungsmaterial unter anderem zu den Themen Positionsmanagement und Emotionskontrolle.
Natürlich können auch Privatanleger, die nicht aktiv handeln möchten, von Momentum-Strategien profitieren. Es gibt zahlreiche Exchange-Traded Funds (ETF), die versuchen, sie abzubilden. Allerdings zeigen manche Momentum-ETF insbesondere bei den Absicherungseigenschaften Schwächen, der Kursrückgang in schwierigen Börsenphasen liegt häufig in einem ähnlichen Grössenbereich wie derjenige des Gesamtmarkts. Insofern müssen sich Anleger genau über die Produkte informieren.
Und schliesslich verdeutlicht die Legende von den Turtle-Tradern zwei für private Anleger grundlegende Punkte. Erstens: Selbst Strategien, die jahrelang gute Renditen bringen, können plötzlich aufhören zu funktionieren. Zweitens: Für gute Investment-Ergebnisse braucht es keine besondere Begabung, solides Handwerk genügt. Deshalb kann jeder zu einem erfolgreichen Investor werden.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/finanzen/fonds/momentum-trendfolge-strategien-koennen-eine-beimischung-sein-ld.1633243
SIEHE DAZU
=> Intratext-Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Dennis
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Montag
https://mebfaber.com/2019/11/04/is-buying-stocks-at-an-all-time-high-a-good-idea/
=> Studien
==> Brian Hurst et al.: A Century of Evidence on Trend-Following Investing, 27.6.2017
QUELLE: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993026
==> Abilash Babu et al.: Trends Everywhere – Journal of Investment Management, Forthcoming, 17.5.1019
QUELLE: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3386035
Wird man mit einem hohen IQ reich? Die Antwort überrascht: Der Zusammenhang ist schwach ausgeprägt – Entscheidend ist auch das Geburtsland – Cash-online, 2.7.2021
Der US-amerikanische Unternehmer Robert T. Kiyosaki sagte einmal: „Intelligenz löst Probleme und bringt Geld“. Aber wie stark ist tatsächlich die Verbindung zwischen Gehirnleistung und der Größe des Bankkontos?
Nicht sehr stark, wie Moneytransfers.com herausfand. Die Plattform verglich die durchschnittlichen IQ-Werte von verschiedenen europäischen Ländern mit dem durchschnittlichen Vermögen ihrer Einwohner und untersuchte die Ergebnisse.
Die Deutschen lagen beim IQ einen Punkt hinter Spanien, aber das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf war in Deutschland um 16.903 USD höher.
Einige Länder zeigten einen starken Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen IQ und dem Pro-Kopf-Einkommen, aber äußere Einflüsse, die weiter unten erklärt werden, scheinen dabei einen größeren Effekt zu haben. Nach den Untersuchungen von Moneytransfers.com führt ein höherer IQ nicht unbedingt dazu, dass man mehr Geld verdient. Wie frühere wissenschaftliche Studien schon gezeigt haben, kann das jeweilige Geburtsland einen weitaus größeren Einfluss darauf haben.
QUELLE: https://www.cash-online.de/investmentfonds/2021/wird-man-mit-einem-hohen-iq-reich-die-antwort-wird-sie-ueberraschen/569404
Wiener Börse: Aufschwung am österreichischen Aktienmarkt sorgt im 1. Halbjahr weiter für hohe Aktienumsätze – ATX Total Return erreichte Allzeit-Hoch im Juni – Aktienumsatz mit 39 Mrd. EUR im 1. HJ 2021 stabil auf Vorjahresniveau – Drei Neuzugänge im direct market plus – Rekordstand bei Anleihen-Neulistings – Wiener Börse, 2.7.2021
Im 250. Jubiläumsjahr der Wiener Börse profitiert der österreichische Aktienmarkt vom Konjunkturaufschwung. Inklusive Dividenden erreicht der Nationalindex ATX sein Allzeithoch. Im ersten Halbjahr 2021 hängte der ATX alle entwickelten Märkte ab. Das beflügelte die Aktienumsätze an der Wiener Börse. Das Einstiegssegment der Wiener Börse wird indessen fleißig genutzt: beaconsmind AG, Biogena Group Invest AG und XB Systems AG läuteten ihren ersten Handelstag im direct market plus ein. Mit 3.217 Anleihen übertraf die Anzahl neuer Bonds per 30. Juni 2021 bereits jene des Gesamtjahres 2020. …
QUELLE: https://r.info.wienerborse.at/mk/mr/j1F9vOLN56cIV-_awEVhwWPT7Ld3DtkPG0cvMo9ZVGM5vy0RQoOJUuk3mgoBjpcjoH1mnpn5MvVVmFary9dHUzx8ebr9HdpKcbO8a1dUq0whhg
ZENTRALBANKEN
- USA /FED
Hans Bentzien: IWF empfiehlt: US-Notenbank soll Mitte 2022 mit Tapering beginnen – Grundlage dafür sind abermals verbesserte US-Wirtschaftsaussichten und die zu erwartende anziehende Inflation – DJN, 12.7.2021
Die US-Notenbank muss nach Überzeugung des Internationalen Währungsfonds (IWF) Mitte des nächsten Jahres damit beginnen, ihre Wertpapierkäufe zurückzufahren. „In den kommenden Monaten werden das anhaltend schnelle Tempo der Erholung und die Erwartung zusätzlicher fiskalischer Unterstützung eine Änderung der Geldpolitik erforderlich machen“, schreibt der IWF zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen. Die Wiederbelebung der Wirtschaft werde in den nächsten Monaten zu erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf den Kurs der PCE-Inflation führen, so dass es sehr schwierig sein werde, die zugrunde liegenden Inflationstrends zu erkennen.
„Gleichzeitig müssten die Leitzinsen unter der Annahme, dass der Basisausblick und die fiskalpolitischen Annahmen des Stabes realisiert werden, wahrscheinlich Ende 2022 oder Anfang 2023 zu steigen beginnen, wobei die Ankäufe von Vermögenswerten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zurückgeführt werden“, heißt es in dem Bericht.
Der IWF hat seine Prognosen für das US-Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr gegenüber denen des Weltwirtschaftsausblicks von April angehoben. Er erwartet für 2021 und 2022 jetzt einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 7,0 (bisher: 6,4) sowie 4,9 (3,5) Prozent. Die Arbeitslosenquote sieht er bei 4,4 (5,8) und 3,1 (4,2) Prozent.
Vergleichbare Inflationsprognosen enthält der Bericht allerdings nicht. Im Weltwirtschaftsausblick hatte der IWF einen jahresdurchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,3 und 2,4 Prozent prognostiziert. Die Prognosen des aktuellen Berichts beziehen sich auf die Jahresveränderungsrate des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) und dessen Kerngröße im vierten Quartal des jeweiligen Jahres. Es werden 4,3 (Kern: 3,7) und 2,4 (2,4) Prozent Teuerung erwartet.
Der PCE-Deflator ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Der IWF rechnet damit, dass die Fed-Funds-Rate Ende 2022 bei 0,40 Prozent liegen wird.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53311159-iwf-us-notenbank-beginnt-mitte-2022-mit-tapering-015.htm
- Europäische Union / EZB
Hans Bentzien: Systemrisikorat (ESRB) warnt vor mehr Unternehmensinsolvenzen und NPL – erste Anzeichen für einen Anstieg der notleidenden Kredite (Non-performing Loans – NPL) – DJN, 1.7.2021
Der Systemrisikorat ESRB sieht nach den Worten seiner Vorsitzenden Christine Lagarde in einem potenziellen Anstieg von Unternehmensinsolvenzen ein wichtiges Risiko für die Finanzstabilität des Euroraums. Im Vorwort des ESRB-Jahresberichts nennt Lagarde daneben das schwierige makroökonomische Umfeld für Finanzinstitute sowie neue Finanzmarktturbulenzen.
„Die wichtigsten identifizierten Risiken sind ein potenzieller Anstieg der Insolvenzen im privaten Sektor als Folge der tiefen globalen Rezession, das schwierige makroökonomische Umfeld für Banken, Versicherer und Pensionsfonds, eine starke Neubepreisung von Risiken und das Auftreten von Marktilliquidität, starke Preiskorrekturen auf den Märkten für Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie das mögliche Wiederauftreten von Risiken in der Staatsfinanzierung“, schreibt Lagarde in dem Bericht.
Als weitere Risiken führte Lagarde Bedrohungen durch systemweite Cyber-Vorfälle, Störungen der kritischen Finanzinfrastruktur sowie den Klimawandel und die zu seiner Bremsung ergriffenen Maßnahmen („Übergangsrisiken“) an.
In dem Bericht weist der ESRB auf erste Anzeichen für einen Anstieg der notleidenden Kredite (Non-performing Loans – NPL) hin. „Die NPL-Quoten sind noch nicht gestiegen, aber das Volumen von Krediten, die nach der IFRS-Terminologie der Stufe 2 zuzuordnen sind, und das Volumen restrukturierter Kredite hat zugenommen – insbesondere bei Krediten unter Moratorien und anderen öffentlichen Unterstützungsprogrammen“, heißt es dort.
Eine Verschlechterung der Asset-Qualität und ein steigender Vorsorgebedarf würden sich auf die Kapitalposition der Banken auswirken, die bereits jetzt unter strukturellen Schwächen, einschließlich einer geringen Rentabilität, litten. Sorge bereiten dem ESRB vor allen die großen Unterschiede bei der Vorsorge. Mit der Anerkennung von Verlusten so lange zu warten, bis Moratorien und Garantieprogramme ausliefen, würde das Risiko von Kliff-Effekten erhöhen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53300960-esrb-warnt-vor-mehr-unternehmensinsolvenzen-und-npl-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Enria beklagt hohe Risikoneigung von Banken bei der Kreditvergabe an hoch verschuldete Unternehmen – ColateraIized Loan Obligations mit immer weniger Covenants: abnehmende Verhaltenseinschränkungen von Kreditnehmern und somit abnehmender Schutz der Investoren – Jagd nach Rendite verbreitert Investorenbasis, direkte Bankenexposition gesunken, indirekte hingegen gestiegen – Zunehmend im Fokus der Bankenaufsicht: Banken mit verstärktem Engagement im Leveraged-Loan-Geschäft – DJN, 2.7.2021
Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat eine zu hohe Risikoneigung großer Banken im Euroraum bei der Kreditvergabe an hoch verschuldete Unternehmen (Leveraged Loans) beklagt und höhere Eigenkapitalanforderungen in Aussicht gestellt. In einer Veranstaltung der Universita degli Studi di Napoli Federico II sagte Enria: „Leveraged Loans wurden so gezeichnet, dass sie Unternehmen mit einem immer höheren Verschuldungsgrad anzogen, was sich darin zeigte, dass die ausstehenden Schulden der Kreditnehmer ein immer größeres Vielfaches ihrer Ertragskraft ausmachten.“
Auf der anderen Seite seien dieselben Kredite über Verbriefung (Colateralized Loan Obligations – CLO) so strukturiert worden, dass sie immer weniger Covenants enthielten, das heißt die vertraglichen Beschränkungen und finanziellen Parameter, die regeln, wie Unternehmenskreditnehmer agieren können und die die Interessen der Investoren schützen sollten.
Laut Enria führte die Jagd nach Rendite zu einer Verbreiterung der Investorenbasis. Das verringerte einerseits die direkte Exponierung der Banken gegenüber solchen riskanten Krediten. Andererseits setze es breitere Kreise der Finanzindustrie einem höheren Risiko aus, was wiederum die indirekte Exponierung der Banken steigerte und womöglich die Transparenz verringere.
„Innerhalb von CLOs werden zum Beispiel die meisten der risikoreicheren (Junior- und Mezzanine-) Tranchen an Vermögensverwalter, Versicherungsfonds, Hedgefonds und strukturierte Kreditfonds verkauft, während die meisten Senior-Tranchen von Banken gekauft werden“, erläuterte Enria. Viele der riskanten Merkmale, die laut Enria für CLOs im Vorfeld der großen Finanzkrise typisch waren, gibt es derzeit nicht mehr. „Aber trotzdem erhöhen sie zwangsläufig die Verflechtungen und Konzentrationen auf dem Markt für riskante Kredite“, warnte der Bankenaufseher.
Die EZB will jenen Banken, die ihr Engagement im Leveraged-Loan-Geschäft ausgeweitet haben Enria zufolge verstärkt auf die Finger schauen. „Insbesondere in Schlüsselbereichen wie der Leveraged Finance, in denen frühere aufsichtsrechtliche Vorgaben von den Banken nicht ausreichend umgesetzt wurden, planen wir, das gesamte Spektrum der uns zur Verfügung stehenden aufsichtsrechtlichen Instrumente einzusetzen, einschließlich Mindestkapitalanforderungen, die dem spezifischen Risikoprofil der einzelnen Banken angemessen sind, falls dies erforderlich sein sollte“, sagte er.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53315068-ezb-enria-beklagt-hohe-risikoneigung-von-banken-015.htm
EZB-Präsidentin Lagarde sieht noch keinen nachhaltigen Aufschwung – Inflationsanstieg ist nur vorübergehend – dpa-AFX, 2.7.2021
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sieht noch keinen stabilen konjunkturellen Aufschwung in der Eurozone nach dem Corona-Einbruch. Eine „nachhaltige Erholung“ sei noch nicht erreicht, sagte Lagarde am Freitag der französischen Zeitung „La Provence“. Die Notenbankchefin machte darüber hinaus abermals deutlich, dass der jüngste Anstieg der Inflation im gemeinsamen Währungsraum nur vorübergehend sei.
„Wir werden eine Rückkehr zu niedrigeren Inflationsraten sehen“, versicherte Lagarde. Im Mai hatte die Inflationsrate in der Eurozone bei 2,0 Prozent gelegen und sank im Juni auf 1,9 Prozent. Ökonomen rechnen aber in den kommenden Monaten mit einer steigenden Teuerung, wobei die Inflationsrate in den kommenden Monaten bis in die Nähe von drei Prozent steigen könnte.
Die Notenbankpräsidentin verwies in dem Interview auf die jüngsten Inflationsprognosen der EZB. Demnach wird für das Gesamtjahr 2021 eine Inflationsrate von 1,9 Prozent erwartet, die dann im kommenden Jahr auf 1,5 Prozent sinken dürfte. Die Notenbank peilt beim Ziel der Preisstabilität eine Inflationsrate von mittelfristig knapp zwei Prozent an.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53312281-ezb-praesidentin-lagarde-sieht-noch-keinen-nachhaltigen-aufschwung-016.htm
Hans Bentzien: EZB/Lagarde sieht Chance grüner Kapitalmarktunion im Euroraum – DJN, 29.6.2021
Der Euroraum ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde besonders gut für den Aufbau einer grünen Kapitalmarktunion geeignet. In einer Rede beim Brussels Economic Forum 2021 nannte Lagarde drei Argumente für ihre These.
1. Kapitalmärkte sind besonders gut geeignet, um Finanzierungen in zukunftsorientierte Sektoren wie grüne und digitale Sektoren zu lenken. „Obwohl Banken eine wichtige Rolle spielen, sind die Kapitalmärkte besser in der Lage, Projekte mit einem definierten Zweck zu finanzieren und den Investoren direkt die Wirkung zu ermöglichen, die sie erreichen wollen“, sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext. Kapitalmärkte könnten innovativere Investitionsvehikel anbieten. Und seien sind besser in der Lage, Kleinanleger zur Unterstützung solcher Aktivitäten zu bewegen.
2. „Europa ist der bevorzugte Standort für die weltweite Emission grüner Anleihen – rund 60 Prozent aller grünen, vorrangigen unbesicherten Anleihen, die im Jahr 2020 ausgegeben wurden, stammen von hier“, sagte Lagarde. Der Markt wachse rasant, das ausstehende Volumen der in der EU emittierten grünen Anleihen habe sich seit 2015 fast verachtfacht. Darüber hinaus habe der Euro die Führung als globale Währung für grüne Finanzierungen übernommen. Im vergangenen Jahr sei etwa die Hälfte aller weltweit emittierten grünen Anleihen in Euro ausgegeben worden.
3. Die grüne Kapitalmarktunion ist ein Bereich, in dem Europa das Potenzial habe, schnelle Fortschritte zu machen, da sie nicht mit den gleichen Herausforderungen verbunden ist wie konventionelle Kapitalmärkte. Die EU-Kommission arbeitet an der Vollendung einer vollständigen Kapitalmarktunion, aber das wird Zeit brauchen, zum Teil, weil sich die Kapitalmärkte auf nationaler Ebene entwickelt haben. Sie müssen zunächst geöffnet und harmonisiert werden. Lagarde: „Aber der Markt für grüne Anleihen steht nicht vor denselben Hindernissen. Tatsächlich hat er bereits eine größere paneuropäische Dimension erreicht als der konventionelle Anleihenmarkt.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53280283-ezb-lagarde-sieht-chance-gruener-kapitalmarktunion-im-euroraum-015.htm
Hans Bentzien: Lagarde: Board des Systemrisikorats (ESRB) könnte Empfehlung zu Dividendenverzicht zurücknehmen – Beratung dazu am 23.9.2021 – DJN, 1.7.2021
Der Board des Systemrisikorats (ESRB) könnte im September seine Empfehlung an Banken zurücknehmen, auf die Ausschüttung von Dividenden zu verzichten. ESRB-Chefin Christine Lagarde sagte in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments, der General Board des ESRB habe in der vergangenen Woche festgestellt, dass er die Empfehlung an Banken, während der Covid-Pandemie auf Ausschüttungen zu verzichten, per Ende September zurücknehmen könnte, wenn sich die ökonomischen und finanziellen Bedingungen nicht deutlich verschlechterten. „Der General Board wird diese Angelegenheit bei seinem nächsten Meeting am 23. September 2021 beraten“, sagte Lagarde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53300478-lagarde-esrb-koennte-empfehlung-zu-dividendenverzicht-zuruecknehmen-015.htm
SIEHE DAZU
=> Hans Bentzien: EZB/Enria stellt Ende von Dividendenverbot in Aussicht – DJN, 1.7.2021
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53301458-ezb-enria-stellt-ende-von-dividendenverbot-in-aussicht-015.htm
=> EZB-Aufseher stellen Ende von Dividendenstopp für Banken in Aussicht – dpa-AFX, 2.7.2021
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53314027-ezb-aufseher-stellen-ende-von-dividendenstopp-fuer-banken-in-aussicht-016.htm
Hans Bentzien: Angeloni: EZB-Reaktion auf fiskalische Notlagen erleichtern – Kooperation mit Regierungen nötig: neue Spannungen im Euroraum, wenn Anleihekäufe auslaufen – Angeloni: Politische Unabhängigkeit bleibt trotz Zusammenarbeit mit Regierungen gewahrt – EZB-Direktor Fabio Panetta: EZB dauerhaft eine gezielte Beeinflussung der Staatsanleihezinsen einzelner Euro-Länder ermöglichen – DJN, 30.6.2021
Ignazio Angeloni, ein ehemaliges Mitglied der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) wünscht sich für die EZB mehr Flexibilität bei der Reaktion auf fiskalische Notlagen in einzelnen Euro-Ländern. In einem Beitrag für den Think Tank Omfif schreibt der Ökonom, Mario Draghis berühmtes „What ever it takes“-Statement habe die Bewahrung des Euro effektiv zu einem Ziel der EZB gemacht, von dem andere EZB-Präsidenten wahrscheinlich nicht zurücktreten wollten. Doch dazu brauche es die Unterstützung der Regierungen.
„Die Erklärung von 2012 war eine Notfallreaktion, die unter besonderen Bedingungen angewendet wurde und nur schwer zu wiederholen sein wird. Der Mechanismus, der diese potenzielle Krise abgewendet hat, sollte für andere Situationen verfügbar gemacht werden“, so Angeloni, der heute Senior Fellow an der Harvard Kennedy School und am Leibniz Institute for Financial Research Safe ist.
Angeloni ist der Ansicht, dass im Euroraum neue Spannungen zutage treten werden, sobald die umfangreichen Käufe der EZB auslaufen. „Die Zentralbank kann diesen Spannungen entgegenwirken, aber um dies glaubwürdig und effektiv zu tun, braucht sie die Unterstützung der Regierungen“, schreibt Angeloni. Das sei eine politische Frage, die aber auch die Strategie der Zentralbank betreffe.
Angeloni zufolge müssen die Bedingungen, die Interventionen der Zentralbank auslösen, flexibler gestaltet werden, ohne dass dabei die Konditionalität aufgegeben wird. „Haushaltsregeln sind ein wesentlicher Teil des Designs, aber die Zentralbank sollte auch einen Schritt nach vorne machen und anerkennen, dass ihre Instrumente nicht immer ausreichend sind und dass die Koordination mit den Regierungen ihre Unabhängigkeit nicht schwächt, wenn sie freiwillig und im Einklang mit ihren Zielen erfolgt“, argumentiert der Ökonom.
Die neue Strategie biete der EZB die Chance, alte Vorurteile zu überwinden und Offenheit für eine geldpolitische Zusammenarbeit zu signalisieren. „Damit – und nur damit – kann die Gefahr einer neuen Euro-Krise endlich und endgültig gebannt werden“, urteilt Angeloni.
Das von Draghis berühmtem Satz inspirierte, aber nie umgesetzte Versprechen der EZB, im Notfall gezielt Anleihen eines Staats zu kaufen, dessen Zinsen sie für zu hoch hält (Outright Monetary Transactions – OMT), ist mit verschiedenen Voraussetzungen verbunden: Einem EU-Hilfsprogramm, das mit wirtschaftspolitischen Auflagen verbunden war und Anleihekäufen des Rettungsfonds ESM am Primärmarkt.
In der Corona-Krise beschloss der EZB-Rat, vorübergehend verstärkt Anleihen jener Staaten zu kaufen, deren Wirtschaft besonders stark von der Pandemie betroffen war. Dabei durfte die EZB vorübergehend auch mehr kaufen, als der Anteil des Landes am eingezahlten EZB-Kapital nahelegen würde. Dieses PEPP-Programm dürfte aber im Frühjahr 2022 auslaufen.
EZB-Direktor Fabio Panetta hatte sich in dieser Woche dafür ausgesprochen, der EZB dauerhaft eine gezielte Beeinflussung der Staatsanleihezinsen einzelner Euro-Länder zu ermöglichen. „Wir sollten uns bemühen, die ‚unkonventionelle Flexibilität‘ beizubehalten, die uns während der Pandemie gute Dienste geleistet hat“, sagte er.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53289146-angeloni-ezb-reaktion-auf-fiskalische-notlagen-erleichtern-015.htm
Hans Bentzien: ZB/Enria: Output Floors auf konsolidierter Ebene anwenden – Gegenwärtiger Versuch vor allem der deutschen und französischen Bankenindustrie, in Brüssel eine möglichst schonenden Umsetzung von Basel 3 in europäisches Recht zu erreichen – DJN, 1.7.2021
Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hält es für möglich, beim Einsatz interner Modelle die sogenannten Output Floors auf Konzernebene anzuwenden. Den von der Bankenindustrie vorgeschlagenen Ansatz, bei der Bemessung der Eigenkapitalanforderungen für besonders riskante Geschäftsmodelle nicht die durch Output Floors erhöhten Risiko-Aktiva zu verwenden („parallel stack approach“), lehnte Enria dagegen ab.
„Ich favorisiere die Anwendung dieses Floors auf dem konsolidierten Level anstelle des individuellen Levels“, sagte Enria in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments. Die Modelle seien tatsächlich auf gruppenweiter Basis entwickelt worden. „Das ist ein Element, bei dem wir auf die von der Industrie vorgetragenen Punkte eingehen könnten“, sagte Enria.
Output Floors begrenzen den Vorteil, den Banken aus der Nutzung interner Modelle bei der Bemessung ihrer Risiko-Aktiva und damit Eigenkapitalanforderungen ziehen können. Die so berechneten Aktiva müssen mindestens 72,5 Prozent der mit einem Standardansatz ermittelten Aktiva entsprechen.
Dass diese Regelung besonders für einige europäische Großbanken starke Auswirkungen haben dürfte, ließ Enria nicht als Argument für eine „kreative“ Umsetzung des Basel-3-Eigenkapitalakkords in europäisches Recht gelten.
„Dass der Output Floor europäische Banken stärker beeinflusst, liegt daran, dass der bisherige Output Floor, der in Basel bereits enthalten war, nicht angemessen in der europäische Gesetzgebung berücksichtigt worden ist“, sagte er und fügte hinzu: „Das trifft vor allem einige Banken, die besonders aggressiv mit internen Modellen ihre Eigenkapitalanforderungen verringert haben.“
Gegenwärtig versuchen vor allem die deutsche und französische Bankenindustrie, in Brüssel eine möglichst schonenden Umsetzung von Basel 3 in europäisches Recht zu erreichen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53302026-ezb-enria-output-floors-auf-konsolidierter-ebene-anwenden-015.htm
- Österreich / OeNB
Forschungsprojekt erkundet Blockchain-Technologie für Anleiheemissionen und Abwicklung in Echtzeit mit Wholesale CBDC – OeNB, 30.6.2021
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), die OeKB CSD GmbH (OeKB CSD), die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), die Raiffeisen Bank International AG (RBI) und die Erste Group Bank AG haben gemeinsam das Forschungsprojekt DELPHI (Delivery vs. Payment Hybrid Initiative) gestartet, um in einer Simulation die Begebung und Abwicklung einer österreichischen Bundesanleihe als Security Token auf einer Blockchain zu erforschen.
Im Zuge der Emission soll ein von der OeNB bereitgestellter Wholesale CBDC (Central Bank Digital Currency), der direkt an den Wert des Euro gekoppelt ist, verwendet werden, um die zeitgleiche Abwicklung der Lieferung des Wertpapiers gegen eine entsprechende Bezahlung sicherzustellen.
QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20210630.html
USA
Defizit in der US-Handelsbilanz stärker als erwartet gestiegen – Exporte stiegen zum Vormonat um 0,6 Prozent, die Einfuhren um 1,3 Prozent – DJN, 2.7.2021
Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Mai stärker als erwartet gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 71,24 Milliarden Dollar nach revidiert 69,07 (vorläufig: 68,90) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 71,40 Milliarden Dollar gerechnet.
Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 206,02 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 277,259 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 1,3 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53315732-defizit-in-der-us-handelsbilanz-gestiegen-015.htm
Conference Board: Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im Juni auf – Verbrauchervertrauen auf höchstem Stand seit Corona-Pandemie-Beginn März 2020 – Aktuelle und künftige Lage werden besser eingeschätzt – Kurzfristige Inlfationserwartung gestiegen, keine Auswirkung auf künftige Kaufabsichten – DJN, 29.6.2021
Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Juni aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 127,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 118,7 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 120,0 von zunächst 117,2 nach oben revidiert.
Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 157,7 (Vormonat: 148,7), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 107,0 (100,9).
Das Verbrauchervertrauen liegt damit auf dem höchsten Stand seit Beginn der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie im März 2020. „Die Einschätzung der aktuellen Lage durch die Verbraucher hat sich erneut verbessert, was darauf hindeutet, dass sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal weiter verstärkt hat“, erklärte die Herausgeberin der Umfrage, Lynn Franco. „Während die kurzfristigen Inflationserwartungen stiegen, hatte dies kaum Auswirkungen auf das Vertrauen der Verbraucher oder deren Kaufabsichten.“
Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53280021-stimmung-der-us-verbraucher-hellt-sich-im-juni-auf-015.htm
Die Supershopper werden immer optimistischer – Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 30.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/cb_cons-confidence.png
Ein Grossteil der weltweiten Wertschöpfung wird von den amerikanischen Konsumenten getragen. Treten sie in Konsumstreik, dann verheisst dies nichts Gutes für die US-Wirtschaftsdynamik und für die Exportpartner rund um den Globus.
Derzeit scheint diese Gefahr allerdings gebannt zu sein. Wie das Forschungsinstitut Conference Board gestern bekannt gegeben hat, ist das Konsumentenvertrauen in den USA erneut gestiegen. Das Vorkrisenniveau ist nicht mehr weit entfernt.
Die Haushalte schätzen die Arbeitsmarktsituation nochmals positiver ein als zuvor. Zudem ist die Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation recht gross, und die Aussichten, sie noch zu verbessern, scheinen relativ rosig zu sein.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2086/
David Harrison und Kate Davidson: CBO rechnet mit 2021 mit höheren Wachstum, Inflation, Defiziten – DJN, 1.7.2021
Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (CBO) hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Haushaltsdefizite des Bundes in diesem Jahr angehoben, nachdem im März ein Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet wurde. Das Bundeshaushaltsdefizit für das Haushaltsjahr 2021 wird den Schätzungen zufolge 3 Billionen Dollar betragen. Das sind fast 130 Milliarden weniger als im vergangenen Jahr, aber es ist das Dreifache des im Jahr 2019 verzeichneten Defizits.
Das diesjährige Haushaltsdefizit wird den Prognosen zufolge 13,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen und ist damit das zweitgrößte Defizit seit 1945, das nur von jenem des vergangenen Jahres übertroffen wird. Das BIP dürfte bis Ende 2021 um 7,4 Prozent steigen, da sich die Pandemie abschwächt und die Nachfrage nach Verbraucherdienstleistungen ansteigt.
Für die Zeit nach 2021 rechnet das Haushaltsbüro mit geringeren Defiziten, da sich die Bundeseinnahmen dank der Erholung der Wirtschaft erhöhen dürften. Die Prognosen für die Verschuldung des Bundes sind ebenfalls etwas niedriger als im Februarbericht. Die Bundesverschuldung dürfte demnach bis Ende 2021 auf 103 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, bevor sie zwischen 2023 und 2025 leicht sinkt.
Das reale Wachstum des BIP schätzt das Haushaltbüro im vierten Quartal 2021 auf 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, im Februar hatte es ein Wachstum 3,7 Prozent prognostiziert. Die Inflation dürfte im vierten Quartal um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen, bevor sie 2022 wieder auf 2 Prozent fällt, gemessen am Preisindex für persönliche Konsumausgaben.
Im Februar, vor der Verabschiedung des Konjunkturgesetzes, rechnete das CBO mit einem Anstieg der Inflation in diesem Jahr um 1,7 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53307984-cbo-rechnet-mit-2021-mit-hoeheren-wachstum-inflation-defiziten-015.htm
Auftragseingang der US-Industrie im Mai um 1,7 Prozent zum Vormonat gestiegen – Langlebige Güter: plus 2,3 Prozent – DJN, 2.7.2021
Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Mai um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Das entsprach exakt der von Volkswirten erwarteten Rate. Für den Vormonat ergab sich ein revidiertes Minus von 0,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 0,6 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Mai einen bestätigten Anstieg von 2,3 Prozent.
Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 1,4 Prozent. Die Orders ohne Transportbereich nahmen um 0,7 Prozent zu.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,1 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 2,7 Prozent registriert worden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53316889-auftragseingang-der-us-industrie-im-mai-gestiegen-015.htm
Über der Wachstumsschwelle: Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Juni von 75,2 auf 66,1 Punkte zurück – DJN, 30.6.2021
Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Juni eingetrübt. Der Indikator fiel auf 66,1 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Mai stand der Index bei 75,2 Punkte und hatte damit den höchsten Stand seit Ende 1973 erreicht. Volkswirte hatten einen Wert von 70,0 Punkte erwartet.
Der Frühindikator liegt damit weiterhin über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.
Von den fünf wichtigsten Indikatoren verzeichnete der Auftragsbestand den größten Rückgang. Der Auftragseingang schwächte sich deutlich ab und fiel im Juni auf ein Dreimonatstief. Einige Firmen meldeten eine niedrigere Produktion aufgrund von Materialengpässen, während andere feststellten, dass die Engpässe zu neuen Aufträgen führten. Die Lagerbestände sanken um 4,3 Punkte auf den niedrigsten Stand seit August 2020, das war der dritte Wert in Folge unter der 50er-Marke.
Die Beschäftigung sank auf den niedrigsten Stand seit Januar, da die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, neue Mitarbeiter zu finden. Dagegen sprangen die am Werkstor gezahlt Preise auch aufgrund der Materialknappheit auf den höchsten Stand seit Dezember 1979.
Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53292724-chicagoer-einkaufsmanagerindex-faellt-im-juni-zurueck-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53292644-usa-chicago-indikator-truebt-sich-ueberraschend-deutlich-ein-016.htm
Weiteres Wachstum erwartbar: ISM-Index für US-Industrie fällt im Juni von 61,2 auf 60,6 – DJN, 1.7.2021
WASHINGTON (Dow Jones)–Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Juni verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 60,6 (Vormonat: 61,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 61,0 prognostiziert.
Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 66,0 (Vormonat: 67,0), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 49,9 (Vormonat: 50,9). Der Index für die Produktion nahm zu auf 60,8 (Vormonat: 58,5), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 92,1 (Vormonat: 88,0) auswies.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53305679-ism-index-fuer-us-industrie-faellt-im-juni-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53305709-usa-industriestimmung-etwas-schlechter-als-erwartet-016.htm
US-Industrie zeigt im Juni konstante Tendenz: IHS Markit Einkaufsmanagerindex verharrte wie im Mai bei 62,1 Punkten – DJN, 1.7.2021
Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Juni auf dem Vormonatsniveau gehalten. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex verharrte wie im Mai bei 62,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 62,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 62,6 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.
„Die Stärke des Aufschwungs wurde weiterhin durch Kapazitätsengpässe und Engpässe bei Material und Material- und Arbeitskräftemangel belastet“, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53305913-us-industrie-zeigt-im-juni-konstante-tendenz-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en
Claudia Assis: USA fallen bei E-Auto-Fertigung weiter hinter China und Europa zurück – DJN, 30.6.2021
Die USA sind bei der Produktion von Elektrofahrzeugen weiter hinter China und Europa zurückgefallen. Das Land rangiert weltweit an dritter Stelle, doch sein Anteil an der gesamten weltweiten Elektrofahrzeug(EV)-Produktion ist seit 2010 von 20 Prozent auf 18 Prozent gesunken, wie der International Council on Clean Transportation (ICCT) in einem Bericht schreibt.
Auch wenn Autobauer wie General Motors und Ford mit ihren Investitionen in dem Bereich Schlagzeilen machen und die USA das Heimatland von Tesla sind, sind die EV-Investitionen in den USA ebenfalls niedrig. Laut ICCT fließen nur etwa 15 Prozent der weltweiten EV-Investitionen der Hersteller in Höhe von rund 345 Milliarden US-Dollar in die USA.
„Die tatsächlichen Investitionen und die Produktion von Elektrofahrzeugen steht in krassem Gegensatz zum Getue der US-Automobilhersteller“, sagte ICCT-Direktor Nic Lutsey, und forderte eine „starke“ Regierungspolitik, um den verlorenen Boden wieder gutzumachen. „Die US-Autobranche kann es sich nicht leisten, in einem der vielversprechendsten und strategisch wichtigsten Sektoren der Welt ständig fünf Jahre hinter dem Rest der Welt zurückzuliegen.“
China ist der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, sein Anteil an der Produktion bis 2020 lag bei 44 Prozent, mit einer produzierten und verkauften Stückzahl von 4,6 Millionen. Europa ist die Nummer Zwei mit einem Anteil von 25 Prozent, und ist ein Nettoimporteur: die Region hat 2,6 Millionen Elektrofahrzeuge produziert und 3,2 Millionen verkauft.
Die USA produzierten im Jahr 2020 mehr als 450.000 Elektrofahrzeuge, wobei etwa 85 Prozent davon auf Tesla entfielen. Die jährlichen EV-Exporte betrugen mehr als 215.000, laut ICCT mehr als bei den anderen Ländern.
Die USA bieten weniger Anreize für Käufer von Elektroautos als andere Länder, und die Wirtschaftlichkeit des Besitzes eines Elektroautos ist – aufgrund der relativ günstigen Benzinpreise – nicht so offensichtlich wie in Europa.
Aber der Wunsch könnte da sein: Anfang dieses Monats ergab eine Umfrage des Pew Research Centers, dass 7 Prozent der Erwachsenen in den USA gerne ein Elektro- oder Hybridfahrzeug besitzen würden, und 39 Prozent sagten, sie würden beim Kauf ihres nächsten Autos ein Elektrofahrzeug „sehr oder eher in Betracht ziehen“.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53292497-usa-fallen-bei-e-auto-fertigung-weiter-hinter-china-und-europa-zurueck-015.htm
US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet – DJN, 30.6.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 25. Juni verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,718 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,614 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 8,2 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,522 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,2 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,93 Millionen gesunken waren. Die API-Daten hatten einen Anstieg von 2,4 Millionen Barrel angezeigt.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11,1 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53293286-us-rohoellagerbestaende-sinken-staerker-als-erwartet-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
USA: Bauausgaben sinken überraschend – dpa-AFX, 1.7.2021
In den USA sind die Bauausgaben im Mai unerwartet gesunken. Gegenüber dem Vormonat fielen sie um 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet.
Zudem wurde die Entwicklung der Bauausgaben im Vormonat etwas nach unten korrigiert. Demnach sind die Bauinvestitionen im April nur um 0,1 Prozent gestiegen, nachdem zuvor nur ein Zuwachs um 0,2 Prozent gemeldet worden war.
In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren die Ausgaben kurzzeitig deutlich zurückgegangen. Der Rückgang ist aber inzwischen aufgeholt. Der Immobilienmarkt zählt zu den Bereichen, die in der Corona-Pandemie eher profitiert haben. Immer mehr Menschen zieht es aus den Metropolen in die Vorstadt- und Peripheriegebiete, da in der Corona-Krise mehr von daheim gearbeitet wird. Zudem sind die Hypothekenzinsen derzeit niedrig
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53305708-usa-bauausgaben-sinken-ueberraschend-016.htm
Weitere Beschleunigung: US-Immobilienpreise ziehen um 14,9 Prozent im Jahresvergleich weiter an – Case-Shiller-Index – So stark wie seit 30 Jahren nicht mehr: S&P sieht außergewöhnliche Hauspreisentwicklung – Boomender Häusermarkt dank Niedrigzins, geänderte Wohnpräferenzen, Wohnbedarf und sicherheitsbedingte Immobiliennachfrage – Kongeniales Zusammenwirken: Homeoffice und Wegzug aus Städten ins Grüne – dpa-AFX, 29.6.2021
Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im April von bereits hohem Niveau aus weiter beschleunigt. In den 20 großen Metropolregionen des Landes stiegen die Preise zum Vorjahresmonat um 14,9 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 14,7 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate 13,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Hauspreise im April um 1,6 Prozent.
Craig Lazzara von S&P bezeichnete die Entwicklung der Hauspreise als „außergewöhnlich“. Der Preisindikator, der die Gesamtentwicklung in den USA beschreibt, sei so stark gestiegen wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Es bestätige sich, dass Hauskäufer zunehmend von städtischen Gebieten in Vorstadtgebiete zögen, was auch dort die Preise treibe.
Der US-Häusermarkt leidet nicht unter der Corona-Krise, im Gegenteil: Die extrem niedrigen Zinsen, eine sicherheitsbedingte Nachfrage nach Immobilien und der steigende Bedarf an Wohnraum treiben die Preise. Immer mehr Menschen zieht es aus den Metropolen in die Vorstadt- und Peripheriegebiete, da in der Corona-Krise mehr von daheim aus gearbeitet wird.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53279306-usa-immobilienpreise-ziehen-weiter-an-case-shiller-index-016.htm
Rekordjagd setzt sich fort: US-Häuserpreise steigen immer stärker – FHFA: starke Nachfrage treibt, unterstützt von Niedrigzins und Häusermangel – dpa-AFX, 29.6.2021
In den USA setzt sich der Aufwärtstrend der Häuserpreise mit immer höherem Tempo fort. Der FHFA-Hauspreisindex stieg im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,7 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 14,0 Prozent betragen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Hauspreise um 1,8 Prozent.
Die Hauspreise setzten ihre Rekordjagd fort, erklärte FHFA-Vizedirektor Lynn Fisher. „Dieser beispiellose Preisanstieg geht auf eine starke Nachfrage zurück, die durch niedrige Hypothekenzinsen und ein zu geringes Angebot an Immobilien unterstützt wird.“
Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53279439-usa-haeuserpreise-steigen-immer-staerker-fhfa-016.htm
USA: Schwebende Hausverkäufe legen auf Jahres sicht auf 13,1 Prozent, auf Monatssicht auf 8,0 Prozent kräftig zu – dpa-AFX, 30.6.2021
Der US-Häusermarkt entwickelt sich weiter robust. Im Mai erhöhten sich die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe kräftig. Die Zahl stieg gegenüber dem Vormonat um 8,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang von im Schnitt 1,0 Prozent gerechnet.
Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die sogenannten schwebenden Hausverkäufe um starke 13,1 Prozent. Der US-Häusermarkt ist durch die Corona-Pandemie nur kurzzeitig belastet worden. Mittlerweile profitiert der Markt erheblich von der ungebremsten Suche der Haushalte nach Wohnraum.
Die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe, die auch als schwebende Hausverkäufe bezeichnet werden, gelten als Frühindikator für den Häusermarkt in den USA, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53292765-usa-schwebende-hausverkaeufe-legen-kraeftig-zu-016.htm
USA: Stundenlöhne steigen wie erwartet – dpa-AFX, 2.7.2021
In den USA sind die Löhne im Juni erneut gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.
Wie das Ministerium weiter mitteilte, war der Anstieg der Stundenlöhne im Mai allerdings nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Der Zuwachs wurde im Monatsvergleich von 0,5 Prozent auf 0,4 Prozent nach unten revidiert.
Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne weiter deutlich und legten im Juni um 3,6 Prozent zu
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53315648-usa-stundenloehne-steigen-wie-erwartet-016.htm
Hans Bentzien: Commerzbank: US-Arbeitskostenindex zuverlässiger als Stundenlöhne – DJN, 1.7.2021
Ob der starke Inflationsanstieg in den USA nur ein vorübergehendes Phänomen ist oder ob auch längerfristig Inflationsprobleme drohen, hängt vor allem vom Lohndruck ab. Die Commerzbank-Volkswirte Bernd Weidensteiner und Christoph Balz kommen zu dem Ergebnis, dass der zuverlässigste Indikator des Lohndrucks der Arbeitskostenindex (ECI) ist – allerdings auch der langsamste. „Inwieweit sich der Lohndruck auf breiter Front verstärkt, werden wohl erst die Zahlen zum zweiten Quartal zeigen, die am 30. Juli veröffentlicht werden“, schreiben die Ökonomen in einer Analyse.
Sie sind diesbezüglich aber skeptisch, weil es in den vergangenen Jahrzehnten nie zu einer nachhaltigen Beschleunigung des Lohnauftriebs gekommen sei. „Die aufgrund einzelner Daten-Ausreißer immer wieder einmal aufkommenden Befürchtungen (oder Hoffnungen), dass sich das ändert, haben sich bisher nie bewahrheitet“, geben sie zu bedenken. Auch der Anstieg des ECI im ersten Quartal könne mit Sondereffekten erklärt werden. „Wir gehen in unserem Basisszenario davon aus, dass sich daran zumindest in diesem und im kommenden Jahr nichts Grundlegendes ändert.“
Andere Lohnindikatoren sind laut Weidensteiner und Balz zwar schneller verfügbar, aber vor allem im aktuellen Umfeld mit Vorsicht zu genießen. Die im Rahmen des monatlichen Arbeitsmarktberichts veröffentlichten Stundenlöhne in der Privatwirtschaft krankten an einer ungenauen Erfassung der Arbeitszeit und würden von Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur beeinflusst, wie sich gerade in der Corona-Krise gezeigt habe.
Für besser halten die Analysten den Median Wage Growth Tracker der Atlanta Fed, der auf Basis der Haushaltsumfrage des Arbeitsmarktberichts die Löhne individueller Haushalte mit ihren Löhnen zwölf Monate zuvor vergleicht. Weidensteiner und Balz befürchten aber, dass dieser zwei Wochen nach dem Arbeitsmarktbericht vorliegende Indikator derzeit den Lohndruck unterschätzt.
Grund: Wahrscheinlich profitieren gerade diejenigen derzeit von Lohnerhöhungen, die jetzt eine Stelle antreten, vor einem Jahr aber wegen der Pandemie nicht gearbeitet haben. Diese Gruppe ist aber nicht im Wage Growth Tracker berücksichtigt, weil nur Personen untersucht werden, die sowohl im letzten Monat als auch zwölf Monate zuvor arbeiteten. „Außerdem sind in den Daten keine Antritts- und Bleibeprämien enthalten, zu denen derzeit wohl viele Arbeitgeber greifen.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53299771-commerzbank-us-arbeitskostenindex-zuverlaessiger-als-stundenloehne-015.htm
US-Arbeitsmarkt mit überraschend starkem Wachstum – DJN, 2.7.2021
Das US-Jobwachstum hat sich im Juni deutlich und stärker als erwartet beschleunigt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 850.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 706.000 Jobs erwartet.
Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 15.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für Mai nun ein Stellenplus von 583.000 (vorläufig: 559.000) und für April von 269.000 (vorläufig: 278.000).
Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im Juni überraschend auf 5,9 von 5,8 Prozent im Mai, während Ökonomen einen Rückgang auf 5,6 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.
Die sogenannte Erwerbsquote – also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter – verharrte bei 61,6 Prozent.
Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,33 Prozent auf 30,40 Dollar. Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53315786-us-arbeitsmarkt-mit-ueberraschend-starkem-wachstum-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53315542-usa-beschaeftigung-steigt-staerker-als-erwartet-016.htm
Automatic Data Processing Inc (ADP): US-Privatsektor schafft mehr Stellen als erwartet – DJN, 30.6.2021
Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Juni stärker gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 692.000 Stellen. Analysten hatten nur ein Plus von 550.000 Jobs vorausgesagt. Im Mai waren unter dem Strich 886.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 92.000 weniger als ursprünglich gemeldet.
„Die Erholung am Arbeitsmarkt bleibt robust, und der Juni schließt ein starkes zweites Quartal des Jobwachstums ab“, sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP. „Während die Zahl der Beschäftigten immer noch fast sieben Millionen unter dem Niveau vor der Pandemie liegt, hat der Stellenzuwachs seit Anfang 2021 etwa drei Millionen betragen. Von den Dienstleistern kommt der größte Schub, wobei das Freizeit- und Gastgewerbe den stärksten Zuwachs verzeichnet, während die Unternehmen im ganzen Land beginnen, wieder ihre volle Kapazität zu erreichen.“
Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 460.000 US-Unternehmen mit etwa 26 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.
Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im Juni auf der Basis des offiziellen Jobreports 706.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Bei der Arbeitslosenquote sehen sie einen Rückgang von 5,8 auf 5,6 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53291363-adp-us-privatsektor-schafft-mehr-stellen-als-erwartet-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.adpemploymentreport.com/
Stärkere Abnahme als erwartet: Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken auf neues Pandemietief von 364.000 Arbeitslosen – DJN, 1.7.2021
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 26. Juni stärker abgenommen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 51.000 auf 364.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit der Woche zum 14. März 2020 und markiert ein neues Pandemietief.
Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 390.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 415.000 von ursprünglich 411.000.
Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 6.000 auf 392.750. In der Woche zum 19. Juni erhielten 3,469 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 56.000.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53304655-antraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-sinken-auf-neues-pandemietief-015.htm
SIEHE DAZU http://www.dol.gov/ui/data.pdf
USA: Arbeitslosenquote steigt überraschend – dpa-AFX, 2.7.2021
In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juni überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einen Rückgang auf 5,6 Prozent gerechnet.
Nachdem die Arbeitslosigkeit in der ersten Corona-Welle stark gestiegen war, ging sie in der zweiten Jahreshälfte 2020 deutlich zurück. Seit März hält sich die Arbeitslosenquote jedoch in der Nähe der Marke von sechs Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53315541-usa-arbeitslosenquote-steigt-ueberraschend-016.htm
Vor Unabhängigkeitstag am 4.7.2021: Rätselhafte Cyberattacke auf führenden IT-Anbieter in den USA legt weltweit IT lahm – Lösegeldforderungen: Ransomeware legt Dienstleister lahm – Womöglich tausende Dienstleister betroffen, unter anderem das schwedische Bahnunternehmen SJ-AB, COOP Schweden, ein deutscher IT-Dienstleister – Die Presse/APA, 4.7.2021
Der Angriff auf die amerikanische Firma Kaseya erfolgte unmittelbar vor dem US-Unabhängigkeitstag. Experten zufolge könnten mehr als 1000 Unternehmen betroffen sein, in Schweden und Deutschland ist das bereits evident.
Im Mai waren die Colonial-Ölpipeline in den USA (https://www.diepresse.com/5977739/us-pipeline-liegt-nach-hacker-angriff-still) und die US-Tochter des weltgrößten Fleischproduzenten JBS (https://www.diepresse.com/5991544/fleischkonzern-zahlte-hackern-elf-millionen-dollar-losegeld) Opfer eines Cyberangriffs geworden. Jetzt ist die US-IT-Firma Kaseya dran – und diesmal mit Auswirkungen bis nach Europa.
In den USA sorgt die Ransomware-Cyberattacke auf Kaseya kurz vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag am gestrigen Sonntag jedenfalls für Rätselraten. US-Präsident Joe Biden sagte am Samstagnachmittag (Ortszeit), dass man ursprünglich nicht die russische Regierung hinter der Attacke vermutet habe. Mittlerweile sei man sich diesbezüglich aber „nicht sicher“. Experten zufolge könnten mehr als tausend Unternehmen vom Angriff betroffen sein. In Schweden mussten Hunderte Supermarktfilialen schließen.
Biden beauftragte die US-Geheimdienste, den Fall zu untersuchen. „Die ursprüngliche Deutung war, dass es sich nicht um die russische Regierung gehandelt hat, aber wir sind uns noch nicht sicher“, sagte der US-Präsident am Vortag des größten US-Feiertags. Sollte sich herausstellen, dass Russland schuld sei, werde es eine Antwort Washingtons geben.
US-Unternehmen waren in der jüngsten Vergangenheit mehrfach Ziel von Cyberattacken geworden, für die jeweils russische Hacker verantwortlich gemacht worden waren. Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin hatten Mitte Juli bei ihrem Gipfel in Genf vereinbart, sich des Problems mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe anzunehmen.
*** Lösegeldforderungen ***
Nach Angaben der auf Cybersicherheit spezialisierten Beratungsfirma Huntress Labs wurde die VSA-Software von Kaseya manipuliert, „um mehr als tausend Unternehmen zu verschlüsseln“. Das IT-Unternehmen Kaseya hatte am Wochenende die Cyberattacke bestätigt und versichert, der Angriff sei eingedämmt worden, sodass nur ein „sehr kleiner Prozentsatz“ der Kunden betroffen sei, die das sogenannte VSA-Netzwerk von Kaseya nutzten.
Bei Angriffen mit Ransomware sperren oder verschlüsseln Hacker die Computersysteme ihrer Opfer, um von den Nutzern Geld für die Freigabe ihrer Daten zu erpressen. Kaseya ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter für Informationstechnologie und IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen. Über den VSA-Server können Unternehmen all ihre Computer und Drucker von einem einzigen Arbeitsplatz aus steuern.
„Wir sind dabei, mit einem hohen Maß an Vorsicht die eigentliche Ursache für den Vorfall zu untersuchen“, erklärte Kaseya zunächst in einem Forum des Onlinedienstes Reddit. Die Firma forderte ihre Kunden auf, sofort ihren sogenannten VSA-Server abzuschalten, „bis Sie von uns weitere Informationen erhalten“.
Später erklärte Kaseya, seine Kunden seien über die Firmen-Website, per E-Mail, per Anzeige auf dem Rechner und per Telefon über den Vorfall unterrichtet und zum Abschalten ihrer VSA-Server aufgefordert worden. „Wir denken, dass wir die Quelle der Anfälligkeit gefunden haben, und bereiten eine Korrektur vor“, erklärte das in Miami ansässige Unternehmen weiter, das nach eigenen Angaben mehr als 40.000 Kunden hat.
*** Erste Meldungen in Deutschland ***
Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zufolge gibt es bereits erste Auswirkungen in Deutschland: „Ein IT-Dienstleister hat sich gemeldet, weil er betroffen ist“, sagte ein BSI-Sprecher. Dieser Dienstleister betreue mehrere tausend Kundensysteme, die wiederum ebenfalls betroffen sein könnten.
Im BSI rechne man am Montag mit weiteren Meldungen, wenn nach dem Wochenende die Firmen wieder besetzt seien. Das BSI rät Betroffenen, technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen und sich beim BSI zu melden.
Einen so gravierenden Fall wie in Schweden habe man bisher nicht registriert.
………………………………………………………
KASTENTEXT: Hilfe bei Cyber-Attacken – Information für Unternehmen/Unternehmer
0800 888 133 lautet die Cyber-Security-Hotline der Wirtschaftskammer Wien. Sie ist 24 Stunden sieben Tage die Woche besetzt und bietet Unternehmen Hilfe bei Cyber-Attacken. Geschulte Mitarbeiter unterstützen bei der Lösung des Problems. Umgehend werden auf Wunsch und falls notwendig zertifizierte und akkreditierte IT-Experten vermittelt, die rasch vor Ort sein können.
………………………………………………………
*** Probleme in Schweden ***
Eine der größten schwedischen Supermarktketten musste eigenen Angaben zufolge am Samstag nämlich rund 800 Filialen vorübergehend schließen(https://www.diepresse.com/6003285/800-supermarkt-filialen-in-schweden-nach-hackerangriff-geschlossen), weil ihre Kassen nicht mehr funktionierten. Ein Subunternehmer sei nämlich Ziel des digitalen Angriffs geworden, teilte Coop Schweden mit. Details nannte das Unternehmen nicht. Die schwedische Tochtergesellschaft des Softwarekonzerns Visma teilte jedoch mit, das Problem stehe im Zusammenhang mit einem größeren Cyberangriff auf das amerikanische IT-Unternehmen Kaseya am Freitag.
Neben anderen Unternehmen war auch das staatliche Bahnunternehmen SJ betroffen. Fahrgäste konnten dadurch im Bistro nicht mit Karte zahlen. Am Freitagabend habe es einen Angriff auf einen Dienstleister von Coop gegeben, der sowohl die normalen Kassensysteme als auch Selbstbedienungskassen der Supermärkte betraf, berichtete der Fernsehsender SVT. Man habe die ganze Nacht an den Problemen gearbeitet, sie jedoch noch nicht lösen können, sagte eine Sprecherin dem Sender. In einzelnen Regionen konnten einige Filialen im Land wieder aufmachen, wobei manche andere Bezahlsysteme nutzten.
*** Steckt REvil dahinter? ***
Die US-Behörde für Cybersicherheit (CISA) teilte mit, dass sie den Vorfall untersuche. Sie rief Unternehmen auf, die Anweisungen von Kaseya zu befolgen und ihren VSA-Server sofort abzuschalten.
Nach Einschätzung des Computer-Notfallteams der neuseeländischen Regierung steckte hinter der Cyberattacke eine Hackergruppe namens REvil.
Erst im Mai waren die Colonial-Ölpipeline in den USA und die US-Tochter des weltgrößten Fleischproduzenten JBS Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware geworden. Vergangenes Jahr hatten sich Hacker über Software des US-IT-Unternehmens SolarWinds Zugang zu den Systemen von Ministerien, Behörden und Unternehmen verschafft. Die US-Bundespolizei FBI machte Hacker in Russland für diese Cyberattacken verantwortlich. Die Attacke auf JBS wurde demnach von REvil verübt.
QUELLE: https://www.diepresse.com/6003456/ratselhafte-cyberattacke-in-den-usa-legt-weltweit-it-lahm
Nach Angriffen im letzten Jahr und heuer im Mai auf diverse US-Firmen: Cyberattacke auf US-IT-Firma – Russlan im Visier – ORF, 3.7.2021
Auf eine Netzwerksoftware der US-IT-Firma Kaseya ist eine Ransomware-Cyberattacke verübt worden, von der etwa 200 Unternehmen betroffen sein sollen. Die Computernetzwerke von rund 200 Firmen seien bei dem Hackerangriff „verschlüsselt“ worden, erklärte die auf Cybersicherheit spezialisierte Beratungsfirma Huntress Labs.
Bei Angriffen mit Ransomware sperren oder verschlüsseln Hacker die Computersysteme ihrer Opfer, um von den Nutzern Geld für die Freigabe ihrer Daten zu erpressen. Kaseya ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter für Informationstechnologie und IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen.
Unternehmen sollen VSA-Server abschalten
„Wir sind dabei, mit einem hohen Maß an Vorsicht die eigentliche Ursache für den Vorfall zu untersuchen“, erklärte Kaseya in einem Forum des Onlinedienstes Reddit. Die Firma forderte ihre Kunden auf, sofort ihren VSA-Server abzuschalten, „bis Sie von uns weitere Informationen erhalten“. Über den VSA-Server können Unternehmen all ihre Computer und Drucker von einem einzigen Arbeitsplatz aus steuern.
Die US-Behörde für Cybersicherheit (CISA) teilte mit, dass sie den Vorfall untersuche. Sie rief Unternehmen auf, die Anweisungen von Kaseya zu befolgen und ihren VSA-Server sofort abzuschalten. Die Cyberattacke ereignete sich vor dem Wochenende, an dem der Unabhängigkeitstag der USA gefeiert wird.
Im Mai waren die Colonial-Ölpipeline in den USA und die US-Tochter des weltgrößten Fleischproduzenten JBS Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware. Voriges Jahr hatten sich Hacker über Software des US-IT-Unternehmens SolarWinds Zugang zu den Systemen von Ministerien, Behörden und Unternehmen verschafft. Die US-Bundespolizei FBI machte Hacker in Russland für diese Cyberattacken verantwortlich.
QUELLE: https://orf.at/stories/3219669/
CHINA
Stärker gesunken als erwartet: ‚Caixin‘-Industriestimmung deutet trotz Rückgang auf Wachstum hin – dpa-AFX, 1.7.2021
In China ist die Stimmung bei kleineren und mittelgroßen Industriebetrieben stärker gesunken als erwartet. Da der vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ ermittelte Einkaufsmanagerindex aber über der Schwelle von 50 Zählern blieb, deutet er wie schon der am Vortag veröffentlichte staatliche Indikator auf ein weiteres Wachstum des Sektors hin. Der „Caixin“-Index fiel im Juni zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 51,3 Punkte, wie das Magazin am Donnerstag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem minimalen Rückgang auf 51,9 Zähler gerechnet.
Bereits am Mittwoch hatte die Regierung ihren Stimmungsindikator für die großen und staatlich dominierten Industrieunternehmen veröffentlicht. Dieser ging um 0,1 Punkte auf 50,9 Zähler zurück. Trotz des Rückgangs werteten Analysten die Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes als einen Beleg dafür, dass sich die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im vergangenen Jahr stabilisiert. Die hohen Wachstumsraten vom Jahresanfang dürften sich aber nicht mehr fortsetzen, da sich die Entwicklung normalisiere.
Hohe Zuwachsraten in der Industrie zum Jahresanfang waren der wichtigste Baustein für das starke Wachstum Chinas im ersten Quartal. Die chinesische Wirtschaft war im ersten Quartal um einen Rekordwert von 18,3 Prozent gewachsen. Die Volksrepublik konnte sich schneller als die meisten anderen Länder von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erholen. Am 15. Juli will die Regierung die Daten für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal veröffentlicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53298277-china-caixin-industriestimmung-deutet-trotz-rueckgang-auf-wachstum-hin-016.htm
ÄGYPTEN
Schiff frei: Einigung im Streit um Blockade des Sueskanals – ORF, 4.7.2021
Der Streit um Schadenersatz für die tagelange Blockade des Sueskanals durch ein festsitzendes Containerschiff ist beigelegt. Die ägyptische Kanalbehörde erklärte gestern, sie werde den seit der Bergung im März festgehaltenen Frachter freigeben. Die Unterzeichnung des Vertrags und die Abfahrt der „Ever Given“ seien im Rahmen einer Zeremonie am Mittwoch geplant. Der japanische Schiffseigner Shoei Kisen bestätigte die Einigung.
Grundlegende Einigung bereits im Juni
Die Suez Canal Authority (SCA), die Schadenersatz für die Kanalblockade und die Bergung gefordert hatte, und der Schiffseigner und seine Versicherer äußerten sich nicht zu Einzelheiten der Vereinbarung. Im Grundsatz hatten sich beide Seiten bereits im Juni verständigt.
Angesichts dessen hatte das zuständige ägyptische Gericht Termine in dem parallel geführten Prozess wiederholt verschoben, um den Kontrahenten eine außergerichtliche Einigung zu ermöglichen. Die Behörde hatte im Lauf der Auseinandersetzung ihre anfängliche Forderung von 916 Mio. Dollar (774,76 Mio. Euro) auf 550 Mio. Dollar heruntergeschraubt.
Der Sueskanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Er erspart der Schifffahrt zwischen Nordatlantik und Indischem Ozean den Weg um Afrika. Die „Ever Given“ war am 23. März bei starkem Wind auf Grund gelaufen, hatte sich schräg gestellt und so den Kanal sechs Tage lang blockiert. Hunderte Schiffe konnten die Wasserstraße nicht passieren, was den weltweiten Handel erheblich störte. Am 29. März wurde das riesige Containerschiff freigelegt. Es wird seither in einem See zwischen zwei Kanalabschnitten festgehalten.
QUELLE: https://orf.at/stories/3219814/
TÜRKEI
Volker Pabst: Inflation in der Türkei: «Diesen Dollar müsste man irgendwo festbinden, damit er nicht weiter steigt!» – Wohlstandsverlust in breiten Schichten der Bevölkerung auf dem Vormarsch – Lebensmittelpreise steigen – Mittelklasse muss einsparen – Anhebung des Mindestlohns um mehr als 20 Prozent von der Inflation „aufgefressen“ – Ein Viertel der türkischen Bevölkerung lebt in Armut – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021
In der Türkei treibt der Sturzflug der Landeswährung die Inflation an. Der Wohlstandsverlust macht sich in breiten Schichten der Bevölkerung bemerkbar.
… Es ist Freitagsmarkt in Fatih, einem historischen Stadtteil im Herzen Istanbuls. Es gibt Obst, Gemüse und Fisch, aber auch Textilien, einfache Elektronik und Gebrauchsgüter für den Haushalt. Die Preise sind im Vergleich zum Supermarkt tief, die Qualität ist zumindest bei den lokalen Frischwaren dennoch gut. Besonders die Obststände mit ihren kunstvoll aufgetürmten Auslagen sind auch optisch eine Wonne.
*** Lebensmittelpreise steigen stark ***
Die 45-jährige Ceylan ist trotzdem unzufrieden. «100 Lir. habe ich bereits ausgegeben, für das hier», sagt die Mutter zweier Teenager und hält vorwurfsvoll drei Plastiksäcke mit Obst und Gemüse in die Höhe. Vor einem Jahr hätte sie dafür höchstens 60 Lir. bezahlt. …
«Benzin und Dünger werden teurer, wenn der Dollarkurs steigt. Darum müssen die Bauern mehr verlangen.» Anfang letzten Jahres musste man weniger als 6 Lir. für einen Dollar bezahlen. Jetzt sind es Lir. 8.70.
Vor zwei Jahren, als die Preise ebenfalls stark anstiegen und die Regierungspartei AKP vor den Lokalwahlen unter Druck geriet, warf Präsident Erdogan den Händlern vor, die Inflation bewusst anzutreiben. «Wer das sagt, kann nicht rechnen – oder will es nicht. Wir können nicht billiger verkaufen», sagt der Gemüseverkäufer Abdulcelil.
*** Auch die Mittelklasse muss sparen ***
Die Marktbesucherin Ceylan sagt, für sie und ihre Familie reiche es immer noch zum Leben. Ihr Mann sei Anwalt und verdiene nicht schlecht. Ihr Gehalt als Angestellte bei der Einwohnerkontrolle sei aber nicht mehr als ein Zustupf.
Früher hätten sie sich überlegt, die Kinder auf eine private Schule zu schicken, wie es viele Mittelklassefamilien in der Türkei tun. «Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Heute könnten wir uns das nicht mehr leisten. Auch sonst können wir den Kindern weniger bieten, als wir gerne würden.» Reisen ins Ausland etwa seien unerreichbar geworden, wenn man nicht in Dollar oder Euro verdiene.
*** Fleisch wird zum Luxusprodukt ***
Viel dramatischer macht sich der Preisanstieg freilich in den unteren Einkommensklassen bemerkbar, wo fast jede dritte Lira für Lebensmittel ausgegeben wird. Rudvan Celik arbeitet in einer Metzgerei unweit des grossen Marktgeländes. Davor war er lange Zeit in einem Schlachthof in Afyonkarahisar, einer Stadt im Landesinnern, angestellt gewesen.
«Rotes Fleisch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Küche. Doch für immer mehr Menschen wird es zum Luxusprodukt», sagt Celik. Vergangenes Jahr habe er drei Mal pro Woche Fleisch vom Schlachter bezogen. Jetzt komme er mit einer Lieferung durch die Woche.
«Vor dem Opferfest in drei Wochen zieht die Nachfrage wieder an.» Zum Kurban Bayrami, wie das höchste islamische Fest in der Türkei heisst, lässt, wer es sich leisten kann, ein Tier schlachten. «Eigentlich verteilt man danach einen Teil des Fleisches unter den Bedürftigen. Heute behalten es aber viele Familien für sich.»
Wie beim Gemüse spürt man auch beim Fleisch die Folgen der schwachen Währung. Die Kosten für Tiernahrung hätten sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, sagt Celik. Hinzu kämen die gestiegenen Transportkosten. Und natürlich erhöhe jeder Zwischenhändler, von denen es traditionellerweise viele gibt, seinen Zuschlag, wenn der Dollar an Wert gewinne.
*** Von der Hand in den Mund ***
Ob er als Angestellter den vollen Inflationsausgleich bekomme, wollen wir wissen. «Wie denn? Wir verkaufen ja weniger als im letzten Jahr. Da kann mir der Chef nicht mehr bezahlen.» Zum Jahresbeginn wurde der Mindestlohn in der Türkei um 21,6% auf 2826 Lir. angehoben.
In den grossen Städten kommt man damit aber nicht weit. Der Gewerkschaftsbund Türk-Is legt die Armutsgrenze für eine vierköpfige Familie auf ein Einkommen von 8197 Lir. Nimmt man das international gängige Kriterium von 60% des Medianeinkommens als Berechnungsgrundlage, leben fast 18 Mio. Türken in Armut. Das Land befand sich schon vor der Pandemie in grossen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/wirtschaft/diesen-dollar-muesste-man-irgendwo-festbinden-damit-er-nicht-weiter-steigt-ld.1632833
GROSSBRITANNIEN
Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich stärker ein als erwartet, bleibt aber auf Wachstumskurs – dpa-AFX, 1.7.2021
Die Industriestimmung in Großbritannien hat sich im Juni stärker eingetrübt als erwartet. Der Markit-Einkaufsmanagerindex fiel von einem Rekordhoch im Mai bei 65,6 Zähler auf 63,9 Punkte, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung war noch ein Indexwert von 64,2 Punkten gemeldet worden. Analysten hatten eine Bestätigung erwartet.
Trotz des Dämpfers deutet der Stimmungsindikator weiter auf Wachstum in der britischen Industrie hin. Der Indexwerte liegt nach wie vor deutlich über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53301343-grossbritannien-stimmung-in-der-industrie-truebt-sich-staerker-ein-als-erwartet-016.htm
SCHWEIZ
Lukas Mäder: Das Schweizer Stromnetz ist völlig ungenügend gegen Cyberangriffe geschützt – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021
Die Schweizer Strombranche ist ein leichtes Ziel für Angriffe über das Internet. Eine Umfrage zeigt erstmals, dass die Unternehmen im Schnitt nicht einmal über einen minimalen Schutz verfügen. Jetzt will der Bund handeln.
Wie verheerend ein Cyberangriff sein kann, hat der Fall der Colonial Pipeline in den USA gezeigt. Anfang Mai musste die Betreiberfirma die Pipeline abschalten – wegen eines sogenannten Ransomware-Angriffs. Als Folge wurde das Benzin an der Ostküste knapp.
Ein solcher Vorfall kann sich auch bei den Schweizer Stromversorgern ereignen. Die Strombranche ist hierzulande nur ungenügend geschützt. Das zeigt eine umfassende Umfrage zum Stand der IT-Sicherheit, die das Bundesamt für Energie (BfE) erstmals bei Stromproduzenten, Netzbetreibern und Messstellen durchgeführt hat.
Das Ergebnis fällt «ernüchternd» aus, wie es im Bericht des BfE heisst. Der Grad der Cybersicherheit sei generell «sehr niedrig». Ein Grund dafür scheint das fehlende Bewusstsein zu sein: «Die Cybersicherheit wird oft als Nebentätigkeit mit geringer Priorität angesehen.»
Konkret erreichen die Elektrizitätsunternehmen auf einer Skala von 0 bis 4 im Schnitt kaum den Wert 1. Dieser entspricht einem rudimentären Grundschutz vor Cyberangriffen. Besonders schlecht gerüstet sind die Firmen, wenn es um das Erkennen von Angriffen sowie um das Reagieren und Wiederherstellen nach einem Vorfall geht. …
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/technologie/cyberangriffe-schweizer-stromnetz-ist-ungenuegend-geschuetzt-ld.1633164
Credit Suisse prüft Umbau des Private Banking – Insidern zufolge plant die Grossbank einen Umbau ihres Kerngeschäfts. Es soll mit reichen Privatkunden neu aufgestellt werden Finanz & Wirtschaft, 30.6.2021
Die Credit Suisse (CSGN 9.69 -0.35%) erwägt Insidern zufolge, das Kerngeschäft mit reichen Privatkunden neu aufzustellen. So könnte die skandalgeplagte Schweizer Grossbank die bisher auf drei Divisionen verteilte Vermögensverwaltung in einer Sparte zusammenfassen, wie drei mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters sagten.
Damit könnten Synergien gehoben und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen erleichtert werden. Vollzieht die Bank den Umbau, würden grosse Teile der 2015 vom damaligen Konzernchef Tidjane Thiam eingeführten regionalen Organisation wieder rückgängig gemacht.
Die Credit Suisse ist gegenwärtig in fünf Divisionen aufgeteilt. Neben den auf Profi-Kunden ausgerichteten Sparten Investmentbanking und Asset Management sind drei Bereiche teilweise oder ganz im Vermögensverwaltungsgeschäft tätig: Die im Heimmarkt tätige Swiss Universal Bank, das vor allem im restlichen Europa, dem Nahen Osten sowie Lateinamerika aktive International Wealth Management (IWM) sowie das Asien-Pazifik-Geschäft.
Thiam hatte die in der Branche ungewöhnliche Aufteilung verordnet, um mehr Eigenverantwortung und Kundennähe zu erreichen. Die Kehrseite sind Doppelstrukturen und damit verbunden höhere Kosten. Dies war einer der Gründe, wieso der Erzrivale UBS (UBSG 14.16 -0.88%) seine beiden Vermögensverwaltungssparten 2018 zusammenführte.
*** Umbau würde bessere Kontrolle ermöglichen ***
Auch bei der Credit Suisse steht jetzt zur Diskussion, das Asien-Geschäft mit dem IWM zu verschmelzen und möglicherweise das Schweizer Geschäft mit Superreichen mit einzubauen. Der Umbau würde eine Reihe regionaler Manager, die jahrelang relativ unabhängig von der Zentrale in der Schweiz agieren konnten, entmachten und eine strengere Kontrolle aus der Schweiz heraus ermöglichen.
Ein Vorteil einer solchen integrierten Vermögensverwaltung wäre auch eine einfachere Zusammenarbeit mit der Investmentbank, sagten zwei der Personen. Es sei zwar noch keine Entscheidung gefallen. Wenn die Bank voraussichtlich im Oktober die neue Strategie vorlege, dürfte aber auch diese Frage geklärt sein. Ein zusammengefasstes Vermögensverwaltungsgeschäft könnte einen neuen Bereichsleiter erhalten.
Der neue Verwaltungsratspräsident Antonio Horta-Osorio hatte bei seinem Amtsantritt vor zwei Monaten angekündigt, die Strategie der Bank auf den Prüfstand zu stellen. Offen ist Insidern zufolge vor allem die Frage, ob das Investmentbanking eingedampft und das Asset Management verkauft werden soll.
Auf der kürzlich abgehaltenen jährlichen Strategietagung der Konzernleitung und des Verwaltungsrats im Kurort Bad Ragaz standen grosse Bereichsverkäufe und Zusammenschlüsse zwar nicht auf der Tagesordnung. Das sei aber «der Elefant im Raum» gewesen, sagte ein Insider. Ein zusammengeführtes Vermögensverwaltungsgeschäft würde die Bank als Fusionspartner aber attraktiver machen, sagte eine andere Person.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/credit-suisse-prueft-umbau-des-private-bankings/
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
Andreas Plecko: Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent, Kernrate auf 0,9 Prozent – DJN, 30.6.2021
Die Inflation in der Eurozone hat im Juni etwas nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank von 2,0 auf 1,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 1,9 Prozent vorhergesagt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig knapp 2 Prozent an. Trotz des Rückgangs dürfte der Höhepunkt des Inflationsanstiegs aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei rund 3 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.
Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank im Juni ebenfalls. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate sank von 1,0 auf 0,9 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 0,8 Prozent gerechnet.
Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Juni in der Gesamtrate um 0,3 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung ebenfalls 0,3 Prozent. Volkswirte hatten Raten von jeweils 0,3 Prozent prognostiziert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53288393-inflation-im-euroraum-sinkt-im-juni-auf-1-9-prozent-015.htm
SIEHE DAZU
=> TABELLE/EU-Verbraucherpreise Juni nach Ländern (Vorabschätzung) – DJN, 30.6.2021
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53288394-tabelle-eu-verbraucherpreise-juni-nach-laendern-vorabschaetzung-015.htm
Andreas Plecko: Euroraum-Wirtschaftsstimmung auf höchstem Stand seit 21 Jahren – DJN, 29.6.2021
Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Juni erneut stark gestiegen und hat den höchsten Stand seit 21 Jahren erklommen. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 117,9 Punkte von 114,5 im Vormonat. Der Index liegt jetzt weit über dem langfristigen Durchschnitt und auch über dem Vorkrisenniveau.
Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Indexanstieg auf 116,5 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator verbesserte sich auf 117,0 Punkte von 114,0 im Vormonat.
In der EU wurde der Anstieg durch die Verbesserung des Vertrauens im Dienstleistungssektor vorangetrieben, aber auch alle anderen untersuchten Wirtschaftszweige (Industrie, Einzelhandel, Baugewerbe) und die Verbraucher verzeichneten eine Verbesserung.
Auf Länderebene erreichte der Indikator in Deutschland (plus 5,0) ein Allzeithoch und stieg auch in Italien (plus 2,1), den Niederlanden (plus 1,9), Frankreich (plus 1,3) und Polen (plus 0,2). Von den sechs größten EU-Ländern verzeichnete nur Spanien einen leichten Rückgang (minus 1,1).
Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf plus 12,7 Punkte von plus 11,5 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf plus 12,3 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 3,3 Punkte von minus 5,1 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53275569-euroraum-wirtschaftsstimmung-auf-hoechstem-stand-seit-21-jahren-015.htm
Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Mai von revidiert 8,1 für April auf 7,9 Prozent – Ausreißer nach oben: Griechenland (15.4 Prozent) und Spanien (15.3 Prozent) – Niedrige Arbeitslosenraten in den Niederlanden mit 3,3 und Deutschlande mit 3,7 Prozent – DJN, 1.7.2021
Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Mai wider Erwarten verringert. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 7,9 Prozent, nachdem sie im April bei revidiert 8,1 (vorläufig: 8,0) Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine stabile Quote von 8,0 Prozent prognostiziert.
Relativ niedrig ist die Arbeitslosenquote in den Niederlanden mit 3,3 Prozent und in Deutschland mit 3,7 Prozent. Die höchsten Erwerbslosenquoten weisen Griechenland mit 15,4 Prozent und Spanien mit 15,3 Prozent auf. Auch Italien hat mit 10,5 Prozent eine erhöhte Arbeitslosigkeit.
In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 7,3 (Vormonat: 7,4) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im Mai in der Eurozone 12,79 Millionen Menschen und in der gesamten EU 15,28 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53301742-eurozone-arbeitslosenquote-sinkt-im-mai-auf-7-9-prozent-015.htm
SCHWEDEN
Kassen außer Funktion: COOP-Filialen in Schweden nach Hackerangriff geschlossen – Schwedisches Bahnunternehmen SJ-AB ebenso betroffen – Die Presse/APA, 3.7.2021
„Einer unserer Subunternehmer war Ziel eines digitalen Angriffs, und deshalb funktionieren unsere Kassen nicht mehr“, erklärte Coop Schweden am Samstag.
Nach einem Cyberangriff hat eine der größten schwedischen Supermarktketten eigenen Angaben zufolge rund 800 Filialen vorübergehend geschlossen. „Einer unserer Subunternehmer war Ziel eines digitalen Angriffs, und deshalb funktionieren unsere Kassen nicht mehr“, erklärte Coop Schweden am Samstag. Der Konzern hoffe, das Problem schnell in den Griff zu bekommen und die Filialen wieder öffnen zu können.
Die Supermarktkette gab keine weiteren Details zu der Cyberattacke bekannt. Coop Schweden nannte weder den Namen des betroffenen Subunternehmens noch die Methode, mit der das Unternehmen gehackt wurde. Die schwedische Tochtergesellschaft des Softwarekonzerns Visma teilte jedoch mit, das Problem stehe im Zusammenhang mit einem größeren Cyberangriff auf das amerikanische IT-Unternehmen Kaseya am Freitag.
*** Auch Bahnunternehmen SJ betroffen ***
Neben anderen Unternehmen war auch das staatliche Bahnunternehmen SJ betroffen. Fahrgäste konnten dadurch im Bistro nicht mit Karte zahlen. Am Freitagabend habe es einen Angriff auf einen Dienstleister von Coop gegeben, der sowohl die normalen Kassensysteme als auch Selbstbedienungskassen der Supermärkte betraf, berichtete SVT. Man habe die ganze Nacht an den Problemen gearbeitet, sie jedoch noch nicht lösen können, sagte eine Sprecherin dem Sender. In einzelnen Regionen konnten einige Filialen im Land wieder aufmachen, wobei manche andere Bezahlsysteme nutzten.
Kaseya hatte seine Kunden nach dem Angriff aufgefordert, sofort ihren sogenannten VSA-Server abzuschalten, „bis Sie von uns weitere Informationen erhalten“. Über den VSA-Server können Unternehmen all ihre Computer und Drucker von einem einzigen Arbeitsplatz aus steuern.
*** Größter IT-Anbieter ***
Kaseya ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter für Informationstechnologie und IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen. Auf die Netzwerk-Software war den Angaben zufolge eine Ransomware-Cyberattacke verübt worden. Bei Angriffen mit Ransomware sperren oder verschlüsseln Hacker Computersysteme, um von den Nutzern Geld für die Freigabe ihrer Daten zu erpressen.
Zuletzt war es mehrfach zu Cyberangriffen auf US-Unternehmen gekommen. Im Mai waren die Colonial-Ölpipeline in den USA und die US-Tochter des weltgrößten Fleischproduzenten JBS Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware geworden. Voriges Jahr hatten sich Hacker über Software des amerikanischen IT-Unternehmens SolarWinds Zugang zu den Systemen von Ministerien, Behörden und Unternehmen verschafft.
QUELLE: https://www.diepresse.com/6003285/800-supermarkt-filialen-in-schweden-nach-hackerangriff-geschlossen
FRANKREICH
Frankreich: Preise für Energie und für Tabakwaren treiben Inflation auf höchsten Stand seit Ende 2018: HVPI nimmt auf 1,9 Prozent auf Jahressicht zu – dpa-AFX, 30.6.2021
Ein kräftiger Anstieg der Energiepreise treibt die Inflation in Frankreich weiter an. Im Juni legten die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Ende 2018. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.
In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich die Inflation in der ersten Jahreshälfte deutlich verstärkt. Im Januar hatte die Inflationsrate nur bei 0,8 Prozent legen. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau im Juni um 0,2 Prozent, wie es weiter in der Mitteilung hieß.
Wesentlicher Grund für den stärkeren Preisauftrieb sind höhere Energiepreise. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Energiepreise im Juni um 10,9 Prozent. Einen vergleichsweise starken Preisanstieg gab es auch bei Tabakwaren, während hingegen frische Nahrungsmittel um 3,4 Prozent günstiger waren als im Juni 2020
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53286424-frankreich-inflation-steigt-auf-hoechsten-stand-seit-ende-2018-016.htm
ITALIEN
Italien: Inflation steigt mit 1,3 Prozent auf höchsten Stand seit 2018 – dpa-AFX, 30.6.2021
In Italien hat die Inflation im Juni den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht. Sie legte aber nicht so stark zu wie erwartet. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 1,4 Prozent gerechnet. Im Mai hatte sie bei 1,2 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im Juni wie erwartet um 0,2 Prozent.
Im Vorjahresvergleich erreichte die Inflation in Italien den höchsten Stand seit Ende 2018. Besonders deutlich stiegen die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Strom.
Die Preisentwicklung in Italien bleibt aber weiter hinter der in der Eurozone insgesamt zurück. Wie das europäische Statistikamt Eurostat ebenfalls am Mittwoch mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Juni in der Eurozone 1,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor.
Die Europäische Union strebt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Zuletzt hatten Mitglieder der Notenbank mehrfach deutlich gemacht, dass bei einem Überschreiten der Zielmarke vorerst keine geldpolitischen Reaktionen zu erwarten seien.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53288620-italien-inflation-steigt-auf-hoechsten-stand-seit-2018-016.htm
DEUTSCHLAND
Hans Bentzien: Bundespräsident Steinmeier unterschreibt ESM-Gesetz nicht – In Schwebe beim Bundesverfassungsgericht: Hintergrund ist eine Klage von sieben FDP-Abgeordneten – Zeitung – Gesetz letztlich doch unterschrieben: EU-Aufbaufonds induzierte ähnlichen Vorgang wie im Frühjahr – DJN, 2.7.2021
Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat auf Bitte des Bundesverfassungsgerichts (BVerG) das Gesetz über die Reform des Euro-Rettungsfonds ESM nicht unterschrieben, womit es vorläufig nicht in Kraft treten kann. Das berichtet die FAZ unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundespräsidialamts. Ein Sprecher des Gerichts bestätigte die Bitte des Gerichts an Steinmeier. Grund ist eine Klage von sieben FDP-Bundestagsabgeordneten beim BVerfG, die außerdem eine einstweilige Verfügung beantragt hatten. Zuvor hatten Bundestag und Bundestag das Gesetz durchgewinkt.
Die Abgeordneten stoßen sich vor allem daran, dass der ESM als finanzieller Backstop des europäischen Bankenabwicklungsfonds SRF dienen soll. Dies komme einer Verfassungsänderung gleich und müsse deshalb im Bundestag mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden, argumentieren sie. Das Bundesverfassungsgericht muss nun zunächst über den Antrag auf einstweilige Verfügung entscheiden.
Im Frühjahr hatte Steinmeier zunächst seine Unterschrift unter das Gesetz über die Errichtung eines EU-Aufbaufonds verweigert. Auch hier war ein – inzwischen abgewiesener – Antrag auf einstweilige Verfügung der Grund gewesen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53316888-bundespraesident-steinmeier-unterschreibt-esm-gesetz-nicht-zeitung-015.htm
Deutschland – Preisschub bei Einfuhren beschleunigt sich: Einfuhrpreise im verteuerten sich um 11,8 Prozent – Basiseffekt und Energiepreise treiben – Ohne Energiepreise liegt Anstieg bei 6 Prozent, ohne Preise für Erdöl und Mineralölerzeugnisse bei 8 Prozent – dpaAFX/DJN, 28.6.2021
Nach Deutschland importierte Güter haben sich im Mai deutlich verteuert. Im Jahresvergleich seien die Einfuhrpreise um 11,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Analysten hatten bereits mit einer hohen Jahresrate gerechnet, waren im Schnitt aber von einem etwas geringeren Zuwachs ausgegangen. Im April waren die Importpreise im Jahresvergleich bereits stark um 10,3 Prozent gestiegen, nach einem kräftigen Plus von 6,9 Prozent im März. Eine höhere Vorjahresveränderung als im Mai hat es laut dem Bundesamt zuletzt im Oktober 1981 im Rahmen der zweiten Ölpreiskrise gegeben.
Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preiszuwachs von 1,3 Prozent und eine Jahresteuerung von 11,4 Prozent prognostiziert.
Einen erneuten Preisanstieg gab es auch im Monatsvergleich. In dieser Betrachtung verteuerten sich importierte Waren im Mai um 1,7 Prozent. Analysten überraschte diese Entwicklung: Sie hatten mit einer leichten Abschwächung des Preisauftriebes von 1,4 auf 1,3 Prozent gerechnet.
Den starken Preisanstieg im Jahresvergleich führte das Bundesamt vor allem auf Entwicklung der Energiepreise zurück: „Energieeinfuhren waren im Mai 2021 fast doppelt so teuer wie im Mai 2020.“
Dieser Anstieg begründe sich durch das außerordentlich niedrige Preisniveau vor einem Jahr. So war die Nachfrage nach Erdöl damals wegen der Corona-Krise schwach gewesen. Den größten Einfluss auf die Jahresveränderungsrate für Energie hatte demnach Erdöl mit einem Plus von 135 Prozent.
Ohne Energie hingegen waren die Importpreise dem Bundesamt zufolge im Mai diesen Jahres 6,0 Prozent höher als im Mai 2020 und 1,0 Prozent höher als im Vormonat. Wenn man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht lasse, liege der Importpreisindex 8,0 Prozent über dem Stand des Vorjahres. Gegenüber April 2021 ergebe sich ein Plus von 1,4 Prozent
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53261313-deutschland-preisschub-bei-einfuhren-beschleunigt-sich-energie-treibt-erneut-016.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53261214-deutsche-importpreise-steigen-im-mai-beschleunigt-015.htm
Andreas Plecko: Deutsche HVPI-Inflation lässt im Juni nach: harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) steigt nur noch mit einer Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,4) Prozen – DJN, 29.6.2021
FRANKFURT (Dow Jones)–Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,4) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,1 Prozent Inflation erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der Index um 0,4 Prozent. Das entsprach ebenfalls der Prognose.
Der HVPI ist die für die Europäische Zentralbank (EZB) relevante Inflationsmessgröße. Die EZB strebt mittelfristig knapp 2 Prozent an. Trotz des Rückgangs dürfte der Höhepunkt des Inflationsanstiegs aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei 3 bis 4 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.
Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich auf Monatssicht um 0,4 (0,5) Prozent und auf Jahressicht um 2,3 (2,5) Prozent. Dies entsprach exakt den Prognosen.
Waren kosteten im Juni 3,1 (3,1) Prozent mehr als im Vorjahresmonat, darunter Energie um 9,4 (10,0) Prozent und Nahrungsmittel um 1,2 (1,5) Prozent. Die Dienstleistungspreise stiegen um 1,6 (2,2) Prozent und Wohnungsmieten unverändert um 1,3 Prozent.
Destatis wies darauf hin, dass sich die Situation bei der Preiserhebung im Juni entspannt hat, denn stationärer Handel, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe waren weitgehend wieder geöffnet beziehungsweise die Leistungen konnten wieder angeboten werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53278363-deutsche-hvpi-inflation-laesst-im-juni-nach-015.htm
Deutschland – Nach höchstem Stand im Mai seit fast zehn Jahren: Juni-Preisauftrieb schwächt sich etwas ab – Inflation bei 2,3 Prozent – dpa-AFX, 29.6.2021
Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni etwas verlangsamt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Mai war noch eine Jahresinflationsrate von 2,5 Prozent in Europas größter Volkswirtschaft gemessen worden. Das war der höchste Stand seit fast zehn Jahren.
Angeheizt wird die Inflation weiterhin vor allem vom Anstieg der Energiepreise, die gegenüber Juni 2020 um 9,4 Prozent zulegten. Mit der Konjunkturerholung steigt weltweit die Nachfrage nach Rohöl, das treibt den Preis nach oben. Zudem ist seit Anfang 2021 in Deutschland eine Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid (CO2) fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht.
Nach zeitweise negativen Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte 2020 hat die Teuerung in Deutschland seit Beginn des laufenden Jahres angezogen. Im März hatte die Rate bei 1,7 Prozent gelegen, im April waren es 2,0 Prozent und im Mai 2,5 Prozent. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die in der Corona-Krise für ein halbes Jahr gesenkte Mehrwertsteuer seit Januar wieder auf ihrem alten Niveau ist.
Von Mai auf Juni 2021 stiegen die Verbraucherpreise nach vorläufigen Angaben der Wiesbadener Behörde um 0,4 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53278229-deutschland-preisauftrieb-schwaecht-sich-etwas-ab-inflation-bei-2-3-prozent-016.htm
Hans Bentzien: Ifo: Deutsche Industrie beklagt steigende Einkaufspreise – Lieferengpässe machen zu schaffen – DJN, 1.7.2021
Sehr viele deutsche Industriefirmen haben dem Ifo-Institut in den vergangenen drei Monaten Preissteigerungen bei Material gemeldet. In der Juni-Umfrage waren es 92,0 Prozent, wie das Ifo-Institut mitteilte. In der Textilbranche und bei der Möbelherstellung lag der Anteil sogar bei 100 Prozent der Teilnehmenden. Die Gummi- und Kunststoffwaren waren mit 99,4 Prozent kaum schwächer betroffen.
Aber auch andere Branchen berichten von höheren Preisen, darunter die Hersteller von elektrischer Ausrüstung (95,6 Prozent), die Metallerzeuger und -bearbeiter (95,0), die Hersteller von Metallerzeugnissen (94,9) die Bekleidungshersteller (94,0), die Produzenten von Datenverarbeitungsgeräten (93,5) und die Erzeuger von Pappe und Papier (93,2).
„Beim Stahl und auch beim Schnittholz sowie anderen holzbasierten Grundstoffen gibt es Lieferengpässe und damit einhergehend teils dramatische Preisbewegungen“, sagte Felix Leiss, Umfrageexperte beim Ifo-Institut. Wegen des Holzmangels seien mancherorts sogar Paletten knapp geworden. Aber auch bei Aluminium- und Kupferprodukten gebe es Lieferprobleme.
Leiss zufolge sind zudem synthetische Grundstoffe knapp, in der Folge fehlt es nun auch an synthetischen Garnen, Folien, Verpackungsmaterialien, Dämmstoffen und anderen Kunststoffprodukten. „Auch die Versorgung mit Halbleitern und anderen elektronischen Bauteilen stockt noch immer. Die Preise steigen in Anbetracht der Knappheiten vielerorts“, konstatierte der Ifo-Experte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53299910-ifo-deutsche-industrie-beklagt-steigende-einkaufspreise-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche Reallöhne sinken in 2021Q1 um 2 Prozent – Verbraucherpreis-Anstieg um 1,3 Prozent – Kurzarbeit beeinflusst Lohnentwicklung – DJN, 28.6.2021
Die inflationsbereinigten Löhne deutscher Arbeitnehmer sind im ersten Quartal 2021 gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) gingen sie gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,0 Prozent zurück. Laut Destatis sanken die Nominallöhne um 0,7 Prozent, während die Verbraucherpreise um 1,3 Prozent zulegten. Die Lohnentwicklung war vom vermehrten Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie beeinflusst. Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die nicht in den Verdienststatistiken erfasst wird.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53261397-deutsche-realloehne-sinken-im-1-quartal-um-2-prozent-015.htm
Markit: Deutsche Industrie zeigt im Juni Stärke – Punkteanstieg im Juni von 64,4 auf 65,1 – auf DJN, 1.7.2021
Das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Juni wieder etwas an Schwung gewonnen, da sowohl Produktion als auch Neuaufträge erstmals seit drei Monaten wieder stärker stiegen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 65,1 von 64,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 64,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 64,9 ermittelt worden.
Die weit verbreiteten Versorgungsengpässe waren jedoch erneut ein zentraler Punkt der jüngsten Umfrageergebnisse. So trugen sie laut IHS Markit dazu bei, dass die Auftragsbestände weiter zunahmen und sich die Verkaufspreise mit neuer Rekordrate verteuerten, während der Kostendruck stetig zunimmt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53301073-markit-deutsche-industrie-zeigt-im-juni-staerke-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de
Andreas Plecko: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): Auftragseingang bleibt auf Wachstumskurs – Basiseffekt: real 47 Prozent Zuwachs zum Vorjahr, davon Inlandsaufträge plus 33 Prozent, Auslandsaufträge plus 55 Prozent – DJN, 2.7.2021
Die Auftragsbücher im deutschen Maschinen- und Anlagenbau haben sich im Mai kräftig gefüllt. Insgesamt verbuchte die Branche einen Zuwachs der Bestellungen von real 47 Prozent zum – vergleichsweise schwachen – Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Nachfrage aus dem Inland stieg dabei um 33 Prozent, aus dem Ausland kamen sowohl aus den Euro-Staaten als auch aus den Nicht-Euro-Ländern jeweils 55 Prozent mehr Bestellungen.
„Damit lag der Zuwachs im Mai prozentual zwar unter dem noch kräftigeren Plus des Aprils von 72 Prozent. Doch der Maschinenbau bleibt eindeutig auf Wachstumskurs“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. „Sorgen bereitet uns allerdings die angespannte Situation in den Lieferketten sowie die neuerliche Diskussion um Grenzschließungen in der EU. Wir dürfen den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa nicht wieder durch einen Flickenteppich an Grenzkontrollen gefährden.“
Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum März bis Mai legten die Bestellungen insgesamt ebenfalls um real 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Aus dem Inland kamen 36 Prozent mehr Orders, die Auslandsaufträge legten um 52 Prozent zu. Aus den Euro-Ländern wurde eine Steigerung von 58 Prozent verbucht, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 50 Prozent mehr Bestellungen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53312467-vdma-auftragseingang-bleibt-auf-wachstumskurs-015.htm
Andreas Plecko: Deutscher Einzelhandel profitiert im Mai von Corona-Lockerungen mit Umsatzplus von 4,2 Prozent auf Monatssicht – DJN, 1.7.2021
Mit den sinkenden Corona-Inzidenzen und den damit verbundenen Lockerung sind die Umsätze im deutschen Einzelhandel im Mai kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, wuchsen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 4,0 Prozent prognostiziert.
Auf Jahressicht lagen die preisbereinigten Umsätze um 2,4 Prozent niedriger; allerdings hatte der Mai 2021 mit 23 Verkaufstagen einen Verkaufstag weniger als der Mai 2020. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 war der Umsatz im Mai kalender- und saisonbereinigt um 3,9 Prozent höher. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig größeren Revisionen.
Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Mai kalender- und saisonbereinigt real 3,4 Prozent mehr um als im Vormonat. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln gab es eine Steigerung um 6,7 Prozent.
Der besonders von Geschäftsschließungen betroffene Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren verzeichnete dabei ein Umsatzplus von 72,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) waren es 15,3 Prozent. Ebenso war der Umsatz im Handel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf um 9,6 Prozent höher. Der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein Umsatzplus von 5,7 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53299356-deutscher-einzelhandel-profitiert-im-mai-von-corona-lockerungen-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): DIW: Konsum treibt Erholung der deutschen Konjunktur – DJN, 30.6.2021
Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im Juni dank des Konsums weiter zugelegt. Lieferengpässe in der Industrie bremsten allerdings die Erholung, erklärte das DIW. Das DIW-Konjunkturbarometer für das zweite Quartal kletterte auf 113 Punkte und lag damit gut 3 Punkte höher als im Mai. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte nach Schätzungen des DIW in den Monaten April bis Juni um etwa 2,5 Prozent höher liegen als im ersten Vierteljahr.
„Mit zunehmender Eindämmung des Infektionsgeschehens kehren mehr und mehr Dienstleister, die durch die Kontaktbeschränkungen während der Lockdowns besonders eingeschränkt waren, zur Normalität zurück“, erklärte das DIW. Allerdings drohten Virusmutationen und eine möglicherweise noch nicht ausreichende Impfquote stellenweise „immer wieder Sand ins Getriebe zu streuen“, warnte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen.
Zudem verschärften sich die Knappheiten bei vielen Rohstoffen und Vorleistungsgütern. „Neben höheren Preisen führt dies dazu, dass die Industrie trotz üppiger Auftragspolster ihre Produktion vorerst drosselt“, erklärte Simon Junker, DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland.
Bislang sehe es aber nicht danach aus, dass diese Engpässe zu einem langfristigen Problem würden, so das DIW. Das Institut erwartet, dass die Produktionsausfälle bereits im Herbst weitgehend nachgeholt werden könnten. Denn die Nachfrage nach deutschen Gütern und Dienstleistungen steige weiter merklich – besonders die aus dem Ausland.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53287918-diw-konsum-treibt-erholung-der-deutschen-konjunktur-015.htm
Kurzbericht: Lieferengpässe kosten deutsche Volkswirtschaft rund 25 Mrd. Euro – Industrie verliert derzeit rund 5 Prozent an Wertschöpfung, was rund 1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht – Ohne Lieferengpässe könnte deutsche Industrieproduktion mindestens 5 Prozent höher sein – Institut für Weltwirtschaft, 29.6.2021
Die Industrieproduktion liegt gegenwärtig deutlich unter dem Niveau, das die Auftragslage hergibt. Maßgeblicher Grund dürften fehlende Zulieferungen, etwa aufgrund der Transportengpässe in der Schifffahrt, sein. Nach Schätzungen des IfW Kiel kosten sie die Industrie derzeit rund 5 Prozent an Wertschöpfung, was rund 1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Auf Jahressicht belaufen sich die Verluste für die deutsche Wirtschaft voraussichtlich auf rund 25 Mrd. Euro.
Seit Ausbruch der Coronakrise kann die Industrie vermehrt ihre Aufträge nicht mehr in gewohntem Maße abarbeiten. Im April 2021 lagt die Industrieproduktion fast 11 Prozent unter dem Niveau, das die Auftragseingänge eigentlich hätten erwarten lassen. Grundlage für die Schätzung sind Daten zur Beziehung zwischen dem Niveau von Auftragseingängen und Produktion der Industrie in Deutschland seit der Wiedervereinigung.
Bereits im August 2020 lag die Produktion bedingt durch die Pandemie etwa 10 Prozent unterhalb der erwartbaren Werte, der Auftragsüberhang wurde bis zum Jahresende jedoch etwa zur Hälfte abgebaut. Seit Beginn des laufenden Jahres ist die Lücke aber wieder erheblich größer geworden, wofür laut Unternehmensbefragungen vor allem Lieferengpässe verantwortlich sind, die zu einem Teil auf Störungen der Abläufe in der Containerschifffahrt zurückgeführt werden können.
„Die Schätzungen legen nahe, dass die deutsche Industrieproduktion mindestens 5 Prozent höher sein könnte, als sie es derzeit ist, wenn ausreichend Produktionsmaterialien und Zwischenprodukte zur Verfügung stünden. Voraussichtlich werden die Lieferengpässe die Industrieproduktion noch bis weit ins dritte Quartal hinein belasten, erst danach dürfte sich eine deutliche Besserung einstellen. Für das gesamte Jahr 2021 dürften sich die Verluste für die deutsche Volkswirtschaft auf rund 25 Milliarden Euro belaufen“, sagte Klaus-Jürgen Gern, Leiter der internationalen Konjunkturanalyse am IfW Kiel.
Ein großer Teil der derzeit verhinderten Produktion könnte aber nachgeholt werden und die Konjunktur dann im kommenden Jahr unterstützen.
Bereits seit einiger Zeit kommt es weltweit zu ungewöhnlich ausgeprägten Lieferengpässen. Die Lieferengpässe zeigen sich an verschiedenen Stellen entlang der Lieferketten und gehen auf mehrere Ursachen zurück. So hat die auf internationaler Ebene zeitlich heterogene Erholung nach der ersten Corona-Welle Transportengpässe im Schifffahrtsverkehr mit sich gebracht. Gleichzeitig ist der Bedarf nach Vorleistungsgütern, wie Halbleitern, durch die vielerorts kräftige wirtschaftliche Erholung sowie durch die Verschiebung der privaten Konsumausgaben von durch die Infektionsschutzmaßnahmen weniger verfügbaren Dienstleistungen hin zu langlebigen Konsumgütern spürbar gestiegen und dabei offenbar auf ein recht starres Angebot getroffen. Schließlich wurden die Lieferengpässe durch einzelne Ereignisse wie der vorübergehenden Blockade des Suez-Kanals oder witterungsbedingte Störungen verstärkt. Aufgrund dieser vielschichtigen Probleme ist derzeit schwer absehbar, wie lange diese Lieferengpässe noch anhalten werden.
QUELLE: https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/ifw-box/2021/bedeutung-von-lieferengpaessen-fuer-die-laufende-produktion-in-deutschland-0/
SIEHE DAZU
=> Studie
QUELLE (4-Seiten-PDF inkl. Schaubilder und Tabelle): https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/-ifw/IfW_Box/2021/Box_2021-9_Deutschland_Sommer.pdf
Hans Bentzien: Bankenaufsicht entlastet kleinere Kreditinstitute – DJN, 2.7.2021
Die rund 1.150 kleineren deutschen Kreditinstitute werden ab sofort von bestimmten administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht entlastet. Wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Bundesbank mitteilen, gelten die neuen Regelungen für alle Unternehmen, die nach der Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation – CRR) als kleines und nicht komplexes Institut („small and non complex institution“ – SNCI) klassifiziert sind.
Die Erleichterungen sind rein operativer Natur und sollen die SNCIs administrativ entlasten – es handelt sich nicht um kapital- oder liquiditätsschonende Maßnahmen. „Wir differenzieren jetzt noch stärker zwischen weniger auffälligen Instituten auf der einen und problematischen Instituten auf der anderen Seite“, sagte Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler.
„Die Klassifizierung als SNCI und die damit verbundenen Erleichterungen sind ein wichtiger Schritt hin zu mehr Proportionalität in der Regulierung“, sagte Joachim Wuermeling, das für Bankenaufsicht zuständige Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. „Gerade die deutsche Seite hatte den Gedanken der Proportionalität immer wieder in die europäischen Verhandlungen eingebracht.“ Jetzt werde er in die Tat umgesetzt.
Insgesamt sind rund 88 Prozent aller deutschen nicht-signifikanten Institute als SNCI klassifiziert worden. Zusammen repräsentieren sie rund 18 Prozent der Bilanzsumme des deutschen Bankensystems. Einen hohen Abdeckungsgrad gibt es insbesondere bei Genossenschaften (96 Prozent) und Sparkassen (82 Prozent). Die Bafin hat damit begonnen, die betroffenen Institute zu informieren.
Mit der Klassifizierung gehen folgende Maßnahmen und Erleichterungen einher:
1. SNCIs können auf Antrag bei der Bafin die vereinfachte strukturelle Liquiditätsquote („simplified Net Stable Funding Ratio“ – sNSFR) anwenden. Damit können SNCIs auf einige Meldepunkte verzichten.
2. Offenlegungsanforderungen werden künftig noch deutlicher nach Größe und Kapitalmarktorientierung der Banken abgestuft. SNCIs sparen hier also an Offenlegungsumfang und -frequenz.
3. Die Liquiditätsmeldung AMM (Additional Monitoring Metrics), mit der zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung übermittelt werden, ist künftig für Nicht-SNCIs monatlich abzugeben. Für SNCIs bleibt es bei der vierteljährlichen Meldung.
Kleine und nicht komplexe Institute sollen künftig von verringerten Meldepflichten profitieren. Der Bankenregulierer Eba hat diese perspektivisch denkbaren Einsparungen im Rahmen ihrer Kosten-Nutzen-Analyse auf 15 bis 24 Prozent der Kosten des europäischen bankaufsichtlichen Meldewesens beziffert. Für kleine, nicht komplexe Institute in der EU entspricht das Kosteneinsparungen zwischen 188 und 288 Millionen Euro.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53312456-bankenaufsicht-entlastet-kleinere-kreditinstitute-015.htm
Michael Maisch: Studie Deutsche Bankkunden müssen mit deutlich steigenden Gebühren rechnen –
Bankdienstleistungen kosten hierzulande derzeit deutlich weniger als im europäischen Durchschnitt. Das dürfte sich in Zukunft ändern. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für Kunden. – HANDELSBALTT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 30.6.2021
Laut McKinsey müssen sich deutsche Bankkunden auf höhere Gebühren einstellen. Eine Studie, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, zeigt, dass Kunden in Deutschland im Schnitt lediglich 135 Euro für alltägliche Bankdienstleistungen bezahlen. Der europäische Durchschnitt liegt dagegen bei 256 Euro. „Mittel- bis langfristig werden sich die Kosten stärker angleichen“, prognostiziert Max Flötotto, Leiter der deutschen Banking-Practice bei der Unternehmensberatung.
Der Berater hat aber auch eine gute Nachricht: Für die höheren Gebühren könnten Kunden auch mit besseren Dienstleistungen rechnen. Den McKinsey-Daten zufolge sind knapp 80 Prozent der Kunden bereits ziemlich zufrieden mit den digitalen Services ihrer Bank. Aber es gibt noch deutlich Luft nach oben, denn nur 14 Prozent sehen die Banken als Teil der digitalen Avantgarde.
Höhere Einnahmen könnten die deutschen Geldhäuser gut gebrauchen, denn die Studie zeichnet ein ziemlich trübes Bild: „Die Banken starten den Aufholprozess von einer schwierigen Ausgangsbasis aus“, konstatiert Flötotto. In den vergangenen zehn Jahren sei der Ertragspool um acht Prozent geschrumpft, während die Leistung der gesamten Wirtschaft um 35 Prozent gestiegen sei.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/studie-deutsche-bankkunden-muessen-mit-deutlich-steigenden-gebuehren-rechnen/27358230.html
Hanno Mussler: Auch von Bestandskunden: ING verlangt künftig ab 50.000 Euro Strafzinsen – Die Direktbank drängt Kunden zur Zustimmung: kaum Auswege davor, Widerspenstigen droht Kündigung der Bankverbindung – Nach Welle der Kostenüberwältzung: zwei Fünftel der Bankkunden stimmen Überwälrzung zu – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.6.2021
ach der Postbank und der Commerzbank verlangt nun auch die ING Deutschland bald Negativzinsen auf Kontoguthaben schon ab 50.000 Euro. Von November an müssen Bestands- und Neukunden 0,5 Prozent „Verwahrgebühr“ zahlen, wie die mit neun Millionen Kunden größte deutsche Direktbank am Montag mitteilte. Bisher erhob die ING, die unter dem Namen Diba und hohen Zinsen auf Tagesgeld groß geworden ist, diese Gebühr nur für Einlagen ab 100.000 Euro von Neukunden. Erst 2020 hat die ING überhaupt Kontoführungsgebühren eingeführt.
ach der Postbank und der Commerzbank verlangt nun auch die ING Deutschland bald Negativzinsen auf Kontoguthaben schon ab 50.000 Euro. Von November an müssen Bestands- und Neukunden 0,5 Prozent „Verwahrgebühr“ zahlen, wie die mit neun Millionen Kunden größte deutsche Direktbank am Montag mitteilte. Bisher erhob die ING, die unter dem Namen Diba und hohen Zinsen auf Tagesgeld groß geworden ist, diese Gebühr nur für Einlagen ab 100.000 Euro von Neukunden. Erst 202
Doch angesichts der negativen Zinsen, die die ING selbst für ihre Einlagen bei der EZB zahlen muss, will sie nun deutlich umfassender auch „Strafzinsen“ sogar von ihren Bestandskunden verlangen. „Bisher haben wir die Kosten, die durch sinkende Zinsmargen und den negativen Einlagenzins der EZB entstehen, durch unser bestehendes Produktportfolio weitgehend ausgleichen können“, sagte ING-Deutschlandchef Nick Jue. „Allerdings steigen die Einlagen weiter, auch weil viele Wettbewerber bereits ein Verwahrentgelt für Privatkunden eingeführt haben.“
Mit anderen Worten: Die ING versucht den Einlagenzustrom abzuwehren. Dieses Abwehrmanöver hat damit zu tun, dass nahezu alle deutschen Banken mehr Einlagen haben, als ihre Kunden Kredite nachfragen. Die Geschäftsbanken schwimmen also in Geld.
*** 40 Prozent der Kunden sollen dies klaglos akzeptiert haben ***
Seit 2014 verlangt die Europäische Zentralbank (EZB) von den Geschäftsbanken Strafzinsen für bei ihr geparktes Geld, und auch am Anleihemarkt gibt es kaum Zinsen zu verdienen. Vor einigen Monaten hat die EZB die Freibeträge („Staffelzins“) der Geschäftsbanken für ihre Einlagen jedoch deutlich erhöht und sie damit von den Negativzinsen ein Stück weit entlastet. Außerdem hilft sie den Geschäftsbanken, die sich für ihr sogenanntes LTRO-Programm qualifizieren, mit langfristigen Krediten (LTRO) ebenfalls zu Negativzinsen, also mit einer Art Prämie. Dank dieser LTRO-Kredite hatten etwa die Deutsche Bank und die Commerzbank im ersten Quartal 2021 im Privatkundengeschäft überraschend hohe Erträge erzielt.
Trotz dieser Erleichterungen der EZB geben inzwischen schon mehr als 400 deutsche Banken die Negativzinsen der EZB an ihre Kunden weiter, allein in diesem Jahr kamen mehr als 150 hinzu, darunter auch große Institute. So senkte die zur Deutschen Bank gehörende Postbank die Freigrenzen für Spareinlagen auf 50.000 Euro bei Girokonten und 25.000 Euro bei Tagesgeldkonten von neuen Kunden, wie die F.A.Z. Anfang Juni berichtete. Anschließend meldeten sich auch viele Postbank-Bestandskunden, sie seien aufgefordert worden, Negativzinsen zuzustimmen.
Bisher haben die Banken oft die Verwahrentgelte durch eine Änderung ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeführt. 40 Prozent der Kunden sollen dies klaglos akzeptiert haben, heißt es aus der Branche. Doch ein neues BGH-Urteil verlangt eine aktive Zustimmung der Kunden. Deshalb hat die Commerzbank sich mehrere Monate Zeit genommen und führt erst ab August negative Zinsen ebenfalls auf Einlagen ab 50.000 Euro ein.
Monatliche Sparpläne wurden von Kaufgebühren befreit
Noch mehr Zeit gibt die ING Deutschland ihren Kunden. Zwar gelten die neuen Freibeträge und die negativen Zinsen für alle ab 6. Juli neu eröffneten Konten. Für Bestandskunden werde das Verwahrentgelt ab 50.000 Euro aber erst ab Anfang November fällig, erklärte das Institut. Derzeit wären von den neun Millionen Bestandskunden etwa 750.000, also etwa 8 Prozent betroffen. Sie sollen in den kommenden Wochen angeschrieben und um Zustimmung gebeten werden….
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ing-verlangt-ab-50-000-euro-strafzinsen-von-allen-kunden-17411318.html
Wirtschaftssensibler BA-Stellenindex erreicht Vorkrisenniveau vom März 2020: Arbeitskräfte-Nachfrage weiter im Aufwind – Gestiegene Nachfrage vor allem im verarbeitenden Gewerbe, Gastgewerbe, Information und Kommunikation – DJN, 29.6.2021
Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat ihre Erholung fortgesetzt. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Juni um 5 Punkte auf 114 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Der BA-X erreichte damit erstmals wieder den Wert vom März 2020, also dem letzten Berichtsmonat, bevor die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sichtbar wurden.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der gemeldete Stellenbestand im verarbeitenden Gewerbe, im Gastgewerbe, bei Information und Kommunikation deutlich höher. Aber auch bei Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Handel, bei Verkehr und Logistik sowie bei der Arbeitnehmerüberlassung war ein spürbares Plus zu verzeichnen. Lediglich der Öffentliche Dienst hat in diesem Juni etwas weniger Personalbedarf gemeldet als ein Jahr zuvor.
Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53274922-ba-stellenindex-erreicht-vorkrisenniveau-015.htm
Hans Bentzien: Schulden öffentlicher Haushalte Deutschlands steigen im 1Q um 1,5% – DJN, 28.6.2021
Die Schulden der öffentlichen Haushalte Deutschlands sind im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent gestiegen und haben erstmals die Marke von 2,2 Billionen Euro überschritten. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) war der öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) am Ende des ersten Quartals beim nicht-öffentlichen Bereich mit 2.205,4 Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 26.532 Euro.
Der Anstieg war laut Destatis vor allem auf Maßnahmen von Bund und Ländern zur Bewältigung der Corona-Pandemie zurückzuführen. Gegenüber dem ersten Quartal 2020 nahm die Verschuldung um 12,8 Prozent bzw. 250,0 Milliarden Euro zu.
Der Schuldenanstieg war mit Ausnahme der Sozialversicherung auf einen Zuwachs bei allen Ebenen zurückzuführen. Den größten Anteil verzeichnete der Bund mit einer Steigerung um 2,0 Prozent bzw. 28,0 Milliarden Euro auf 1.431,4 Milliarden Euro. Die Verschuldung der Länder nahm auf Quartalssicht um 0,6 Prozent zu und die der Gemeinden und Gemeindeverbände um 1,1 Prozent. Die Sozialversicherung hatte 54 Millionen Euro Schulden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53261396-schulden-oeffentlicher-haushalte-deutschlands-steigen-im-1q-um-1-5-015.htm
Scholz will große Mehrheit der Steuerzahler entlasten – Wochenend-Überblick DJN, 27.6.2021
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will nach der Bundestagswahl den Spitzensteuersatz für Singles erst ab 100.000 Euro Jahresbruttoeinkommen greifen lassen und so 96 Prozent der Steuerzahler entlasten. „Ich finde es richtig, wenn jemand mit einem so hohen Einkommen wie ich mehr Steuern zahlt“, sagte Scholz der Bild am Sonntag. Singles sollen deshalb ab einem Jahresbruttoeinkommen oberhalb von 100.000 Euro und Verheiratete oberhalb von 200.000 Euro einen „künftigen Spitzensatz“ zahlen. Bislang will die SPD den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent anheben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53260293-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-26-und-27-juni-2021-015.htm
ÖSTERREICH
STATISTIK AUSTRIA
# Erzeugerpreise des Produzierenden Bereichs im Mai 2021 um 6,0% über Vorjahresniveau
# Inflation im Juni 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 2,7%
#Konjunktur-Frühschätzung Mai 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich erholt (+38,6% zu Mai 2020); Umsatzplus von 5,0% im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Mai 2019
# Auftakt der Tourismus-Sommersaison 2021 mit kräftigem Nächtigungsplus im Vergleich zum Mai 2020, aber weit unter Vorkrisenniveau
# Rund 90% der 37.356 Unternehmensneugründungen des Jahres 2019 im Dienstleistungsbereich angesiedelt
# Öffentlicher Schuldenstand am 31. März 2021 bei 326,9 Mrd. Euro, um 11,7 Mrd. Euro höher als Ende des Jahres 2020
# 139 Verkehrstote bei Alleinunfällen im Jahr 2020; zwei Drittel aller Alleinunfälle von Lenkerinnen bzw. Lenkern einspuriger Fahrzeuge verursacht
QUELLE: https://www.statistik.at
Eric Frey: Institut für Höhere Studien: Lars Feld: Ein unbequemer Liberaler auf dem Weg zum IHS-Chef – Der Standard, 3.7.2021
Die SPD servierte Lars Feld als deutschen Wirtschaftsweisen ab. Nun zieht es den Ökonomen nach Wien. Seine Positionen sind konservativ-liberal
Wenn der prominente deutsche Ökonom Lars Feld tatsächlich als neuer Chef des Instituts für Höhere Studien nach Wien kommt, dann hat das IHS diesen Coup der SPD zu verdanken. Diese verhinderte im Februar seine Verlängerung als Vorsitzender des Sachverständigenrates, der die Berliner Regierung wirtschaftspolitisch berät.
Gerade dieser Hintergrund sorgt in Wien für Naserümpfen: Der 54-Jährige mag wissenschaftlich angesehen und persönlich umgänglich sein; aber wenn er Finanzminister Olaf Scholz (SPD), wahrhaft kein Linksradikaler, politisch suspekt ist, steht er dann nicht auch für Österreich zu weit rechts?
Zehn Jahre Wirtschftsweiser
Das Ende seiner zehnjährigen Karriere als deutscher Wirtschaftsweise – davon nur ein Jahr als Vorsitzender – dürfte vor allem dem anlaufenden Wahlkampf und roten Personalwünschen als Felds konkreten Positionen zuzuschreiben sein. Dennoch ist klar: Trotz seiner SPD-Mitgliedschaft in jüngeren Jahren ist Feld heute ein vehementer Verfechter eines marktwirtschaftlichen Kurses mit konservativen Einschlägen.
Als Vorsitzender des Sachverständigenrates trat er vor allem als Befürworter der Schuldenbremse in Erscheinung, jener Verfassungsbestimmung, die langfristig eine schwarze Null im Bundeshaushalt garantieren soll. Auch den 2015 eingeführten Mindestlohn sieht er skeptisch, ebenso lehnt er eine Vermögenssteuer ab. Auch bei milliardenschweren Investitionsprogrammen für den Ausbau der Infrastruktur steht Feld auf der Bremse.
Pragmatismus statt Dogma
Wenn man seinen Worten genauer folgt, dann zeigt sich allerdings, dass Feld keine Klientelpolitik für Wirtschaftspolitik betreibt und meist nicht dogmatisch, sondern pragmatisch argumentiert. Bei der Schuldenbremse betont er deren Flexibilität, die es der deutschen Regierung erlaubt hat, Unternehmen während der Corona-Pandemie mit vielen Milliarden zu stützen und große Budgetdefizite zu fahren. Eine Schuldenobergrenze, wie sie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verlangt hat, hält er daher für kontraproduktiv.
Das 750 Milliarden Euro schwere EU-Wiederaufbauprogramm „Next Generation EU“ sieht er zwar nicht grundsätzlich negativ, warnt aber vor falschen Anreizen. „Die EU finanziert, gestützt durch die solideren Mitgliedsstaaten, Ausgabenentscheidungen in den höher verschuldeten Mitgliedsstaaten ohne eine nennenswerte Kontrolle über die Mittelverwendung“, sagte er in einer Rede vor der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung im April. „Dieser Verstoß gegen das Haftungsprinzip kann nur ausnahmsweise und vorübergehend akzeptabel sein.“
Problematische Vermögenssteuer
Bei der Vermögenssteuer sieht Feld das Problem, dass man Betriebsvermögen in Familienunternehmen schonen müsste, um diese nicht zu ruinieren, aber damit neue Ungleichheiten schaffen würde. Und bei öffentlichen Großinvestitionen warnt er vor allem vor Ineffizienz und Verschwendung, wie etwa bei den vielen deutschen Regionalflughäfen, die wenig genutzt werden.
Feld selbst bezeichnet sich als Anhänger des Ordoliberalismus, jener deutschen Schule der Volkswirtschaft, die einen starken Staat fordert, der sich mit sehr klaren Regeln nur dort in die Wirtschaft einmischt, wo es zu Marktverzerrungen kommt. Daher befürwortet er im Kampf gegen den Klimawandel eine spürbare CO2-Bepreisung und will, dass der Staat die finanzielle Belastung zwar für sozial Schwächere ausgleicht, nicht aber für Unternehmen. „Der Großteil der für den Wandel nötigen Investitionen ist privat. Es gibt überhaupt keinen Grund, das staatlich zu subventionieren“, sagte er in einem Welt-Interview im Februar. Selbst Kritiker gestehen dem unbequemen Saarländer völlige politische Unabhängigkeit zu. Wenn er einer Partei nahesteht, dann der FDP.
Einer der Begründer des Ordoliberalismus war der Ökonom Walter Eucken, nach dem das Walter-Eucken-Institut an der Universität Freiburg benannt ist, das Feld seit 2010 leitet. Es gilt als einflussreich, aber ist deutlich kleiner als das IHS – vielleicht ein Motiv für Feld, von der großen deutschen auf die kleine österreichische Bühne zu wechseln.
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000127916767/lars-feld-ein-unbequemer-liberaler-auf-dem-weg-zum-ihs
Zinshausmarkt in Österreich: Mehr Transaktionen, weniger Volumen – 2020 wurden mehr Zinshäuser verkauft als 2019, aber das Marktvolumen war geringer – Pressetext/Hudej Zinshäuser Wien, 28.6.2021
Wie jedes Jahr hat der Zinshaus-Spezialist Hudej Zinshäuser Gruppe wieder den gesamten Markt für Zinshäuser in Österreich analysiert. Das Ergebnis: 2020 wechselten mehr Häuser die Eigentümer als 2019, aber dabei wurde insgesamt weniger Marktvolumen generiert. So belief sich der gesamte Marktumsatz auf 2,855 Mrd. Euro im Vergleich zu 3,006 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum. Das entspricht einem Rückgang um 5 %. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Transaktionen um 47,7 % von 1.169 auf 1.727.
*** Bundesländer-Trend bestätigt sich ***
Der daraus zu ziehende Schluss sei klar, erklärt Gerhard Hudej, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens: „Der Markt in den Bundesländern holt gegenüber Wien stark auf. Da in den Ländern und deren Hauptstädten die Einzelvolumina im Durchschnitt kleiner sind, sinkt österreichweit das Gesamtvolumen trotz steigender Transaktionsanzahl.“
*** Wien: Der Markt beruhigt sich ***
Wien allein betrachtet weist im Vergleich zum Vorjahr sogar einen Rückgang um 25 % beim Volumen auf, während die Anzahl der Transaktionen um 10 % geringer ausfiel als 2019 (Volumen 2019 / 2020: 2,23 Mrd. / 1,67 Mrd., Transaktionen 2019 / 2020: 516 / 464). Dies deutet darauf hin, dass sich die hohen Preise auf die Nachfrage auszuwirken beginnen. Außerdem kamen weniger große Liegenschaften im obersten Preissegment auf den Markt. Dies lässt sich daraus ablesen, dass der Rückgang beim Volumen zweieinhalb mal höher ist als bei der Transaktionsanzahl.
*** Mehr Share Deals ***
Ein weiterer Grund für den Rückgang des Marktvolumens in Wien kann allerdings auch in der Zunahme der Share Deals liegen. In all jenen Fällen, wo nicht die Liegenschaft selbst verkauft wird, sondern die betreffende Besitzgesellschaft, scheint die Transaktion nicht im Grundbuch auf. Da aufgrund der steigenden Preise in Wien vermehrt Share Deals gewählt werden, um Steuern und Gebühren zu sparen, geht das im Grundbuch ersichtliche Marktvolumen zurück.
*** Bundesländer boomen fast durchwegs ***
In den Bundesländern sind im Jahr 2020 sowohl das Volumen als auch die Transaktionen deutlich gestiegen. Zweitwichtigstes Bundesland nach Wien ist Niederösterreich, wo die Hudej Zinshäuser Gruppe seit 2020 einen eigenen Standort hat. Hier wuchs das Volumen von 195,5 Mio. Euro um 40 % auf 274 Mio. Euro. Die Transaktionen stiegen sogar um knapp 84 % von 178 auf 327. In der Steiermark, wo sich der Markt in den letzten Jahren schon zu entwickeln begonnen hatte, fiel die Steigerung ebenfalls deutlich aus: Das Volumen 2020 betrug 211 Mio. Euro (+ 6 %), bei 244 Transaktionen (+ 71 %). Hudej Zinshäuser ist hier schon seit 2014 präsent.
*** Stärkste Zuwachsraten im Westen ***
Relativer Spitzenreiter des Jahres 2020 ist Tirol mit einer Steigerung von 368 % beim Volumen (2019 / 2020: 36 Mio. Euro / 170 Mio. Euro) und 625 % bei den Transaktionen (2019 / 2020: 32 / 232). Einziger Ausreißer ist Oberösterreich, wo es zu einem leichten Rückgang bei den Transaktionen kam, wobei aber das Volumen trotzdem höher war als im Vorjahr (Volumen 2019 / 2020: 150 Mio. Euro / 198 Mio. Euro; Transaktionen 2019 / 2020: 136 / 126). In Salzburg wurde ein Volumen von 144 Mio. Euro gemessen (+ 19 %), bei 101 Transaktionen (+ 30 %). Den zweithöchsten relativen Zuwachs Österreichs verzeichnete Vorarlberg: Hier stieg das Volumen um 171 % auf 74 Mio. Euro, 119 Transaktionen bedeuten eine Steigerung um 325 %. In Kärnten wurde beim Volumen ein Plus von 126 % auf 97 Mio. Euro gemessen, bei den Transaktionen ein Zuwachs um 78 % auf 87. Im Burgenland stieg das Marktvolumen um 177 % auf 13 Mio. Euro, 27 Transaktionen im Jahr 2020 bedeuten seine Steigerung um 200 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
*** Methode ***
Für die vorliegende Marktanalyse wurden alle Transaktionen von Zinshäusern und Mehrfamilienhäusern herangezogen, die bis 30.5. 2021 im Grundbuch eingetragen waren. Share Deals blieben unberücksichtigt.
ÜBER HUDEJ ZINSHÄUSER: Die Hudej Zinshäuser Gruppe ist das einzige Unternehmen, das sich mit sieben Standorten in Österreich und einem in der Schweiz auf die Vermarktung von Zinshäusern in ganz Österreich spezialisiert hat. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2012 von Gerhard Hudej gegründet. Das bisher begleitete Transaktionsvolumen beträgt insgesamt rund eine Milliarde Euro bei einer Gesamtanzahl von rund 300 Transaktionen. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiter und ist in Wien, Salzburg, Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Innsbruck sowie Zürich vertreten.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210628014
Anderl: Eine Millionärssteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit – Arbeiterkammer, 25.6.2021
Laut dem neuesten Trend-Reichen-Ranking haben Österreichs Multimillionäre trotz Corona ein gutes Jahr hinter sich. Die 10 Reichsten etwa haben ihr Vermögen um 30 Prozent vergrößert.
Trend Ranking zeigt wie die Super-Reichen noch reicher wurden
„Die Corona-Krise macht viele Schieflagen augenscheinlich. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden von der Krise hart getroffen, die Arbeitslosigkeit und Armut sind deutlich gestiegen“, sagen AK Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. „Wir müssen die Armut verringern und können nicht zuschauen, wie Reiche ihr Vermögen steuerfrei vermehren. Eine Millionärsabgabe ist eine Frage der Gerechtigkeit, auch immer mehr Super-Reiche selbst sehen das so und fordern das lautstark ein“, so Anderl.
„Diese Entwicklung ist zutiefst ungerecht, weil sie genau jene schützt, die durch ihre großen Vermögen keinen Schutz brauchen und jene schwächt, die ohnehin durch die Corona-Krise ins Wanken gekommen sind. Es gibt nur eine Lösung, um diese Schieflage zu korrigieren: eine Vermögenssteuer. Es muss Geld locker gemacht werden, aber nicht auf Kosten der ArbeitnehmerInnen, sondern auf Kosten derer, die es ich leisten können“, ergänzt Katzian.
Österreich wies bereits vor der Pandemie eine der höchsten Vermögensungleichheiten in der Eurozone auf. Das reichste 1 Prozent besitzt fast 40 Prozent des gesamten Nettovermögens. Die Hälfte der Bevölkerung hat hingegen kaum nennenswertes privates Vermögen und kann auf kein finanzielles Polster in der Krise zurückgreifen. Für sie ist der Wohlfahrtsstaat mit dem gut ausgebauten Gesundheits- und Sozialsystem ein Schutzschild in der Pandemie. „Die ArbeitnehmerInnen dürfen nun nicht auf den Kosten der Krise sitzen bleiben, denn viele haben 2020 an Einkommen verloren, während die Vermögen der Reichsten weiter gestiegen sind“, so Anderl.
*** Von einer Vermögenssteuer wären nur die reichsten 3 bis 4 % betroffen ***
Um Super-Reiche mehr zum Sozialstaat beitragen zu lassen, fordern AK und ÖGB einen progressiven Steuertarif ab 1 Million Euro Nettovermögen. Studien zeigen, dass schon bei Steuersätzen von 0,5 bis 1,5 Prozent budgetäre Mehreinnahmen von bis zu 5 Milliarden Euro möglich sind. Potenzielle Ausweicheffekte sind da schon abgezogen. Von so einer Vermögenssteuer wären nur die reichsten 3 bis 4 Prozent der Haushalte betroffen.
„Eine Millionärsabgabe oder Vermögenssteuer, wie wir sie fordern, bedeutet keine Belastung des Mittelstands, wie Gegner fälschlicherweise immer noch argumentieren. Es geht darum, dass die Gewinner dieser Krise auch einen Beitrag leisten, den sie vermutlich gar nicht spüren, damit andere besser aus der Krise herauskommen!“, so Katzian.
QUELLEN
https://www.arbeiterkammer.at/millionaerssteuer
(verdeckt verlinkt): https://www.arbeiterkammer.at/millionaerssteuer#heading_Trend_Ranking_zeigt_wie_die_Super_Reichen_in_einem_Jahr__das_von_Rekordarbeitslosigkeit_gepraegt_war__noch_reicher_wurden
SIEHE DAZU: https://soreichistoesterreich.ak.at/
Die reichsten Österreicher 2021: Milliardäre & Clans – Trend, 25.6.2021
Die reichsten Österreicher haben die Corona-Krise offenbar nahezu mühelos überstanden. Die 100 Reichsten besitzen mehr als 200 Milliarden Euro und damit fast zehn Prozent des heimischen Gesamtvermögens, die Hälfte davon entfällt auf die Top 10. 2021 sind junge Start-up-Millionäre in die Liga der Superreichen aufgestiegen.
Nach der Coronabedingten Delle im Vorjahr sind die meisten der großen Vermögen jetzt wieder spürbar gewachsen. Mit mehr als 200 Milliarden Euro besitzen die 100 reichsten Österreicher – unter ihnen nun 46 Milliardäre – fast zehn Prozent des heimischen Gesamtvermögens. Zum Vergleich: Die gesamten österreichischen Staatsausgaben beliefen sich im Corona-Jahr 2020 auf 217,4 Milliarden Euro (+12% oder +24,4 Mrd. € gegenüber 2019).
Erstmals finden sich auch Gründer von milliardenschweren heimischen Start-ups im trend-Reichsten-Ranking der. Mit einer Bewertung von 1,4 Milliarden Euro ist GoStudent das wertvollste Start-up Österreichs. Felix Ohswald und Co-Gründer Gregor Müller, denen über Stiftungen rund 22 Prozent der Anteile zuzurechnen sind, kommen zusammen auf ein Vermögen von 300 Millionen Euro. Mit 26 bzw. 27 Jahren gehören die beiden zu den jüngsten Selfmade-Multimillionären im Land – mit einem Platz im Ranking der 100 reichsten Österreicher.
Auch ein zweiter Neuzugang ist in der Start-up-Welt beheimatet. Das Gründertrio der 2014 als Kryptobörse gegründeten Tradingplattform Bitpanda bringt es mit der aktuellen Bewertung von rund einer Milliarde Euro auf ein Vermögen von in Summe über 600 Millionen Euro. Damit sichern sich die Bitpanda-Jungs eine Platzierung auf Augenhöhe mit so angesehenen und einflussreichen Industriellenfamilien wie Zimmermann oder Kapsch.
Die reichsten Österreicher und ihr Vermögen
An der Spitze im vom trend seit Jahrzehnten akribisch erstellten Reichen-Ranking gab es im Jahr 2021 einige Verschiebungen, aber grundsätzlich wenig Veränderung. Unter den ersten 15 im trend-Ranking des Jahres 2021 befinden sich acht Familien oder Familienclans. Angeführt wird das Ranking auch in diesem Jahr von den Familien Porsche und Piech , deren Beteiligungen an Volkswagen und Porsche, Finanzanlagen und Immobilienbesitz nunmehr mit einen Wert von 51,1 Milliarden Euro beziffert werden können – ein Plus von 16 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr.
Ebenfalls wieder dahinter auf Rang zwei liegt Dietrich Mateschitz , der 49-Prozent-Eigentümer von Red Bull. Das von dem mittlerweile 77 Jahre alten Unternehmer aufgebaute Imperium wird aktuell auf 16,4 Milliarden Euro taxiert
Mit Novomatic-Eigentümer Johann Graf (Rang 5; Vermögen: 5,5 Mrd. €), Immobilien- und Handels-Tycoon René Benko (Rang 6; Vermögen: 4,9 Mrd. €), Montana- und Wertinvest Eigner Michael Tojner (Rang 7; Vermögen: 4,7 Mrd. €), Immo- und Industrieboss Georg Stumpf (Rang 8, Vermögen: 4,3 Mrd. €), Finanzinvestor Martin Schlaff (Rang 13, Vermögen: 3,4 Mrd. €) und L’Occitane-International Chef Reinhold Geiger (Rang 15, Vermögen: 3,0 Mrd. €) gibt es unter den Top 15 noch sechs weitere Self-Made-Milliardäre.
Die verbleibenden Spitzenplätze im Top-100-Ranking entfallen auf Familien: Elisabeth & Georg Schaffler (Rang 3, Vermögen: 9,4 Mrd. €); die Wlaschek-Erben (Rang 4, Vermögen: 5,6 Mrd. €), die Familie Flick (Rang 9, Vermögen: 4,0 Mrd. €); die Familie Swarovski (Rang 10, Vermögen: 3,6 Mrd. €); die Familie Mayr-Melnhof (Rang 11, Vermögen: 3,6 Mrd. €); die Famlien Lehner (Rang 12, Vermögen: 3,5 Mrd. €) und die Brüder Kaufmann (Rang 14, Vermögen: 3,2 Mrd. €).
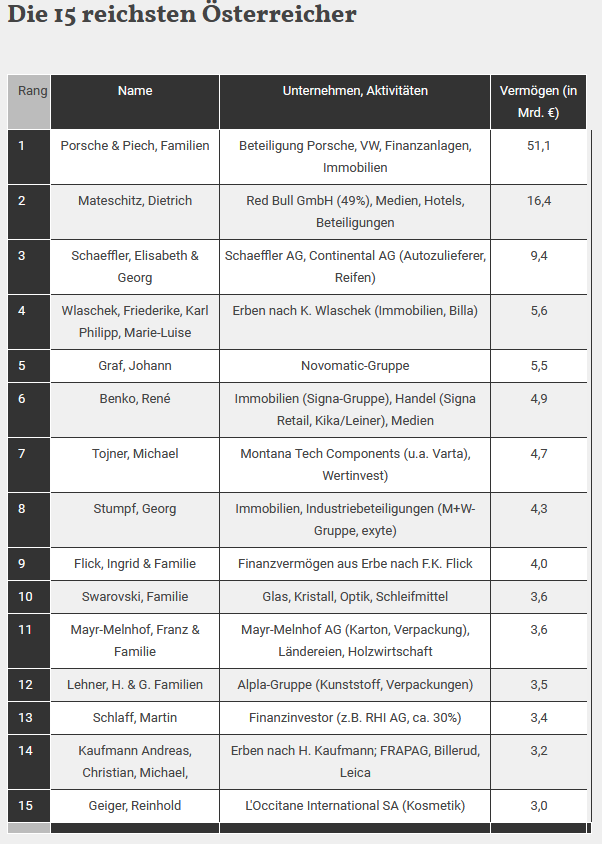
Das Vermögen der 15 reichsten Einzelmilliardäre und Clans summiert sich somit auf die erstaunliche Summe von 126,2 Milliarden Euro, die ersten zehn halten insgesamt ein Vermögen von 109,5 Milliarden Euro – rund fünf Prozent des Gesamtvermögens aller Österreicher.
*** Die Vermögenskonzentration in Österreich ***
Bis 2025 wird das Gesamtvermögen der Österreicher auf 3,9 Billionen Dollar zulegen. Die schon ausgeprägte Ungleichheit wird sich weiter verschärfen.
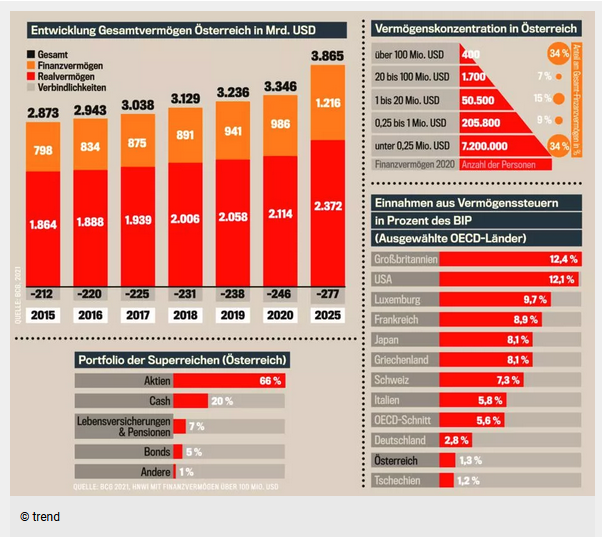
Durch die boomenden Aktienmärkte ist das Wachstum des Finanzvermögens 2020 mit fünf Prozent auf knapp eine Billion Dollar deutlicher ausgefallen als nach Ausbruch der Coronakrise zunächst erwartet. Aber schon heute besitzen nur rund 400 Personen mehr als ein Drittel davon – keine weniger als 100 Millionen Dollar. Bis 2025 soll der Anteil dieser Gruppe auf 36 Prozent steigen. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn das Gesamtvermögen der Österreicher bis 2025 auf über 3,9 Billionen Dollar zulegt, wie der „Global Wealth Report“ der Boston Consulting Group vorhersagt. Nicht zuletzt aufgrund ihrer risikoreicheren Asset-Allokation werden die Superreichen auch davon überproportional profitieren. Arbeiterkammer und Gewerkschaften fordern schon länger höhere Vermögenssteuern, weil Österreich deutlich unter dem OECD-Schnitt liegt.
QUELLE: https://www.trend.at/wirtschaft/oesterreicher-milliardaere-clans-12143947
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER
Martin Greive: Eine Vermögensteuer ist aus ökonomischer Sicht die dümmste aller Steuerideen –
Eine Vermögensteuer hat ausschließlich Nachteile. Sie belastet Unternehmen in der Substanz und ist aufwendig. Wer Ungleichheit bekämpfen will, sollte zu anderen Mitteln greifen – Handelsblatt, 2.7.2021
Die Vermögensteuer ist wieder en Vogue. Und keineswegs nur unter Linken. Auch eine breite Mehrheit der Bürger befürwortet in Umfragen eine Wiedereinführung. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen dem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden der Bürger und den realen Folgen einer Steuer für die deutsche Volkswirtschaft.
Aus ökonomischer Sicht ist eine Vermögensteuer jedenfalls die dümmste aller Steuern. Wer meint, Ungleichheit und zu mächtig werdende Unternehmen in der Marktwirtschaft bekämpfen zu müssen, sollte zu anderen Mitteln greifen.
Bei einer Vermögensteuer ist die Belastung für Firmen selbst bei niedrigen Steuersätzen hoch. Sie wirkt somit wie eine verkappte Unternehmensteuer und entzieht dem Wirtschaftskreislauf produktives Kapital. …
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-eine-vermoegensteuer-ist-aus-oekonomischer-sicht-die-duemmste-aller-steuerideen/27382546.html
Gerhard Schwarz: Mit der Geldpolitik die Welt retten? Die Überforderung der Notenbanken wird immer weiter getrieben – Neue Zürcher Zeitung, 29.6.2021
Mit einer einzelnen Massnahme kann man nicht zwei Ziele gleichzeitig erfüllen. Diese einfache Regel wird in der Geldpolitik zusehends ausser Acht gelassen. So werden immer mehr Aufgaben an die Währungshüter herangetragen.
Ökonomische Erkenntnisse haben es in der Politik schwer. Eine einfache und einleuchtende lautet, dass es nicht sinnvoll ist, mit einem wirtschaftspolitischen Instrument gleichzeitig mehrere Ziele zu verfolgen. Der Niederländer Jan Tinbergen, der 1969 (zusammen mit Ragnar Frisch) als Erster den damals neu geschaffenen Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, hat nachgewiesen, dass dies in der Regel entweder gar nicht oder nur unter Hinnahme sehr hoher Wohlstandseinbussen gelingt. Trotzdem hält sich die Vorstellung hartnäckig, man müsse, dem tapferen Schneiderlein gleich, mit einem Instrument mehrere Fliegen auf einen Streich erledigen können.
*** Klare Arbeitsteilung nötig ***
Besonders der wirkungsmächtigste Bereich der Wirtschaftspolitik, die Geldpolitik, steht diesbezüglich seit je unter Druck. So verpflichtet das Statut sowohl die amerikanische Notenbank als auch die Bank of England dazu, nicht nur die Preisstabilität anzustreben, sondern genauso auch die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das führt immer wieder dazu, dass diese Zentralbanken eine zu lockere Geldpolitik betreiben und die Preisstabilität aufs Spiel setzen, um die Konjunktur zu beleben. Die Tinbergen-Regel verlangte eine klare Arbeitsteilung zwischen Geldpolitik (Preisstabilität) und Finanzpolitik (Konjunkturbelebung).
Vor allem unter dem Einfluss der Klimabewegung droht die Überforderung der Geldpolitik nun weiter getrieben zu werden. Alle Zentralbanken stehen unter dem Druck, einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. In der EZB scheinen Kräfte, die dies für richtig halten und Tinbergen nie gelesen haben, die Oberhand zu haben. Und damit nicht genug. Wer die Notenbanken für die Erreichung eigener politischer Ziele missbrauchen möchte, hätte am liebsten, wenn sie nicht nur keine Anlagen in Firmen mit schlechtem Umweltausweis tätigten, sondern auch keine in Firmen, die Waffen produzieren, niedrige Löhne zahlen, ihre Steuerzahlungen optimieren oder nicht genügend Diversität aufweisen.
*** Fast alles kann inflationär sein ***
Damit soll nicht gesagt sein, dass die Klimapolitik und weitere Anliegen unwichtig sind. Es soll auch nicht gesagt sein, dass die Notenbanken offensichtlich und massiv gegen ethische Normen verstossende Unternehmen nicht von ihrer Anlagepolitik ausschliessen sollten. Aber man sollte sich der Grenzen bewusst sein und nicht «noch kurz die Welt retten» wollen, wie es in einem Lied des deutschen Songwriters Tim Bendzko heisst. Das ist schlicht nicht die Aufgabe der Währungshüter und stellt eine klare Überforderung dar.
Als Rechtfertigung für eine grüne Geldpolitik werden oft allfällige inflationäre Folgen der Klimaveränderung und der Klimapolitik genannt. Doch fast alles, was in der Welt geschieht, kann inflationär sein. Für Deutschland schätzt man, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zehn Jahren wegen Klimapolitik und CO2-Abgabe jährlich um zusätzliche 0,5 Prozent steigen werden. Nur ist es nicht Aufgabe der Notenbanken, die Entstehung der Inflation an der Wurzel zu bekämpfen oder die relativen Preise zu beeinflussen. Vernünftigerweise lautet ihr Auftrag nur, mit der Steuerung der Geldmenge den allgemeinen Preisauftrieb klein zu halten. Das ist wichtig und schwierig genug.
GERHARD SCHWARZ war Leiter der NZZ-Wirtschaftsredaktion und ist heute Präsident der Progress Foundation.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/wirtschaft/mit-der-geldpolitik-kann-man-nicht-die-welt-retten-ld.1632387
Karl Leban: Das Dilemma der Notenbanker – Mit der Konjunktur geht es wieder aufwärts, die Inflation zieht an. EZB und Fed jedoch bleiben auf Kurs – Wiener Zeitung, 28.6.2021
Neben den massiven Staatshilfen hat die expansive Geldpolitik der Zentralbanken dafür gesorgt, die in der Corona-Pandemie tief abgestürzte Wirtschaft aufzufangen und wieder in die Gänge zu bringen. Dabei gab es zum einen in großem Stil orchestrierte Anleihenkäufe, über die Liquidität in Billionenhöhe in die Märkte gepumpt wurde. Zum anderen schuf eine Nullzinspolitik die Voraussetzungen für günstige Kredite, die den privaten Konsum und die Investitionstätigkeit der Wirtschaftsbetriebe ankurbeln sollen. Nach wie vor hat dieser Kurs für Notenbanken wie die EZB in Europa und die Fed in den USA Gültigkeit. Doch wie lange noch? Die Inflation zieht mittlerweile kräftig an, gleichzeitig haben die Erwartungen für die Konjunktur bereits ihren Höhepunkt überschritten. Wie ist daher die zukünftige Geldpolitik von EZB und Fed einzuschätzen? Die „Wiener Zeitung“ hat dazu Experten befragt.
Peter Brezinschek, Chefökonom der Raiffeisen Bank International (RBI), weist darauf hin, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde zwar bei jeder Gelegenheit betone, dass die Europäische Zentralbank noch lange Zeit habe, ihren geldpolitischen Kurs zu ändern. Wie er zu bedenken gibt, sei inzwischen jedoch eine Überarbeitung der EZB-Strategie im Gang, bei der es darum gehe, wie die Notenbank ihr Mandat der Preisstabilität künftig definiere. Dies gilt als sehr wichtiger Punkt für die weitere Richtung ihrer Geldpolitik.
„Einige Vertreter einer expansiven Geldpolitik treten für ein symmetrisches Preisziel von plus 2 Prozent ein – nach dem Vorbild der US-Notenbank Fed“, erklärt Brezinschek weiter. „Damit könnte die Geldpolitik selbst bei längerem Übersteigen der 2-Prozent-Marke großzügig angelegt werden, um Unterschreitungen der Vergangenheit auszugleichen.“ Vertreter einer strikteren Geldpolitik dürften diesem Ansinnen jedoch kritisch gegenüberstehen, meint Brezinschek. „Im Herbst wird sich zeigen, wer sich durchgesetzt hat, oder ob es einen Kompromiss gibt.“
*** „Ein paar Jahre Inflation, und alles ist wieder im Lot“ ***
Karl Freidl, Chef des Vermögens- und Fondsmanagements der Steiermärkischen Sparkasse, rechnet damit, dass die EZB erst dann ihren geldpolitischen Kurs ändern wird, wenn die Inflation längere Zeit – zwei bis drei Jahre – auf hohem Niveau verharrt. „Die Werthaltigkeit der Staatsschulden sinkt ja dadurch“, sagt der Grazer Experte. „Auch die Schuldenrelation (zum Bruttoinlandsprodukt, Anm.) – ein paar Jahre Inflation bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum, und alles ist wieder im Lot.“ Dass die Werthaltigkeit der Sparguthaben sinke, sei dabei „eine nicht ungewollte Nebenerscheinung der Notenbankpolitik“, wie Freidl betont. „Das Vermögen der privaten Haushalte soll nicht gehortet, sondern in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden.“
Indes geht Brezinschek davon aus, dass der globale Aufschwung – auch im Euroraum – zumindest bis 2023 anhält und sich der Auftrieb der Teuerung nach dem heurigen Preisschub in den darauffolgenden zwei Jahren wieder beruhigt (auch wenn er über dem Niveau der Vor-Corona-Periode liegen dürfte). Das damit verbundene kräftige nominelle Wachstum sollte vor allem die Steuereinnahmen sprudeln lassen und die Budgetdefizite spürbar reduzieren. „Da der aktuelle Schuldenstand schon mit festen Zinsen – zu einem immer größeren Teil sogar mit negativen Nominalzinsen – ausgestattet ist, hätte die EZB sehr wohl die Möglichkeit zu Zinsanpassungen“, meint Brezinschek. Denn nur die Neuverschuldung werde zum aktuellen Zinsniveau auf den Markt gebracht. „Da die Leitzinsen die Kapitalmarktzinsen nur indirekt beeinflussen“, ist das Instrument der Anleihenkäufe nach Einschätzung des Raiffeisen-Analysten „wirkungsvoller, die gesamte Renditekurve für Staatsanleihen zu senken“. Zur Illustration: Italien und selbst Griechenland zahlten mit je 0,9 Prozent weniger für ihre Staatsschuld als die USA. „Insofern wird es diese Anleihekauf-Programme noch länger geben“, ist Brezinschek überzeugt. „Die EZB fühlt sich offensichtlich verpflichtet, die Eurostaaten geldpolitisch in ihrer Fiskalpolitik zu unterstützen.“
*** Zinsen bleiben wohl noch länger extrem niedrig ***
Laut Freidl nimmt die EZB bei ihren Käufen mindestens 30 Prozent aller neu ausgegebenen Staatsanleihen in ihre Bücher. „Ein Staat verschuldet sich in Form von Anleihen, und die Zentralbank kauft diese Schulden gleich auf. Die Zinsen dafür zahlt der Staat dann wieder zum entsprechenden Anteil an die EZB, die ihren erwirtschafteten Gewinn wieder an den Staat abführt“, erläutert der Fondsmanager das Prinzip.
Was die Zinsen im Euroraum betrifft, „dürfte uns noch länger ein extrem niedriges Niveau erhalten bleiben“, glaubt Brezinschek. „Ob die EZB allerdings wirklich negative Nominalzinsen beim Einlagensatz benötigt, wenn sich die Wirtschaft erholt, ist äußerst fragwürdig.“ Selbst der frühere EZB-Chef Mario Draghi habe sie bei Einführung 2014 nur als Kriseninstrument begründet. „Davon entfernen wir uns wieder, weshalb künftig die schrittweise Heranführung des Einlagensatzes von derzeit minus 0,5 Prozent an die Nulllinie gerechtfertigt wäre“, sagt Brezinschek. Für den Sparer hätte das freilich kaum Auswirkungen, mit etwas höheren Inflationsraten wären die Realzinsen am Geldmarkt immer noch deutlich negativ. „In den nächsten Jahren bleibt den Sparern somit der Jubel verwehrt“, so Brezinschek.
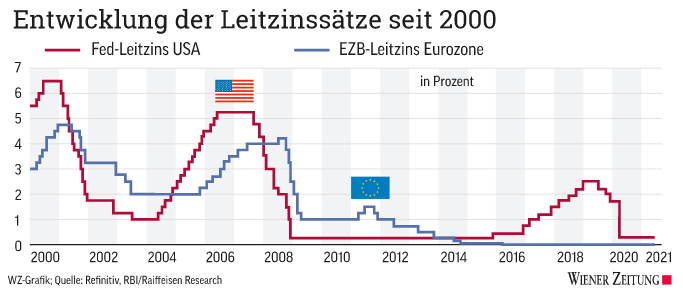
Ähnlich argumentiert auch Freidl: „Wir können kein Szenario erkennen, wo Sparer wieder jubeln können. Bisherige Aussagen der EZB waren glasklar und ohne jegliche Hoffnung für Sparer.“ Freidls Fazit: „Wo immer die Leitzinsen irgendwann einmal auch stehen werden, die Inflation wird weit höher sein.“
*** Ton in Richtung Zinserhöhung könnte sich in USA verschärfen ***
„Schon etwas ausgeprägter“ stellt sich für Brezinschek die Lage in den USA dar. Stiegen die Konsumentenpreise in Europa im Mai um 2,0 Prozent, so schossen sie in den USA um 5 Prozent hoch. Auch das Wirtschaftswachstum werde heuer mit mehr als 6 Prozent markant über der Eurozone liegen. „Da die US-Notenbank neben ihrem 2-Prozent-Inflationsziel auch einen vollbeschäftigten Arbeitsmarkt im Mandat hat, setzt ihr Chef, Jerome Powell, wie die EZB vorerst auf Zuwarten“, erklärt Brezinschek. Auch die Einschätzung, dass der Preisanstieg nur vorübergehend sei, würden sich Fed und EZB teilen. „Doch aufgrund der größeren Preis- und Wirtschaftsdynamik scheinen die US-Notenbanker einem Ausstieg aus den Anleihenkäufen ab 2022 und einem Zinsanhebungsprozess ab 2023 zugeneigt.“ Die EZB gebe dafür jedenfalls noch keine Signale, so Brezinschek. „Erst nach der Veröffentlichung der neuen Geldpolitik-Strategie sind Hinweise zu erwarten.“
Aus Freidls Sicht haben die USA ebenfalls „absolut kein Interesse an hohen Zinsen“. Aber auch hier seien die von der Fed gesteuerten Zinsen die eine Seite, Anleihenkäufe und Konjunkturprogramme „unfassbaren Ausmaßes“ die andere. „Die Fed wird dabei eher aufpassen müssen, dass die Inflation kurzfristig nicht wirklich völlig aus dem Ruder läuft, und steuert bereits – zumindest verbal – dagegen“, analysiert Freidl. Er ist denn auch überzeugt: „Sollten die Inflationszahlen im laufenden Jahr noch weiter steigen, wird sich der Ton in Richtung Zinserhöhung verschärfen.“ Bisher habe die Fed „noch ganz gut mit ihren neuen Zielen argumentieren können“. Das Inflationsziel wurde von maximal 2 Prozent auf durchschnittlich 2 Prozent angepasst. „Aber auch da kann man nicht ewig zusehen, wenn die Inflation weiter nach oben klettert“, gibt Freidl zu bedenken.
*** Gefahren für Rückschlag an den Börsen nehmen zu ***
Die jüngsten Inflationsschübe in den USA und Europa haben die Gefahr eines Rückschlags an den boomenden Aktienbörsen unterdessen deutlich erhöht. Mit einem Crash rechnet Freidl zwar nicht, aber mit einer Korrektur (das sind Kursrückgänge um circa 10 Prozent): „Mit Sicherheit sehen wir früher oder später eine Korrektur.“ Zeitpunkt, Vehemenz und Dauer seien aber unmöglich vorherzusagen. Für Aktien bleibt er dennoch optimistisch: „Es wartet so viel Geld auf der Seitenlinie, dass diese Korrekturen nur von kurzer Dauer sein werden.“
Auch Brezinschek ist für Aktien weiterhin zuversichtlich. Als Sachanlage seien sie neben Immobilien „ganz klar die Favoriten für eine längere wirtschaftliche Erholungsphase mit leicht höheren Preissteigerungsraten im Vergleich zu Vor-Covid-Zeiten“. Die Bewertungen vieler Aktien seien zwar bereits hoch, und die Rückschlagsgefahren nähmen zu – vor allem, wenn früher als erwartete Zinserhöhungen angekündigt würden. Aber wie bei der Inflation wäre ein Rückschlag nur ein temporärer Effekt, so Brezinschek. Auch wenn er für Aktien mit deutlich niedrigeren Wertsteigerungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren rechnet: „Für einen langfristigen Vermögensaufbau wird man an Aktien nicht vorbeikommen, um die Inflationsrate zu schlagen.“
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110384-Das-Dilemma-der-Notenbanker.html.