Views: 129
UPDATE 29.6.2021: Korrektur vieler kleiner Schreibfehler sowie einer falschen Angabe: „Abschwächung des Konjunkturbooms erst 2021 => richtig: 2023“ *** ergänzt: „Todesopfer in Tschechien Bis zu 400 km/h: Heftiger Tornado zerstört mehrere Orte – n-tv, 25.6.2021“, „Vertreibung von Menschen infolge des Klimawandels wird unterschätzt – Science-APA, 18.6.2021“, „Ungewisse Zukunft: Wie geht es mit den jungen Flüchtlingen von Ceuta weiter? – n-tv, 27.6.2021“, „Ruhestätte für angespülte Leichen: Neuer Friedhof für Geflüchtete füllt sich schnell – n-tv, 27.6.2021“; „SwissRe-Chefökonom Haegeli: „Klimapolitik ist Wirtschaftspolitik! – Haegeli pessimistisch, ob Politik rasch genug wirkt – n-tv, 18.6.2021“ *** eingefügte Meldungsteile zum Michigan-Index
Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie letzte Woche ebenso – summa summarum nur zu vermerken, …
Ach nein: hier folgt doch etwas Neues an Einsichten für die eiligen Zeitgenossen: Es jubeln die Geigen, die Stimmung ist geradezu himmelhoch jauchzend, sowohl was die Wirtschaftsprognosen als auch die Börsenstimmung betrifft. Na also, lasst uns denn sorglos zu neuen Höhen schreiten.
Noch relativ wenig Aufmerksamkeit erregt die steigende Inflation. Nur da und dort keimt Unsicherheit auf. Die wird durch forcierte Wertpapierkäufe und muntere Wirtschaftsprognosen hinweggefegt.
Nichtsdestotrotz: die geldpolitische Straffungsrhetorik wird salonfähig, meint die bekannte liechtensteinsche Bank LGT. Andere sehen gar eine Stagflation heraufdämmern.
Auch die Lieferkettenprobleme sind etwas, das nicht gerade im Fokus der jubilierenden Beobachter liegt: Obstruktion im Container-Schiffverkehr? Was kümmert’s uns.
Und überhaupt: Was kümmert uns der Klimawandel? Das dürften sich andere fragen, insbesondere die weltweite Tourismus-Industrie, die sich seit Jahrzehnten in eine unangenehme Position hineingesteigert hat: dem Anschein nach nötig für nationale Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte, aber Klimawandel und Pandemiegefahren befeuernd. Wie kommt man da heraus? Doch halt: sollen in den tief eingeschnittenen, sonnenarmen Tiroler Tälern Kinder wieder zu Schwabenkindern werden?
Massentourismus und Konsum auf Teufel komm raus sind keine Allheilmittel darbender Volkswirtschaften: lasst Keynes ruhen! Liegt da nicht eine jahrzehntelange falsche Auffassung der europäischen Sozialdemokratie von den Lehren des Vermögensverwalters und Aktienspekulanten Keynes vor? Mit welchen Konsequenzen? Was wurde da schuldenbasiert von Jahr zu Jahr gehebelt? BIP auf Pump? Aber das ist nur ein Aspekt, Arbeitsmärkte – und damit Menschen und ihre Existenzen – ein anderer.
Konsumbewusstheit als einziges Mittel? Konsum einsparen? Aber geh‘: heute rot, morgen tot, das ist die Devise. Eine Kriegsdevise, ehemals, als die Landser plündernd, brandschatzend und vergewaltigend durch die Lande zogen.
IN DEN VORDERGRUND schoben sich abermals geradezu euphorische Wirtschaftsprognosen für die USA, die Eurozone und Deutschland sowie reichlich Nachrichten zu den diversen Zentralbanken – Zeichen, das diese unter stärkerer Beobachtung der Öffentlichkeit stehen und selbst um Neustrukturierungen ringen.
IN DEN HINTERGRUND – so scheint es – geraten derzeit [!] Meldungen zum Thema Vermögen. Nicht ganz: Neid und Missgunst bleiben immer ein Thema, wenn es schon nicht gerade Ungleichheit ist.
SEHR BEACHTENSWERT AUCH Studien zum Klimawandel von geradezu apokalyptischem Charakter.
ÜBERSICHT
- FUTUROLOGIE
- IPCC: Erde steuert auf eine Erderwärmung um drei Grad zu, aber „Irreversible Folgen“ schon bei Erderwärmung von über 1,5 Grad vorhanden – Krisenszenarien: Hungerrisiko für 80 Mio Menschen, Ernterückgänge, Trinkwassermangel, Überflutung von Küstenstädten, Massenflucht, fortschreitendes Artensterben – Europa auch betroffen: Bevölkerungszuwachs auf das Dreifache, Malaria, Dengue-Fieber, Zika werden heimisch – Veröffentlichung des IPCC-Berichts erst Februar 2022
- Studie: Weltweiter CO2-Preis könnte fast 40 Prozent CO2 einsparen – Klimaclub optimal: überregionale und globale Initiativen besser als europäischer Alleingang – Preiserhöhung und Importzölle im europäischen Alleingang für Europa emissionssenkend, aber ohne genügende Verbesserung des gobalen Klimas – Klimaclub ernötigt geringe gesamtwirtschaftliche Kosten von 0,5 Prozent des BIP für alle Staaten
- McKinsey-Vorschläge zur Zukunftsbewältigung: Deutschland könnte Wachstum bis 2030 verdoppeln dank mutiger Schritte und „kreativer Erneuerung“ – Nach 20 Jahren Erfolgsgeschichte: „Disruptive, radikal neue Lösungen sowie Technologiekompetenz“ erforderlich – Wandel einleiten durch Upgraden des „Betriebssystems“: in Industrieunternehmen, Mittelstand und Gründungsszene beschleunigte Verlagerung von Ressourcen auf Zukunftsthemen nötig
INTERNATIONAL - Zwischen den Big Five der USA und den Big Three Chinas: Wie sieht künftig eine digitale demokratische Gesellschaft aus? – Der Machtkampf zwischen Washington und dem Silicon Valley geht in die heiße Phase
- Starke Preisanstiege bei Lebensmitteln auf globalen Märkten: „Wir müssen das Spiel des Marktes erlauben“ – Politische Interventionen wirken kontraproduktiv – Sinnvoll und nötig: Lokale Hilfen für jene Bevölkerungsanteile, die unter Preisanstiegen leiden
- CPB: Welthandelsvolumen steigt im April um 0,5 Prozent – Deutsche Eportwirtschaft profitiert: China und Japan mit Exportwachstum von rund 4 Prozent, Euroraum und USA stagnieren, asiatische Industrieländer und Lateinamerika mit Exporteinbußen von rund 4 Prozent
- Kiel Trade Indicator 06/2021: Stau von Containerschiffen nimmt zu, Welthandel aber intakt
- Welthandel wird gestört: Containerschiffe stauen sich in China – Vor allem Containerhafen Yantian betroffen – Weltgrößte Container-Reederei Maersk signalisiert baldige Entspannung – Umleitungen in andere Häfen verursachen steigende Wartezeiten dort
- Corona bremst Wachstum der Pillendreher – Trotz Schrumpfung der Weltwirtschaft um minus 3,5 Prozent: Umsatz der 21 größten Pharmakonzerne kletterte 2020 um 4,4 Prozent – US-Medikamenteerzeuger als Umsatzkaiser – Kein Krisengewinner wegen deutlich höherer F&E-Ausgaben um 9,2 Prozent (2019: 9,7 Prozent)
- Merkel sieht internationalen „Epochenwechsel“ Pandemie hat aufgemischt: Schub für Innovationen und Digitalisierung – Autokratische Systeme haben Vorsprung vor offenen Demokratien – USA packt neue Situation „mit Wucht“ an, Chinas BIP überrumpelt andere Staaten: Europa vielfach nicht führend, z.B. bei Quantencomputing, Chips oder Batterieforschg – International bedrohliche Machtverschiebungen: Änderungen nötig angesichts von Völkerrechts- und Regelbrüchen durch bedeutende Staaten sowie weiltweit aufgtauchter populistischer Strömungen
BÖRSEN - SENTIX-Sentiment: Bären verlieren die Geduld – Es braut sich was zusammen: stärkerer Volatilität in kommenden Wochen – Risikoreiches Rohöl: Overconfidence Index gibt erstes Warnsignal – Aktien: Super-Neutrality mit neuem Allzeithoch – Edelmetalle haben gute Karten
- S&P 500 schafft weiteres Rekordhoch
- Investmentbanking Das Fusionsgeschäft boomt – nur nicht in Deutschland
Global ist der M&A-Markt auf Rekordkurs. Doch hierzulande stockt das Fusionsgeschäft. Experten sehen - Der Chart des Tages – Aktien und Anleihen: Mehr Korrelation heisst weniger Diversifikation
- COMMENT: Eingeweihte wissen, warum die drei vorangegangenen Meldungen in der Rubrik BÖRSEN die SENTIX-Meldung ergänzen
- Der Chart des Tages – FED provoziert Beginn der Zinsspekulation: Wahrscheinlichkeit eines Zinsanstiegs bis Ende 2022 und sein Ausmaß – Reaktion auf dem US-Anleihemarkt
verschiedene Gründe – und erwarten eine rasante Aufholjagd zum Jahresende - Negativzinsen sind positiv – zumindest aus verhaltensökonomischer Sicht: Interesse an Aktienerwerb wurde geweckt
ZENTRALBANKEN
– USA / FED - Das vergessene andere Ende der Zinskurve: US-Notenbank bereitet geldpolitischen Kurswechsel vor – Im Blick: Anleihenkäufe und niedriger Leitzins – Bedeutung für Investoren: auf die Zinskurve achten – Zinskurve: am kurzen Ende herrschte lange Zeit Totenstille, wie lange noch?
- Fed wird an der Zinsfront Ruhe bewahren – Trotz des Inflationsschub spricht sich US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress dagegen aus, die Zinsen präventiv zu erhöhen
- Fed-Chef sieht deutliche Erholung: Konjunktur und Arbeitsmarkt im deutlichen Aufwind – Inflationsanstieg nur vorübergehend – Besorgnis über Niedriglohnsektor: Afroamerikaner und Hispanics arbeitsmarktlich am stärksten von Pandemie getroffen – Künftige Pandemie-Risiken nicht ausgeschlossen: FED wird weiter stützen – Reaktion auf Zinswenden-Andeutung: Rendite am sekundären Anleihemarkt steigt auf 1,5 Prozent
- Alle 23 US-Großbanken schneiden im Stresstest gut ab – Beschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe wieder aufgehoben – Deutsche Bank glänzt mit höchster Kapitalquote unter den getesteten Banken – Im Stresstest Mindestanforderungen ums Doppelte übertroffen: Kapitalquote sinkt unter Extrembedingungen auf maximal knapp 11 Prozent – Nach Dividenden-Stopp: hohe Auszahlungen für Aktionäre 2022 erwartet
– GROSSBRITANNIEN / BoE - Bank of England bestätigt Leitzins und Kaufprogramm – Beobachter rechnen mit Leitzinserhöhung erst in zweiter Jahreshälfte 2023
– SCHWEIZ / SNB - Eine Umfrage der Nationalbank zeigt: Das Bargeld verliert in der Schweiz markant an Bedeutung
– EUROPÄISCHE UNION / EZB - BIZ befürwortet kontenbasiertes digitales Zentralbankgeld – Gründe, die für Digitalgeld sprechen: immer häufigere digitale Abwicklung des Zahlungsverkehrs (über Handy, PC, Karte), private Anbieter wollen eigene Währungen (Stable Coins) herausbringen, große Tech-Firmen wie Google steigen in Zahlungsdienste und Finanzdienstleistungen ein, Öffentlichkeit ist mit Blick auf Bitcoin-Verwerfungen für das Thema sensibilisiert – Sechs technische Eckpunkte
- EZB: Globalisierung beeinflusst strukturelle Inflation kaum – Ursachen des Inflationsrückgangs (Disinflation): (1) Beginn vor Jahrzehnten in Zeiten schwach ausgeprägter Globalisierung, (2) gegenläufige Inflationsausprägungen in einzelnen Wirtschaftssektoren, (3) Globalisierung allein als Ursache zu schwach – Globalisierungsminderung oder Renationalisierung dürfte kaum disinflationär wirken – Niedrigzinspolitik kann strukturelle Fakoren auf Inflation nicht mehr neutralisieren
- Lagarde vor dem Europaparlament: EZB darf zur Mandatserfüllung von Marktneutralität abweichen
- Gültig ab 26. Juni 2021: EZB übernimmt Aufsicht über systemisch wichtige Investmentfirmen – diese Investmentfirmen sind noch nicht bekannt, aber jedenfalls hohem Kredit- und Marktrisiko ausgesetzt – Systemrelevante Wertpapierfirmen sind solche, die Handel auf eigene Rechnung betreiben, Wertpapiere zu fixen Konditionen platzieren, eine konsolidierte Bilanzsumme von über 30 Milliarden Euro aufweisen – EU-Gesetzgebung umfasst Wertpapierfirmen-Richtlinie zwecks mittelbarer nationaler Umsetzung und Wertpapierfirmen-Verordnung, die unmittelbar gilt
- EZB/Lagarde fordert EU auf, Stabilitäts- und Wachstumspakt rechtzeitig reformieren – Modernisierung nötig: reformiertes Rahmenwerk soll nach Ende der Aussetzung der EU-Defizit-Regeln 2022 greifen – Grund dafür ist der geänderte makroökonomische Kontext seit dem Start der Wirtschafts – und Währungsunion – Mehr Antizyklizität: Neue Regelungen für eine antizyklische und nachhaltige Fiskalpolitik erforderlich – Geldpolitik wurde Stabilisierung aufgebürdet, da bisherige Haushaltsregelung der Staaten insbesondere prozyklisch wirkte
- Definition und Messung von Preisstabilität, der zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation
- EZB/Lagarde: Diskutieren gemeinsame Folgen einzelner Strategiepunkte für die Geldpolitik – Treffen des EZB-Rats behandelte Preisstabilität, mittelfristige geldpolitische Ausrichtung und die Rolle des Klimawandels dabei sowie die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation
- EZB / Euroraum: Unternehmenskredite wachsen im Mai erneut schwächer – Nach 5,3 Prozent im März und 3,2 Prozent im April nun 1,9 Prozent mehr an Buchkrediten – Kreditvergabe insgesamt wuchs mit 6,7 Prozent, das Kreditvolumen an Privathaushalte mit 3,9 Prozent p.a., jenes an die öffentliche Hand mit 15,4 Prozent – Geldmenge M3 wächst mit einer Jahresrate im Mai von 8,4 Prozent und einer Drei-Monats-Rate von 9,2 Prozent
- EZB: NPL-Volumen sinkt 2020 weiter – 37,5% mehr „Evergreening“: Kreditstundungen und Kreditstreckungen nehmen zu – Deutschland, Niederlande, Frankreich und Spanien gewähren die meisten Erleichterungen – Italien, Griechenland und Portugal mit großen Fortschritten beim NPL-Abbau – Deutschland mit niedrigster NPL-Quote – EZB erwartet NPL-Anstieg wegen Pandemie in ungewisser Höhe
- Noch viel Arbeit bei Etablierung von Bankeinlagensicherung – Restierende Sorgen trotz großer Erfolge bei der Risikoreduzierung in der Vergangenheit – Richtiges Tempo beim Übergang vom nationalen zum europäischen Sicherungssystem finden
- Bankenpräsident rechnet zum Abschied mit EZB ab: „Es ist mir auch nach intensiven Kämpfen mit Herrn Draghi nicht gelungen, die EZB davon zu überzeugen, wie Negativzinsen den Banken schaden“ – Geld fehlt für nötige Neustrukturierungen: Negativzins-Zahlungen der europäischen Banken belasten massiv Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den US-Banken – DJN, 26.6.2021
USA - Defizit in der US-Leistungsbilanz im ersten Quartal geringer angestiegen als erwartet
- USA: Konsumklima der Uni Michigan hellt sich im Juni wieder auf und erreicht 85,5 Zähler – Künftiges Kaufverhalten: Konsumenten sehen aktuelle Lage pessimistischer, die Zukunft aber deutlich optimistischer – Kurz- und Langfrist-Inflationserwartungen gesunken
- Konsum der US-Haushalte stagniert im Mai – Weniger größere Ausgaben, mehr für Dienstleistungen – Einkommensrückgang von minus 2 Prozent – Deflator für persönliche Konsumausgaben steigt annualisiert um 3,9 Prozent, ohne die Komponenten Nahrung und Energie um 3,4 Prozent p.a.
- US-Wirtschaft wächst gering stärker als der historische Wachstumstrend: Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Mai auf über Null – April-Stand war knapp unter Null
- Markit: US-Wirtschaft verliert im Juni an Schwung – Sammelindex für Produktion in der Privatwirtschaft fiel auf 63,9 Punkte (Mai: 68,7)
- Kräftige Erholung der US-Wirtschaft: Wachstumsrate für erstes Quartal mit Plus von annualisiert 6,4 Prozent bestätigt – Deflator für persönliche Konsumausgaben (PCE) steigt um annualisiert 3,7 Prozent, der BIP-Deflator geringer als erwartet um 4 Prozent
- US-Aufträge für langlebige Güter steigen im Mai solide um 2,3 Prozent, solche für Investitionsgüter ohne Flugzeuge sanken um minus 0,1 Prozent – Ordereingang ohne Transportbereich mit Plus von 0,3 Prozent, außerhalb des Rüstungsbereiches mit Plus von 1,7 Prozent
- US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken – Benzinlager leeren sich – Gering gewachsene Ölproduktion im Jahresvergleich
- Zweiter Rückgang in Folge: Neubauverkäufe geben weiter stark nach: minus 5,8 Prozent – Revidierter Rückgang im April bei minus 7,8 Prozent (zuvor: 5,9)
- Preise bestehender Häuser in den USA erreichen im Mai Rekordhoch – Plus von 24 Prozent innerhalb eines Jahres: Medianpreis erreicht erstmals 350.000 USD – Nach Rückgang im Vorjahr: Anstieg der Hausverkäufe auf Jahressicht um 45 Prozent – Vierter Rückgang im Monatsvergleich
- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich über Vorkrisen-Niveau, sinken nur leicht um 7.000 auf 411.000 Anträge (Vorkrisenniveau: 200.000 je Woche) – Vorwochenwert auf 418.000 Erstanträge hinaufrevidiert – Anzahl der Empfänger der Arbeitslosenunterstützung sinkt auf 3.4 Mio Personen
EUROPA - Der Chart des Tages – Europa dreht auf: Unternehmen revidieren Gewinne weit häufiger nach oben als weltweit üblich – Einkaufsmanagerindizes signalisieren Optimismus für die Zukunft
RUSSLAND – DEUTSCHLAND - Stimmung bei deutschen Firmen in Russland besser als seit Jahren – Nahezu alle Unternehmen zufrieden mit Geschäftsgang – Unternehmen erwarten russischen Post-Corona-Boom, stellen mehr Mitarbeiter*innen ein und investieren wieder – Sanktionen gegen Russland in der Krtitik – Klares Ja zu Nord Stream 2: Gasleitung zwecks Energieversorgung Deutschlands nötig – Nord Stream 2 als Brückentechnologie auf dem Weg zur Energiewende
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Wirtschaft in Eurozone boomt: Die Wirtschaft der Eurozone profitiert von den Lockerungen der Coronamassnahmen und erlebt einen Boom wie schon seit 2006 nicht mehr
- Markit: Stärkstes Wachstum im Euroraum seit 15 Jahren
- ING: Phase erhöhter Inflation könnte etwas länger dauern – Beeinflussung der Verbraucherpreise erst in sechs Monaten: Erzeugerpreise steigen teils zweistellig – Verzögerter Inflationsanstieg, aber nicht von Dauer – Jahresendhoffnung: Kreditverknappung in China senkt Druck auf Rohstoffpreise – EZB: nur kräftige Lohnsteigerungen wirken inflationstreibend – Trotz Arbeitskräftenachfrage: Kurzarbeit-Rückkehrer in den Arbeitsmarkt halten Löhne stabil
- Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich auf
- Finanzstabilität sichern: EU-Behörden fordern Marktteilnehmer zu aktiver Abkehr vom Libor auf – 35 Libor-Sätze spätestens ab 31. Dezember 2021 nicht mehr für neue Geschäfte nutzen
FRANKREICH - Frankreich: Geschäftsklima steigt auf 14-Jahreshoch – Günstige Corona-Lage weckt Hoffnungen: starke Stimmungsaufhellung im vor allem Einzelhandel und bei Dienstleistern
BELGIEN - Belgiens Geschäftsklima erklimmt im Juni Rekordhoch seit 1980 – Fast alle Wirtschaftssektoren optimistisch – Nach fünf Anstiegen in Folge: Bauhauptgewerbe mit gering gesunkener Zuversicht
DEUTSCHLAND - Lockdown-Folgen verblassen: GfK-Konsumklima verzeichnet höchsten Wert seit August 2020 auf minus 0,3 – Verbesserung im Juli kräftiger als erwartet – Anschaffungsneigung mäßig, aber Einkommens- und vor allem Konjunkturerwartung verblüffend gut
- Ifo-Exporterwartungen der Industrie auf höchstem Stand seit Januar 2011 – Nachholeffekte treiben fast alle Branchen, nur Bekleidungshersteller sind pessimistisch
- Deutschland schüttelt Coronakrise ab: Ifo-Geschäftsklima steigt mit 101,8 Punkten auf höchsten Stand seit November 2018 – Analystenerwartungen wurden übertroffen: Geschäftserwartungen und Lagebeurteilungen jeweils deutlich aufgehellt – Insbesondere Dienstleister und Handel, speziell Einzelhandel optimistischer – Materialmangel als großes Problem: Bauhauptgewerbe bleibt pessimistisch, wenn auch weniger als im Vormonat
- Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im April kräftig auf höchsten jemals erhobenen Wert für April – Anstieg im April um fast 10 Prozent saison- und kalenderbereinigt, auf Jahressicht 4,1 Prozent – Aufträge wachsen im ersten Jahresdrittel gegenüber dem des Vorjahres um 1,2 Prozent – Auftragswert beträgt 8 Mrd Euro oder nominal 7 Prozent mehr als im April 2020
- IMK: Wirtschaft kommt mit Schwung aus der Corona-Krise: BIP-Zunahme 2021e um 4,5 und 2022e um 4,9 Prozent – Lieferengpässe verschieben Aufschwung zeitlich geringfügig in die Zukunft verschoben – Treibende Kräfte 2021: dynamischer Außenhandel, Ausrüstingsinvestitionen und zunehmender Privatkonsum – Arbeitslosigkeit geht zurück in 2021e auf 5,8 und in 2022e auf 5,3 Prozent – Jahresinflation: 2021e 2,5 und 2022e 1,7 Prozent – „Unbestritten tragfähige Verschuldung“: Budgetdefizit geht von 4,3 Prozent auf in 2022e auf 1,7 Prozent zurück – Fiskalhilfen noch aufrechterhalten: Schulden mindern nicht nur Pandemiefolgen, sondern lösen jahrelang aufgelaufenen Investitionsstau auf
- Bundesbank: Erspartes treibt Wachstum an – Auf Corona-Flaute folgt Corona-Boom – Abschwächung des Konjunkturbooms erst 2023 – Langfristig Rückkehr der Sparquote auf 10 Prozent erwartet
- Deutschland: Renten dürften im kommenden Jahr wieder steigen – Beitragseinnahmen der Rentenversicherung stiegen im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent – Beitragssatz bleibt bis 2022 konstant – Maximaler Beitragssatz von 20 Prozent wird auch bis 2025 nicht erreicht – Rentenversicherungspräsidentin spricht von bewährtem Umlagensystem: negative Langfristvoraussagen zur Lage der Pensionsversicherer bislang nicht eingetroffen
- Deutschland: Grundrente nur für Neurentner – Verzögerte Auszahlung: hoher Verwaltungsaufwand und kompliziertes Verfahren lassen Details noch im Dunkeln – 1,3 Mio Menschen profitieren künftig von Grundrente
- Rohstahlproduktion Deutschland im Mai im Vergleich zum April stark gestiegen – Nach Corona-Absturz: anhaltende Zuwächse seit Oktober 2020
- Deutsche Exporte in Drittstaaten sinken im Mai um 3,0 Prozent – Exporte in Drittstaaten 5,8 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020 – Exportwaren-Wert im Mai 48 Mrd Euro: Anstieg um 28 Prozent auf Jahressicht – USA und China als wichtigste Exportländer mit starken basiseffektbedingten Zuwächsen im Jahresvergleich
- Einzelhandel: Pandemie-Profiteure: Oxfam beklagt Unfairness: Supermärkte machen Kassen, Nahrungsmittelerzeuger kämpfen um ihre Existenz – Handel gewinnt: Kaffee- und Teehandel als Beispiele – Arbeiter in Ursprungsländern als Verlierer – Lieferkettengesetz: Oxfam fordert Nachbesserung in Deutschland und Regulierung durch EU
- Corona bremst Innovationen im Mittelstand: angespannte Liquiditätslage und unsicherer Zukunftausblick als Hemmschuhe – KfW-Chefvolkswirtin mahnt: „Wir können es uns nicht leisten, zurückhaltend zu handeln“ – Kontinuierlicher Verlust an Innovationskraft seit 15 Jahren, Finanzierungsschwäche als Ursache – Personalmangel verschärft Innovationsschwäche – Förderungen nötig
- Deutsche Immobilienpreise steigen weiter – Wohnimmobilien steigen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,4 Prozent – Wohnungen in Großstädten über 100.000 Einwohnern im Vorjahresquartalsvergleich um 11,3 Prozent teurer – Nach starkem Anstieg in 2020: Nebenkosten für Immobilienerwerb leicht gesunken – Neuregelung der Aufteilung von Maklerkosten wirkt kostensenkend
- Staatliche Verschuldung Deutschlands: Anleihe-Rekordvolumen am Kapitalmarkt für 2021 vorgesehen
- Steuereinnahmen auch im Mai deutlich über Vorjahr – Relativierung der Frohbotschaft: Basiseffekt „schönt“ Steuereinnahmszuwachs – Erfreulicher Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Aktivität
- Steuerpläne von CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP: Wer profitiert und wer verliert – Vergleichsstudie
- Deutschland: Frauen kommen auf immer mehr Arbeitsjahre bis zur Rente: von 27,7 Jahre im Jahr 2000 auf zuletzt 36,3 Jahre – Vermehrte Erwerbsbeteiligung der Frauen und weniger Möglichkeiten der Frühverrentung als Ursachen
- Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“: Berufliche Aus- und Weiterbildung benötigt Digitale Modernisierung – Raschere digitale Berufsausbildung und langfristiger, finanziell gestützter Pakt für berufsbildende Schulen sinnvoll – Gut und flexibel integriert im Arbeitsalltag: Unternehmen setzten schon jetzt erfolgreich verstärkt E-Learning-Formate ein – Kontraproduktiv wirkt der Ruf nach verstärkter Verrechtlichung der Weiterbildung
- Reichenforscher Rainer Zitelmann: Finanzielle Freiheit ab Vermögen von 10 Millionen Euro – Vor allem Deutsche und Franzosen sind neidisch auf reiche Menschen – Vermögende Personen schwimmen gegen den Strom und sind besonders offen für neue Erfahrungen
ÖSTERREICH - IHS-Prognose für 2021 und 2022 – Pressekonferenz: BIP-Wachstum von 3,4% heuer und 4,5% für 2022e – Weiterhin über Vorkrisenniveau: Arbeitslosenquote dürfte auf 8,4% in diesem und 7,9% im nächsten Jahr zurückgehen
- WIFO-Prognose für 2021 und 2022: Kräftiger Konjunkturaufschwung in Österreich – Schwungvolle Industriekonjunktur: reales BIP-Wachstum von 4% bzw. 5% für 2021 und 2022 erwartet – Schnellerer Aufschwung als bisher erwartet – Erstarken des privaten Konsums – Lebhafterer Investitionsdynamik – Inflationserwartung für 2021 bei 2,3 Prozent – Beschäftigung bereits im Frühjahr auf Vorkrisennieveau – Arbeitslosigkeit 2021e bei 8,5 Prozent, 2022e bei 8 Prozent
- Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex – 23. Kalenderwoche 2021 – BIP-Lücke in der Kalenderwoche 23 (7. bis 13. Juni 2021) um 0,3 Prozentpunkte verringert und damit nahezu geschlossen (–0,1%) – BIP aktuell um 11,8% höher als vor einem Jahr
- Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB für die Kalenderwochen 22 bis 24: BIP Mitte Juni rund 1 % unter Vorkrisenniveau
- Containerfrachtverkehr: Verzögerungen und Preissteigerungen – WIFO Research Brief beleuchtet Bedeutung für den österreichischen Außenhandel
- Milliardärsranking: 100 reichste Österreicher besitzen zehn Prozent des Gesamtvermögens – Die Familien Porsche und Piech verfügen in Österreich über das größte Vermögen. Erstmals sind auch heimische Start-up-Gründer in dem Ranking vertreten – AK fordert Millionärsabgabe
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Michael Ferber: Die Angst vor dem Stagflations-Gespenst steigt: Sind die höheren Inflationsraten temporär oder dauerhaft? Darüber gehen bei Anlageexperten die Meinungen auseinander. Manche sehen Parallelen zu den 1970er Jahren
- Europäische Union als Geldautomat – Recherche der europäischen Grüne-Fraktion rechierte: kaltschnäuzig gestellte Förderanträge nicht vereinbar mit Vorgaben für den EU-Wiederaufbaufonds
- IMF: Building a Better Digital Economy
- Der Staat ist digital inkompetent. Und das ist gut so – Digitaler Staat: Wie gross der Umfang des Staates sein soll, ist ein Thema vieler politphilosophischer Reflexionen. Wichtiger ist aber die Frage nach seiner Kompetenz. Vor allem in der Digitalisierung sollte der Staat nie eine überbordende Rolle innehaben, wie das Beispiel China zeigt. Der moderne Staat kann nämlich nur unter einer Bedingung digitale Kompetenz ausspielen, und das ist die Tyrannei. Einer der schönsten Zankäpfel der öffentlichen Diskussion betrifft die Rolle des Staates. Was soll er tun, und was soll er besser lassen? Dieser uralten Frage setzen wir soeben eine neue Variation hinzu, die wir in ihren möglichen Auswirkungen nicht unterschätzen dürfen: Soll der Staat eine digitale Macht sein?
Wie gross der Umfang des Staates sein soll, ist ein Dauerbrenner der politphilosophischen Reflexion. Doch wichtiger als die Frage nach der Quote ist die Frage nach der Kompetenz. - Michael Hüther: Haushaltsplan 2022 „Dem Druck auf die Schuldenbremse entkommt man nur durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen“
…oooOOOooo…
FUTUROLOGIE
IPCC: Erde steuert auf eine Erderwärmung um drei Grad zu, aber „Irreversible Folgen“ schon bei Erderwärmung von über 1,5 Grad vorhanden – Krisenszenarien: Hungerrisiko für 80 Mio Menschen, Ernterückgänge, Trinkwassermangel, Überflutung von Küstenstädten, Massenflucht, fortschreitendes Artensterben – Europa auch betroffen: Bevölkerungszuwachs auf das Dreifache, Malaria, Dengue-Fieber, Zika werden heimisch – Veröffentlichung des IPCC-Berichts erst Februar 2022 – Science-APA, 23.6.2021
Ein Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens hat nach Einschätzung des Weltklimarates IPCC „irreversible Auswirkungen auf Menschen und ökologische Systeme“. Im Entwurf zu einem umfassenden IPCC-Bericht gehen die Experten davon aus, dass eine Erderwärmung um zwei Grad 420 Mio. Menschen zusätzlich dem Risiko von Hitzewellen aussetzt. Bis zum Jahr 2050 bestehe – je nach Umfang des Treibhausgasausstoßes – ein Hungerrisiko für bis zu 80 Mio. Menschen zusätzlich.
„Das Leben auf der Erde kann sich von einem drastischen Klimaumschwung erholen, indem es neue Arten hervorbringt und neue Ökosysteme schafft“, heißt es in dem Berichtsentwurf. „Menschen können das nicht.“
Der rund 4.000 Seiten lange Entwurf nennt Ernterückgänge durch zunehmende Hitze, Trinkwassermangel, Massenflucht wegen Dürren oder nach Überflutungen von Küstenstädten sowie ein fortschreitendes Artensterben als einige Folgen der Erderwärmung. Leidtragende seien insbesondere diejenigen Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen hätten.
*** Folgen auch in Europa zu spüren ***
Aber auch Europa wird die Folgen nach Angaben der Experten zu spüren bekommen: Die dortigen Schäden durch Überflutungen würden sich bis zum Ende des Jahrhunderts auch bei einem hohen Maß an Anpassungsmaßnahmen deutlich erhöhen, prognostizieren die Berichtsautoren auf Grundlage internationaler Studien.
Die Zahl der Menschen in Europa mit einem hohen klimabedingten Sterberisiko wäre demnach bei einer Erderwärmung um drei Grad drei Mal so hoch wie bei einer Erwärmung um 1,5 Grad, insbesondere in Zentral- und Südeuropa. Außerdem dürfte Europa dem IPCC zufolge mit mehr Hilfe-Suchenden aus Afrika und zunehmend mit von Mücken übertragenen Krankheiten wie Malaria, Dengue oder Zika konfrontiert sein.
Die Erde hat sich seit dem vorindustriellen Zeitalter bereits um 1,1 Grad erwärmt. Laut Pariser Abkommen soll die Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber 1,5 Grad beschränkt werden.
*** Zwei Grad mit schwerwiegenden Folgen ***
Bereits für eine Erwärmung um zwei Grad beschreibt der IPCC-Berichtsentwurf schwerwiegende globale Folgen für Mensch und Natur. Derzeit steuert die Erde aber sogar auf eine Erwärmung um rund drei Grad zu.
An dem Bericht der IPCC-Arbeitsgruppe II arbeiten mehr als 700 internationale Experten mit. Seine Endfassung soll nicht vor Februar und damit erst nach der UNO-Biodiversitätskonferenz im Oktober und der UNO-Klimakonferenz im November veröffentlicht werden.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/16771986194545813753
SIEHE DAZU
=> Massenflucht und Krankheiten: Weltklimarat zeichnet düsteres Zukunftsbild – n-tv, 23.6.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Weltklimarat-zeichnet-duesteres-Zukunftsbild-article22637742.html
=> Todesopfer in Tschechien Bis zu 400 km/h: Heftiger Tornado zerstört mehrere Orte – n-tv, 25.6.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Bis-zu-400-km-h-Heftiger-Tornado-zerstoert-mehrere-Orte-article22643218.html
=> Vertreibung von Menschen infolge des Klimawandels wird unterschätzt – Science-APA, 18.6.2021
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/9764823941474293759
=> Ungewisse Zukunft: Wie geht es mit den jungen Flüchtlingen von Ceuta weiter? – n-tv, 27.6.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/magazine/auslandsreport/Wie-geht-es-mit-den-jungen-Fluechtlingen-von-Ceuta-weiter-article22644470.html
=> Ruhestätte für angespülte Leichen: Neuer Friedhof für Geflüchtete füllt sich schnell – n-tv, 27.6.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Neuer-Friedhof-fuer-Gefluechtete-fuellt-sich-schnell-article22642218.html
=> SwissRe-Chefökonom Haegeli: „Klimapolitik ist Wirtschaftspolitik! – Haegeli pessimistisch, ob Politik rasch genug wirkt – n-tv, 18.6.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Klimapolitik-ist-Wirtschaftspolitik–article22618758.html
Studie: Weltweiter CO2-Preis könnte fast 40 Prozent CO2 einsparen – Klimaclub optimal: überregionale und globale Initiativen besser als europäischer Alleingang – Preiserhöhung und Importzölle im europäischen Alleingang für Europa emissionssenkend, aber ohne genügende Verbesserung des gobalen Klimas – Klimaclub ernötigt geringe gesamtwirtschaftliche Kosten von 0,5 Prozent des BIP für alle Staaten – DJN, 26.6.2021
Die globale Erhöhung der jeweiligen CO2-Preise um 50 Dollar würde einer Studie zufolge zu einer drastischen Reduzierung des klimaschädlichen Treibhausgases führen – um 11,5 Milliarden Tonnen, das sind 38,6 Prozent des globalen Ausstoßes. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, wie der Spiegel berichtet. Die Studie rechnet Folgen und Kosten der von der EU-Kommission geplanten CO2-Grenzzölle und eines „Klimaklubs“ in verschiedenen Varianten durch.
„Die Ergebnisse zeigen, dass überregionale oder sogar globale Initiativen einen wesentlich stärkeren ökologischen Effekt haben als ein europäischer Alleingang – und das zu moderaten gesamtwirtschaftlichen Kosten“, heißt es in der Studie. Die Kosten lägen im Schnitt bei 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für alle Staaten, für EU-Mitgliedsländer sogar nur bei 0,1 Prozent.
Würde die EU den CO2-Preis um 50 Dollar erhöhen und zugleich Importe in energieintensiven Sektoren mit einem CO2-Zoll belasten, würden die Emissionen zwar in Europa deutlich sinken, aber „nur einen sehr geringen unmittelbaren Beitrag zum Schutz des globalen Klimas“ leisten. Der weltweite Ausstoß würde mit 790 Millionen Tonnen nur um 2,7 Prozent sinken.
In einem Klimaklub einigen sich die Mitglieder auf einen CO2-Mindestpreis und können dann Waren und Dienstleistungen untereinander frei handeln. Länder, die sich dem Mindestpreis verweigern, müssen beim Handel mit dem Klimaklub Importzoll zahlen. Würde sich die EU mit den USA zu so einem Klimaklub zusammentun, so die Studie, sänken die globalen Emissionen bereits um 2,6 Milliarden Tonnen CO2. Träte auch China bei, würden schon 23 Prozent Emissionen oder 6,9 Milliarden Tonnen eingespart.
„Ein EU-Grenzausgleich kann nur eine Zwischenlösung sein. Die EU muss mit den USA einen überregionalen und langfristig am besten globalen Klimaklub anstreben“, sagt Thomas Rausch, Leiter der Studie bei der Bertelsmann-Stiftung. Auch im Bundeswirtschaftsministerium wird das Modell eines Klimaklubs bevorzugt. Ein EU-Grenzzoll für CO2 könnten andere Staaten als „grünen Protektionismus“ verstanden wissen, heißt es in einem internen Papier des Ministeriums.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53256140-studie-weltweiter-co2-preis-koennte-fast-40-prozent-co2-einsparen-015.htm
Hans Bentzien: McKinsey-Vorschläge zur Zukunftsbewältigung: Deutschland könnte Wachstum bis 2030 verdoppeln dank mutiger Schritte und „kreativer Erneuerung“ – Nach 20 Jahren Erfolgsgeschichte: „Disruptive, radikal neue Lösungen sowie Technologiekompetenz“ erforderlich – Wandel einleiten durch Upgraden des „Betriebssystems“: in Industrieunternehmen, Mittelstand und Gründungsszene beschleunigte Verlagerung von Ressourcen auf Zukunftsthemen nötig – DJN, 23.6.2021
Deutschland könnte sein Wirtschaftswachstum nach Einschätzung des Beratungsunternehmens McKinsey bis 2030 verdoppeln – mit mutigen Schritten und einer „kreativen Erneuerung“. „Bis 2030 könnte Deutschland sein durchschnittliches BIP-Wachstum auf 2 Prozent beschleunigen“, heißt es in dem Bericht. Damit würde der Durchschnittswert der vergangenen zwei Jahrzehnte von 1,1 Prozent Pro-Kopf-Wachstum nahezu verdoppelt. Zugleich wäre es eine Verdopplung des derzeit bis 2030 erwarteten Wachstums von 0,8 bis 0,9 Prozent. Zum Ende der Dekade wäre sogar eine höhere Wachstumsdynamik möglich.
Fabian Billing, Deutschland-Chef von McKinsey, sagte: „Deutschland braucht eine kreative Erneuerung. Disruptive, radikal neue Lösungen sowie Technologiekompetenz sind eine wichtige Basis dafür.“ In der Covid-19-Pandemie habe Deutschland gezeigt, zu welchen Veränderungen es in kürzester Zeit in der Lage sei. Die Krise sei „Adrenalin für Innovationen“ gewesen. „Diese Dynamik müssen wir erhalten. Nicht die Erhaltung des Status Quo, sondern der Aufbruch und die mit ihm verbundenen Chancen ermöglichen auch künftig die Teilhabe an Fortschritt und Chancen im Sinne der sozialen Marktwirtschaft.“
Die vergangenen 20 Jahre waren für Deutschland laut McKinsey eine globale Erfolgsgeschichte: Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Wachstum von 1,1 Prozent in den Jahren 2000 bis 2019 lag Deutschland auf dem Niveau der USA (1,2 Prozent). Auch in Sachen Nachhaltigkeit befand sich Deutschland, gemessen an den Sustainable Development Goals, in der Führungsgruppe der Vereinten Nationen.
Verglichen mit den USA ist die Einkommensverteilung hierzulande ausgeglichener (Gini-Koeffizient 29,7 gegenüber 41,4), der CO2-Ausstoß pro Kopf um 45 Prozent niedriger und der soziale Fortschritt höher (Rang 11 gegenüber Rang 28 im Social Progress Index von 163 Ländern).
Doch die Dringlichkeit eines Umdenkens ist laut McKinsey gerade in jüngerer Zeit unübersehbar geworden: „Die rasante technologische Entwicklung, vor allem der Künstlichen Intelligenz (KI), die großen Anstrengungen, die zur Begrenzung des Klimawandels erforderlich sind, die Alterung der Gesellschaft sowie Spannungen in den globalen Handelsbeziehungen sind Kennzeichen des Wandels“, die die Beratungsgesellschaft schreibt.
Eckart Windhagen, Senior Partner McKinsey sagte: „Die Faktoren, die Deutschlands Erfolgsgeschichte der vergangenen 20 Jahren getrieben haben, verlieren erkennbar an Kraft.“ Der Außenbeitrag zur deutschen Wirtschaftsleistung lasse sich unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht sinnvoll steigern. Der Industriesektor, traditionell eine wesentliche Stütze des wirtschaftlichen Erfolgs, sei zuletzt kaum noch gewachsen.
„In allen Segmenten der Wirtschaft – Industrieunternehmen, Mittelstand und Gründungsszene – brauchen wir eine beschleunigte Verlagerung von Ressourcen auf Zukunftsthemen“, so Windhagen Zusätzlich brauch es „ein Upgrade des Betriebssystems“, also der Strukturen, die diesen Wandel unterstützten.
McKinsey hat vor diesem Hintergrund sechs Handlungsfelder identifiziert:
- Spitzenunternehmen
Für diese Unternehmen in den traditionellen Kernsektoren wie Automobil, Maschinenbau und Chemie und einem traditionell hohen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsausgaben reicht es nicht mehr, sich ergänzende Geschäftsfelder zu suchen, um auch künftig eine bedeutende Rolle im globalen Wettbewerb zu spielen. Vielmehr liegen die attraktivsten Zukunftsaussichten in sektorübergreifenden Wachstumsfeldern. - Mittelstand
Über 90 Prozent der führenden mittelständischen Unternehmen kommen aus der Hardwareproduktion. Jetzt müssen die bisherigen reinen Hardwareproduzenten zusätzlich Software und Systemsteuerungen entwickeln und die neuen Produkte in das Internet der Dinge integrieren, um auch in Zukunft eine wesentliche Rolle im Gesamtsystem zu spielen. In der Pandemie sind bei den meisten kleineren Unternehmen die Digitalinvestitionen zurückgegangen, während die Top-Unternehmen beschleunigt haben. Die Digitalisierung jetzt wieder aufzunehmen und in den nächsten Jahren zum Erfolg zu führen, ist eine Priorität. - Gründungen
Das Venture Capital Funding hat sich zwischen 2010 und 2020 verzehnfacht, lag aber 2020 trotzdem bei nicht mal 10 Prozent des US-Volumens. Derzeit gibt es 18 „Unicorns“ im Land, also junge innovative Unternehmen mit einer Marktbewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vor dem Börsengang oder einem Exit. Dabei wären mehr als die Hälfte der von McKinsey in Deutschland befragten 20- bis 40-Jährigen bereit, unternehmerisch tätig zu werden, und jeder Zehnte würde sogar gern selbst gründen. Als Haupthindernis werden fehlendes Eigenkapital und ein zu hoher bürokratischer Aufwand genannt. - Investitionen
Deutschlands Anteil an den wichtigen Investitionen in angewandte Künstlicher Intelligenz (KI) und Next-Generation Computing liegt deutlich unter dem Wert, den die Größe seiner Volkswirtschaft nahelegen würde. Und das ist kritisch, berücksichtigt man die Rolle dieser Zukunftstechnologien für das Wachstum. Zudem gelangen in diesen Bereichen wissenschaftliche Durchbrüche zu selten bis zur Kommerzialisierung oder Skalierung; die Übersetzung der Ideen in Produkte und Dienstleistungen bleibt oft auf der Strecke. Eine Verdopplung der privaten und öffentlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung und ein gezielter, starker Ausbau der (digitalen) Infrastruktur können das BIP-Wachstum bis 2030 schätzungsweise um 0,5 Prozentpunkte erhöhen. - Weiterbildung
Bis 2030 werden rund 4,0 Millionen Beschäftigte in andere berufliche Tätigkeitsfelder wechseln müssen – knapp 10 Prozent der Beschäftigten. Zusätzlich müssen über 6,5 Millionen. in erheblichem Umfang neue Fähigkeiten aufbauen – allein, um die fortschreitende Digitalisierung umzusetzen. Ein neues, auf lebenslanges Lernen ausgerichtetes (Weiter-)Bildungssystem qualifiziert die Erwerbsbevölkerung für die Arbeitswelten der Zukunft, die sich dynamisch weiterentwickeln werden. - Staat
Der Staat mit seiner Fähigkeit zur Übernahme langfristiger und hoher Risiken spielt eine wichtige Rolle für die Investitionen in kritische Infrastrukturen und Basistechnologien. Darüber hinaus hat er eine entscheidende Rolle, den Rahmen für eine beschleunigte Dynamik der Wirtschaft zu setzen. Zwei Prioritäten stehen im Vordergrund: (i) Ganzheitliche Regulierung sicherstellen, zum Beispiel Planungssicherheit für die Energiewende schaffen. Deutschland ist in den 1990ern mit Vorsprung gestartet, doch die Wende stockt, auch weil private Investoren noch mehr Klarheit über die langfristige Regulierung brauchen. (ii) Stärker ergebnisorientierte Verwaltung. Die Digitalisierungs-Großprogramme kommen voran. Erfolge insbesondere der sogenannten Speedboats werden wirksam.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53224200-mckinsey-deutschland-koennte-wachstum-bis-2030-verdoppeln-015.htm
INTERNATIONAL
Hans-Jürgen Jakobs, Moritz Koch: Zwischen den Big Five der USA und den Big Three Chinas: Wie sieht künftig eine digitale demokratische Gesellschaft aus? – Der Machtkampf zwischen Washington und dem Silicon Valley geht in die heiße Phase – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 27./28.6.2021
Die Warnungen der Tech-Kritikerin Shoshana Zuboff vor dem totalitären Anspruch der Internetkonzerne werden auch in den USA ernst genommen. Doch die Firmen wehren sich geschickt
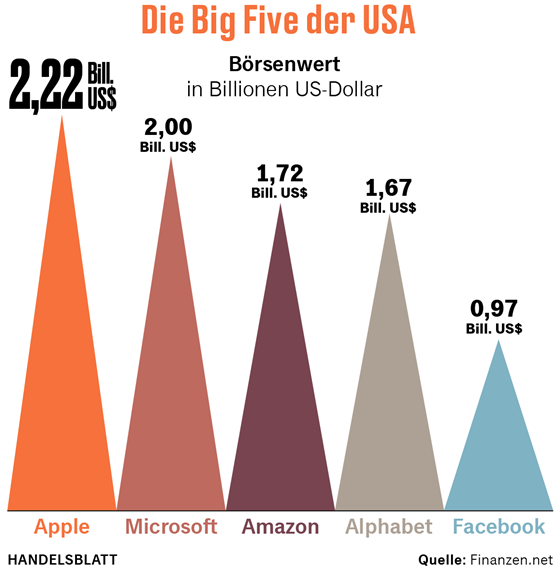
Wenn wir über die neuen Supermächte der Weltwirtschaft reden – größer als Nationalökonomien, mächtiger als Regierungen –, reden wir nicht einfach über Umsatz oder Börsenwerte. Wir reden auch nicht nur darüber, dass der anti-kapitalistische Löwe namens Wettbewerbskontrolle oft Karies und Beißhemmung zugleich hat.
Vielmehr müssten wir darüber nachdenken, wie eine digitale demokratische Gesellschaft der Zukunft aussieht, inklusive Datenschutz, Privacy und Meinungs-Fairness im Netz. Mit den „Big Five“ des Westens – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook – auf der einen Seite? Und den großen Drei des chinesischen Staatskapitalismus – Alibaba, Tencent, Baidu – auf der anderen Seite? Ein „Gleichgewicht des Schreckens“ wäre die schlimmste Vision.
QUELLE: https://www.handelsblatt.com/politik/international/facebook-netflix-und-co-der-machtkampf-zwischen-washington-und-dem-silicon-valley-geht-in-die-heisse-phase/27365836.html
Starke Preisanstiege bei Lebensmitteln auf globalen Märkten: „Wir müssen das Spiel des Marktes erlauben“ – Politische Interventionen wirken kontraproduktiv – Sinnvoll und nötig: Lokale Hilfen für jene Bevölkerungsanteile, die unter Preisanstiegen leiden – n-tv, 22.6.2021
Die Preise für Grundnahrungsmittel wie Weizen steigen so schnell wie seit Jahren nicht mehr. Hilfsorganisationen warnen vor einer Zunahme des Hungers in armen Ländern. Ökonom Peter Thoenes von der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO erklärt im Interview mit Max Borowski (n-tv), wie den betroffenen Menschen geholfen werden kann und was die Politik unbedingt vermeiden muss, um das Problem nicht zu verschärfen.
ZUSAMMENFASSEND: Die derzeitige Lage auf den Nahrungsmittel-Märkten lässt aufhorchen: Daten der FAO zufolge steigen die Weltmarktpreise für wichtige Grundnahrungsmittel so stark wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Hilfsorganisationen schlagen Alarm, dass sich die Versorgungslage in armen Regionen gefährlich zuspitzt.
Wetterbedingte Produktionsrückgänge und relative Schwäche des US-Dollars trieben die Preise. US-Dollar ist die Währung, in der der globale Handel mit Grundnahrungsmitteln wie Mais, Weizen, Sojy u.a. abgewickelt wird. Zudem waren globale Lagerstände in den letzten Jahren abgesunken. Chinas Importe spielen auch eine Rolle. Mehr Anbau von Grundnahrungsstoffen wird erst 2021/2020 wirksam, aber ungenügend: die Mengen sind zu klein, um Lücken zu füllen. Die Welthändler verhalten sich derzeit ruhig, der globale Handel verläuft glatt. Marktturbulenzen und Preisexzesse sind heute weit weniger üblich als noch vor mehr als zehn Jahren, da die FAO ein Marktinformationsnetz geschaffen hat. Zu sensibel ist die Nahrungsmittelversorgung für die einzelnen Staaten. Preisexzesse destabilisieren potentiell ganze Regionen oder Staaten. Die Rolle der Politik soll sich auf Stillhalten beschränken und nicht z.B. mit Zöllen intervenieren: jeder Preislenkungsversucht hilft nur kurzfristig. Steigende Preise ließ die Produzenten das Angebot ausweiten. Danach wird der Preis wieder sinken. Dieses Spiel des Marktes sollte erlaubt werden. Hilfe ist möglich, indem man den unter Preisanstiegen leidenden Bevölkerungsanteilen durch Nahrungsmittelprogramme und sonstige soziale Maßnahmen unter die Arme greift. Geberstaaten sollten diesbezüglich ärmeren Staaten finanziell helfen.
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wir-muessen-das-Spiel-des-Marktes-erlauben-article22636275.html
Hans Bentzien: CPB: Welthandelsvolumen steigt im April um 0,5 Prozent – Deutsche Eportwirtschaft profitiert: China und Japan mit Exportwachstum von rund 4 Prozent, Euroraum und USA stagnieren, asiatische Industrieländer und Lateinamerika mit Exporteinbußen von rund 4 Prozent – DJN, 25.6.2021
Das Volumen des Welthandels ist im April nach Angaben des Zentralen Planungsbüros der Niederlande (CBP) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Während sich der Handel im Euroraum und den USA kaum änderte, legten die Exporte Chinas um 3,8 Prozent zu und Japans um 2,5 Prozent. Die Ausfuhren der übrigen asiatischen Industrieländer und Lateinamerikas sanken um 4,4 bzw. 3,2 Prozent. Die deutsche Wirtschaft profitiert derzeit stark von ihrer Einbeziehung in den Welthandel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53251748-cpb-welthandelsvolumen-steigt-im-april-um-0-5-prozent-015.htm
Kiel Trade Indicator 06/2021: Stau von Containerschiffen nimmt zu, Welthandel aber intakt – Kiel Institut für Weltwirtschaft, 22.06.2021
Die Anzahl wartender Containerschiffe im chinesischen Perlflussdelta nimmt rasant zu. Einzelne Häfen wie Yantian verschiffen weniger als die Hälfte ihrer üblichen Containermenge. Demgegenüber sind in Megahäfen wie Shanghai aber noch keine Störungen zu beobachten, so dass die chinesische Schifffahrtskrise in den Indikatorwerten für Juni keine Ausschläge verursacht.
Für Deutschland signalisiert der Kiel Trade Indicator für Juni 2021 ein Plus bei den Exporten von 2,9 Prozent, die Importe dürften mit einem Indikatorwert von +0,2 Prozent praktisch stagnieren (nominal, saisonbereinigt).
Für die EU zeigt sich ein ähnliches Bild, für die Exporte ist mit einer Zunahme zu rechnen (+2,7 Prozent), für die Importe mit einer schwarzen Null (+0,8 Prozent).

„Das leichte Plus bei den Exporten von Deutschland und der EU ist als normale Gegenbewegung zu den negativen Werten im vergangenen Monat zu werten“, sagt Vincent Stamer, Leiter Kiel Trade Indicator.
Für die USA sind sowohl für die Einfuhren als auch Ausfuhren nur moderate Ausschläge und damit ebenfalls tendenziell eine Stagnation zu erwarten (Exporte -0,6 Prozent; Importe +0,2 Prozent).
Für Chinas Handel weist der Kiel Trade Indicator trotz Schifffahrtskrise in beide Richtungen positive Vorzeichen aus (Exporte +1,6 Prozent; Importe +2,5 Prozent).
Der gesamte Welthandel dürfte im Juni auf dem Niveau des Vormonats liegen (+0,4 Prozent).

„Die Anzahl wartender Containerschiffe im chinesischen Perlflussdelta nimmt rasant zu. In den vergangenen vier Wochen hat der Hafen Yantian nur gut 40 Prozent der üblichen Containermenge verschifft. Auch den Hafen von Shenzhen verlassen weniger Container als üblich. Die Mega-Häfen Shanghai und Ningbo verzeichnen aber gegenwärtig noch keine Einbrüche. Auch deshalb weist der Kiel Trade Indicator unter dem Strich positive Werte für Chinas Handel, den Welthandel und die Importwerte der genannten Länder aus. Spitzt sich die chinesische Schifffahrtskrise zu, könnte sich dies aber ändern“, so Stamer.
QUELLE: https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2021/kiel-trade-indicator-062021-stau-von-containerschiffen-nimmt-zu-welthandel-aber-intakt/
Welthandel wird gestört: Containerschiffe stauen sich in China – Vor allem Containerhafen Yantian betroffen – Weltgrößte Container-Reederei Maersk signalisiert baldige Entspannung – Umleitungen in andere Häfen verursachen steigende Wartezeiten dort – n-tv, 22.6.2021
Als das Containerschiff „Ever Given“ im März im Suezkanal feststeckt, stauen sich etliche Frachter dahinter – was die Lieferketten nach Europa in der Folge arg strapaziert. Nun stauen sich wieder Containerschiffe, allerdings in China – mit noch schwerwiegenderen Folgen.
Gravierende Störungen im Container-Schiffsverkehr lassen den Welthandel leiden. Probleme gibt es vor allem in Häfen am südchinesischen Meer, wo Corona-Infektionen für Terminalschließungen und entsprechende Verzögerungen gesorgt haben. „Die Anzahl wartender Containerschiffe im chinesischen Perlflussdelta nimmt rasant zu“, berichtete das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). …
Der Stau im chinesischen Hafen Yantian gilt in der Schifffahrtsindustrie inzwischen als größeres Problem als der einwöchige Stau am Suezkanal, der Ende März durch die Havarie des Containerfrachters „Ever Given“ verursacht worden war. Die weltgrößte Container-Reederei Maersk signalisiert ihren Kunden aber inzwischen absehbare Entspannung dort: „Nach einem sechstägigen Stopp für Exportcontainer haben die Hafenbehörden von Yantian angekündigt, dass die Produktivität allmählich steigen wird, da mehr Arbeiter zurückkehren und mehr Liegeplätze wieder geöffnet werden“, heißt es in einer Information für die Kunden.
*** Weitere Verzögerungen ***
Allerdings verursachten Umleitungen zu anderen Häfen wiederum steigende Wartezeiten dort: „Die derzeitige durchschnittliche Wartezeit in Shekou, Nansha und Hongkong liegt zwischen 2 bis 4 Tagen, aber da immer mehr Reedereien Yantian auslassen, wird diese Zahl voraussichtlich steigen.“
Das IfW wertet mit einem neuen Analyse-Tool weltweit Schiffsbewegungen aus, um so Rückschlüsse auf die Entwicklung der globalen Handelsströme zu ziehen. Dabei werden an- und ablegende Schiffe für 500 Häfen weltweit erfasst. Zusätzlich werden Schiffsbewegungen in 100 Seeregionen analysiert und die effektive Auslastung der Containerschiffe anhand des Tiefgangs gemessen. (ntv.de, vpe/dpa)
QUELLE (inkl. 1:37-min-Video): https://www.n-tv.de/wirtschaft/Containerschiffe-stauen-sich-in-China-article22636382.html
Corona bremst Wachstum der Pillendreher – Trotz Schrumpfung der Weltwirtschaft um minus 3,5 Prozent: Umsatz der 21 größten Pharmakonzerne kletterte 2020 um 4,4 Prozent – US-Medikamenteerzeuger als Umsatzkaiser – Kein Krisengewinner wegen deutlich höherer F&E-Ausgaben um 9,2 Prozent (2019: 9,7 Prozent) – Pressetext, 22.6.2021
Die Corona-Krise hat zwar auch das Wachstum der größten Pharmaunternehmen der Welt 2020 gebremst, im Vergleich mit anderen Wirtschaftszweigen schnitt die Branche allerdings noch gut ab. Während die Weltwirtschaft um 3,5 Prozent schrumpfte, legten die Umsätze der 21 größten Pharmafirmen um 4,4 Prozent zu – nach 12,8 Prozent im Vorjahr. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY http://ey.com für die 21 größten Pharmariesen der Welt.
*** „Widerstandskraft beeindruckend“ ***
„Zum einen ist die Widerstandskraft des Pharmasektors in Anbetracht der großen Wirtschaftskrise beeindruckend. Zum anderen ist die Branche kein Krisengewinner, denn Corona führte bei verschiebbaren Behandlungen zu Verzögerungen und beeinträchtigte laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Dass die Branche dennoch wuchs, verdankt sie Erfolgen in der Entwicklung von neuen Medikamenten gepaart mit langfristigen Trends wie der wachsenden und alternden Weltbevölkerung“, so Erich Lehner, Leiter Life Sciences und Managing Partner Markets bei EY Österreich.
Pillendreher aus den USA erzielten mehr als die Hälfte (51 Prozent, 2019 noch 49 Prozent) der Umsätze. In der Rangfolge der nach Umsatz größten Unternehmen gab es zudem einige Verschiebungen: Während Pfizer 2019 noch das zweitgrößte Pharmaunternehmen der Welt war, fiel es durch die Ausgründung von Upjohn auf Rang 6 zurück. Neu auf Platz 2 findet sich Abbvie, die durch den Erwerb von Allergan sowie organisches Wachstum einen Sprung nach vorn machte. Bei Bristol-Meyer-Squibb sorgte ein einziges neues Krebsmedikament für einen Umsatzanstieg von rund zehn Mrd. Euro, heißt es in der aktuellen Wirtschaftserhebung.
*** Entwicklung neuer Wirkstoffe teuer ***
Stärker als die Umsätze stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E). Sie legten 2020 um 9,2 Prozent zu, nachdem sie 2019 um 9,7 Prozent stiegen. „Darin spiegeln sich auch die starken Anstrengungen der Unternehmen wider, schnell Impfstoffe und Medikamente gegen Corona auf den Markt zu bringen. Viele Unternehmen sind wirtschaftliche Risiken eingegangen, um in dieser Ausnahmesituation schnell Lösungen zu entwickeln. Ganz allgemein ist die Pharmaindustrie eine Branche mit vergleichsweise sehr hohen F&E-Ausgaben. Im Jahr 2020 waren es bei den betrachteten Unternehmen im Schnitt knapp 20 Prozent des Umsatzes“, weiß Lehner.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210622019
Vermögen: Trotz Corona weltweit mehr Dollar-Millionäre – Aktien- und Immobilienbesitz zahlen sich aus. Österreich hatte im Vorjahr rund 346.000 Dollar-Millionäre – Wiener Zeitung/dpa, 22.6.2021
Die Zahl der Dollar-Millionäre weltweit hat einer Analyse der Credit Suisse zufolge auch im Jahr der Coronakrise weiter zugelegt. Am meisten Zuwachs bekam der Club der Reichen nach Angaben der Schweizer Großbank vom Dienstag in den USA. Der Vermögensstudie („Global Wealth Report“) zufolge, die die Credit Suisse seit 2010 jährlich vorlegt, gab es weltweit Ende vergangenen Jahres fast 56,1 Millionen Dollar-Millionäre. Das sind gut 5,2 Millionen mehr als 2019.
Die mit Abstand meisten davon leben in den USA (fast 22 Millionen – plus 1,73 Millionen). Auf den weiteren Plätzen folgen China (rund 5,3 Millionen – plus 257.000) und Japan (rund 3,7 Millionen – plus 390.000). Deutschland zählt demnach gut 2,95 Millionen Dollar-Millionäre und somit 633.000 mehr als bei der Auswertung ein Jahr zuvor.
In Österreich waren im Vorjahr 346.000 oder 4,8 Prozent der Erwachsenen Dollar-Millionäre. Das Gesamtvermögen aller Menschen in Österreich belief sich mit Ende 2020 auf 2,1 Billionen Dollar (1,8 Billionen Euro). In Summe hat das weltweite Vermögen binnen Jahresfrist um 28,7 Billionen Dollar auf 418,3 Billionen Dollar zugelegt.
*** Sparvolumen der Haushalte deutlich höher ***
„In Anbetracht des eingeschränkten Konsums ist die Ersparnis der Haushalte stark angestiegen, was das Finanzvermögen der Haushalte erhöht und deren Schulden verringert hat“, erklärte Nannette Hechler-Fayd’herbe, Leiterin Economics & Research bei der Credit Suisse. „Die Zinssenkung seitens der Zentralbanken hat vermutlich den größten Einfluss. Sie ist einer der Hauptgründe für den Anstieg der Aktienkurse und Hauspreise, die wiederum direkt in unsere Berechnungen des Haushaltsvermögens einfließen.“
Im Unterschied zu anderen Vermögensstudien etwa der Deutschen Bundesbank, die Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen summieren, berücksichtigt die Credit Suisse in ihren Berechnungen auch Immobilien. Die Autoren der Credit-Suisse-Studie rechnen damit, dass auch in den kommenden Jahren die Zahl der Dollar-Millionäre rund um den Globus schneller zulegen wird als das durchschnittliche Vermögen – unter anderem, weil Aktien sowie Häuser und Wohnungen an Wert gewinnen.
QUELLE (inkl tabellarischer Übersicht zur Zahl der Dollar-Millionäre 2020): https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2109508-Trotz-Corona-weltweit-mehr-Dollar-Millionaere.html
Michael Ferber: Geldschwemme treibt Vermögen trotz Corona auf neue Höhen – die Schweiz führt die Liste an – Neue Zürcher Zeitung, 11.6.2021
Die Inflation der Vermögenspreise treibt Aktienkurse und Immobilienpreise auf neue Höhen. So sind die Vermögen der privaten Haushalte 2020 weltweit weiter gestiegen – auch in der Schweiz.
Mit den Rettungsprogrammen der Notenbanken und Staaten sind die weltweiten Vermögen auch im Corona-Jahr 2020 weiter gestiegen. Laut dem Global Wealth Report des Credit Suisse Research Institute legten sie im vergangenen Jahr in Dollar gerechnet um 7,4% auf 418,3 Bio. $ zu. Das Vermögen pro Erwachsenen lag Ende des Jahres auf einem Rekordwert von knapp 80 000 $.
Mit den Rettungsprogrammen der Notenbanken und Staaten sind die weltweiten Vermögen auch im Corona-Jahr 2020 weiter gestiegen. Laut dem Global Wealth Report des Credit Suisse Research Institute legten sie im vergangenen Jahr in Dollar gerechnet um 7,4% auf 418,3 Bio. $ zu. Das Vermögen pro Erwachsenen lag Ende des Jahres auf einem Rekordwert von knapp 80 000 $.
Bei der Entwicklung spielte die sogenannte Inflation der Vermögenspreise eine wichtige Rolle. Damit sind vor allem die deutlich höheren Aktienkurse und Immobilienpreise gemeint, die von der Geldschwemme der Zentralbanken immer stärker aufgebläht werden.
Mit dem «Corona-Crash» im März 2020 seien vorübergehend rund 17,5 Bio. $ des Vermögens der privaten Haushalte verloren gegangen, heisst es in der Studie. Bis zum Ende des Jahres wurde dies dann mehr als kompensiert. Schon Ende Juni sei der Rückgang weitgehend aufgeholt worden. Nach dem anhaltenden Aktien-Rally in der zweiten Jahreshälfte wurden zum Jahresende Rekordwerte erreicht.
*** Aufgeblähte Vermögenspreise ***
Die Vermögensbildung im Jahr 2020 scheine völlig losgelöst von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die aus der Pandemie resultieren, sagte Anthony Shorrocks, Ökonom und Verfasser des Berichts. Auch der schwächere Dollar war ein Faktor für den Anstieg der Vermögen. …
*** Globale Verschuldung steigt ***
Auch wenn die Rettungsaktionen der Notenbanken und Staaten eine noch schwerere Wirtschaftskrise verhindert haben, gibt es doch auch Kritik. Negativ zu sehen sei, dass die globale Verschuldung im vergangenen Jahr massiv zugenommen habe, sagte Shorrocks. In vielen Ländern sei diese im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt um 20 Prozentpunkte oder mehr gestiegen, heisst es in der Studie.
Dem Studienautor zufolge könnte das weltweite Vermögen der privaten Haushalte durchaus gesunken sein, wenn man den Anstieg der Vermögenspreise nicht einrechnet. Dies gelte vor allem für weniger vermögende Haushalte. Sie hätten weniger Anlagen in Aktien und besitzen logischerweise auch weniger Immobilien als wohlhabende. Damit profitierten sie in geringerem Masse von der Inflation der Vermögenspreise. …
Laut dem Credit Suisse Research Institute haben die Vermögensunterschiede zwischen Erwachsenen im vergangenen Jahr zugenommen. Heute brauche eine Person mehr als 1 Mio. $, um zum weltweit wohlhabendsten 1% zu gehören. Im Jahr 2019 war diese Schwelle noch knapp unter 1 Mio. $ gelegen.
QUELLE: https://www.nzz.ch/finanzen/inflation-der-vermoegenspreise-aktien-und-immobilien-im-hoch-ld.1631759
Andrea Thomas (WSJ): Merkel sieht internationalen „Epochenwechsel“ Pandemie hat aufgemischt: Schub für Innovationen und Digitalisierung – Autokratische Systeme haben Vorsprung vor offenen Demokratien – USA packt neue Situation „mit Wucht“ an, Chinas BIP überrumpelt andere Staaten: Europa vielfach nicht führend, z.B. bei Quantencomputing, Chips oder Batterieforschg – International bedrohliche Machtverschiebungen: Änderungen nötig angesichts von Völkerrechts- und Regelbrüchen durch bedeutende Staaten sowie weiltweit aufgtauchter populistischer Strömungen – DJN, 21.6.2021
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Welt in einem „Epochenwechsel“ und fordert Reformen in Deutschland, um bei neuen Technologien mit den USA und China mithalten zu können. „Mit der Pandemie werden auf der Welt die Karten noch mal neu gemischt. Die offenen Demokratien haben sich schwerer getan als die autokratischen Systeme. Wir haben mehr aufzuholen“, sagte die CDU-Politikerin nach Teilnehmerangaben in der gemeinsamen Vorstandsvorsitzung von CDU und CSU, in der das gemeinsame Wahlprogramm der Unionsparteien beschlossen werden soll. Es sei daher wichtig, dass die Unionsparteien in ihrem Programm von einem Epochenwechsel sprächen.
Merkel betonte, die USA packten die aktuelle Situation mit einer „Wucht“ an, die auch auf ihre Wirtschaft abziele. Der Epochenwechsel werde, so Merkel, getrieben durch Innovation und Digitalisierung.
Merkel verwies auf das chinesische Bruttoinlandsprodukt, das sich mehr als versechsfacht habe während das deutsche nicht einmal um das Anderthalbfache gestiegen sei. „China ist sehr erfolgreich trotz eines autokratischen Systems“, gab Merkel zu bedenken. Europa sei hingegen an vielen Stellen nicht führend, wie etwa beim Quantencomputing, bei Chips oder in der Batterieforschung. Da müsse man ran, sagte die Bundeskanzlerin nach Informationen von Dow Jones Newswires.
Im Entwurf des Wahlprogramms, der Dow Jones Newswires vorliegt, heißt es im ersten Kapitel, dass sich Deutschland „inmitten eines weltweiten Epochenwechsels“ befinde. „Die große wirtschaftliche Dynamik in Asien und der Aufstieg Chinas verändern das internationale Machtgefüge. Wir erleben die Missachtung des Völkerrechts und Regelbrüche durch bedeutende Staaten des internationalen Systems, und wir sehen, dass sich weltweit populistische Strömungen ausbreiten, auch in demokratischen Staaten“, heißt es in dem Programmentwurf. Hinzu komme, dass neue Technologien nicht nur den Alltag bestimmten, sondern auch ein relevanter Faktor der internationalen Politik sei.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53202133-merkel-sieht-internationalen-epochenwechsel-015.htm
BÖRSEN
SENTIX-Sentiment: Bären verlieren die Geduld – SENTIX, 27.6.2021
Offensiv ausgerichtete Aktiendepots treffen auf eine extrem hohe Neutralität. Dies dürfte für stärkerer Volatilität in den kommenden Wochen sorgen! Zudem verlieren die Bären langsam die Geduld, die Korrektur bei Aktien will einfach nicht kommen. Es braut sich also etwas zusammen! Auch beim Rohöl steigen die Risiken an: Der Overconfidence Index gibt ein erstes Warnsignal. Edelmetalle wie Gold haben gute Karten.
Weitere Ergebnisse: * Aktien: Super-Neutrality mit neuem Allzeithoch * Rohöl: Hohe Overconfidence
QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-26-2021.html
S&P 500 schafft weiteres Rekordhoch – ORF, 26.6.2021
Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben gestern ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 erreichte sogar ein weiteres Rekordhoch und profitierte dabei unter anderem von einem rasanten Kursanstieg bei den Aktien von Nike. Der Sportartikelhersteller hatte überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt.
Positiv wirkten zudem weiterhin die zuletzt im Ringen um großangelegte Investitionen in die amerikanische Infrastruktur erzielten Fortschritte, die als Anzeichen für eine anziehende Konjunktur in den USA gewertet wurden.
Der S&P 500 legte um 0,33 Prozent auf 4.280,70 Punkte zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 34.433,84 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 3,44 Prozent.
Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,14 Prozent auf 14.345,18 Punkte nach unten. Er hatte tags zuvor eine Bestmarke erreicht.
QUELLE: https://orf.at/stories/3218820/
Investmentbanking Das Fusionsgeschäft boomt – nur nicht in Deutschland
Global ist der M&A-Markt auf Rekordkurs. Doch hierzulande stockt das Fusionsgeschäft. Experten sehen verschiedene Gründe – und erwarten eine rasante Aufholjagd zum Jahresende – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 22.6.2021
Nach der Bundestagswahl rechnen die Investmentbanker auch in Deutschland mit einer Welle an Fusionen und Übernahmen (M&A). Kai Tschöke, Co-Chef Investmentbanking bei Rothschild & Co. im deutschsprachigen Raum, verweist auf optimistische Gewinnerwartungen der Unternehmen, sehr aufnahmefähige Kapitalmärkte und ein breites Angebot an Fremdkapital.
Global ist der M&A-Markt auf Rekordkurs, im bisherigen Jahresverlauf addierten sich die Transaktionen bis Anfang Juni auf 2,5 Billionen Dollar – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 940 Milliarden. In Deutschland jedoch läuft das Fusionsgeschäft eher gedämpft – die international im Fokus stehenden Branchen Technologie und Healthcare sind eher unterrepräsentiert.
Investmentbanker wie Tibor Kossa, Co-Head M&A für Deutschland und Österreich bei Goldman Sachs, sind aber optimistisch und erwarten einen „starken Aufholeffekt in den nächsten Monaten“. Der Startschuss sei schon gefallen, meinen die Dealmaker und verweisen auf den Zusammenschluss von Vonovia und Deutsche Wohnen im Wert von 34,5 Milliarden Dollar. Die Gründe sind vielfältig:
- Bilanzreparatur nach der Coronakrise. Die von der Coronakrise am meisten gebeutelten Konzerne kommen nicht um Asset-Verkäufe herum.
- Konzentration auf das Kerngeschäft hält an. Erwartet werden von den Investmentbankern diverse Spin-offs.
- Finanzinvestoren werden immer mächtiger und aktiver. KKR plant beispielsweise in diesem und im nächsten Jahr global neue Fonds über mehr als 100 Milliarden Dollar.
- ESG sorgt für Ansturm auf Assets im Bereich erneuerbare Energien.
- E-Mobilität wirbelt die Kfz-Branche durcheinander.
- Börsenmäntel befeuern den Übernahmemarkt zusätzlich.
- In Deutschland werden wir im zweiten Halbjahr mehr Deals sehen.
- Neben den börsennotierten Gesellschaften werden auch privat geführte Firmen immer mehr in M&A-Situationen auftauchen. Insgesamt spricht also vieles für eine Fortsetzung des Booms im M&A-Markt, wenngleich die Kaufpreise immer ambitionierter werden.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/investmentbanking-das-fusionsgeschaeft-boomt-nur-nicht-in-deutschland/27305936.html
Alexander Trentin: Der Chart des Tages – Aktien und Anleihen: Mehr Korrelation heisst weniger Diversifikation – Finanz & Wirtschaft, 25.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/korrelation-640×375.jpg
Die Kurse von Aktien und Staatsanleihen haben sich in den vergangenen Monaten in die gleiche Richtung bewegt. Das zeigt die obige Grafik mit der rollierenden Dreimonatskorrelation des US-Leitindex S&P 500 mit Staatsanleihen (Treasuries). Sie ist nun so hoch wie zuletzt im Jahr 2007.
Wenn es nun zu einem Ausverkauf bei Aktien und anderen riskanten Anlagen käme, würden Anleihen wohl wenig Schutz bieten – die Diversifikation durch eine Mischung der zwei Anlageklassen fiele weg. Die Investoren sind auf beiden Seiten den Gefahren höherer Zinsen ausgesetzt. So hat sich die Duration – ein Mass der Zinsabhängigkeit – der Bondportfolios in den vergangenen zehn Jahren von 6,5 auf 8,5 erhöht.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2083/
COMMENT: Eingeweihte wissen, warum die drei vorangegangenen Meldungen in der Rubrik BÖRSEN die SENTIX-Meldung ergänzen und ihr an zweiter, dritter und vierter Stelle folgen. Von einer Rekordmeldung zur nächsten eilen, im Chart eine Fahnenstange ausbilden, die Rückkehr der Milchmädchen und privaten Kurzfristspekulanten, der Fusionshunger: all dies bedeutet in der Regel nichts Gutes. Hochmut kommt vor dem Fall.
Der Chart des Tages – FED provoziert Beginn der Zinsspekulation: Wahrscheinlichkeit eines Zinsanstiegs bis Ende 2022 und sein Ausmaß – Reaktion auf dem US-Anleihemarkt – Finanz & Wirtschat, 21.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/seb-fed-funds-2023-640×392.png
Nach der Fed-Sitzung ist vor der Fed-Sitzung. Der Offenmarktausschuss der amerikanischen Notenbank hatte vergangene Woche in Aussicht gestellt, dass der US-Leitzins vermutlich bereits 2023 und nicht erst 2024 erhöht wird. Die Ausschussmitglieder sprechen sich nun für zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 aus. Aktuell hält das Fed das Zielband der Fed-Funds-Geldmarktsätze auf 0 bis 0,25%.
Fed-Chef Jerome Powell unterstrich an der Pressekonferenz aber, dass seine Kollegen keinen verbindlichen Zinspfad vorgegeben hätten, sondern nur individuelle Eischätzungen. Damit hat er die Saison der Zinsspekulation eröffnet. Am Anleihenmarkt sorgten die Einschätzungen aus Washington für Renditeschwankungen. Die Verzinsung der richtungsweisenden US-Treasury-Anleihen schnellte zunächst nach oben, gab dann aber nach.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2079/
Sylvia Walter: Der Chart des Tages – Das Fed fegt den Anleihemarkt leer – Finanz & WIrtschaft, 23.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/image001-7-640×396.png
Was wäre, wenn der Staat sich verschuldet, und die Notenbank kauft den vollen Umfang der Neuemissionen auf? Dies passiert zwar eher selten, aber derzeit ist in den USA genau das wieder zu beobachten: Die US-Regierung emittiert Staatsanleihen, die sofort von den Währungshütern vom Markt genommen werden. Viele Geschäftsbanken, die ebenfalls Interesse hätten, sich insbesondere in kurzlaufenden Treasury Bills zu engagieren, gehen leer aus.
Allerdings ist dies weniger auf die Gier der Währungshüter zurückzuführen – ihr Ankauf von Staatspapieren ist seit geraumer Zeit konstant (dunkelblaue Linie in der Grafik). Ursache ist vielmehr ein Mangel an staatlichen Schuldpapieren, trotz Rekorddefizit der Regierung in Washington. Die Neuemissionen werden seit einigen Monaten nochmals drastisch reduziert (hellblaue Linie).
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2081/
Negativzinsen sind positiv – zumindest aus verhaltensökonomischer Sicht: Interesse an Aktienerwerb wurde geweckt – Aktiencheck / Stock-World-Redaktion, 21.6.2021
Strafzinsen, Negativzinsen, Minuszinsen oder Verwahrentgelte, wie die Banken es nennen, belasten Sparer nun schon seit 2014. Immer mehr Banken ziehen diese Gebühren von immer kleineren Beträgen vom Guthaben ab. „Damit sind Negativzinsen die sichtbarste Form der Geldentwertung“, sagt Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH. „Noch gefährlicher aber ist die Inflation.“
Mitte Juni stellten von rund 1.300 Kreditinstituten in Deutschland circa 400 ihren Kunden Negativzinsen beziehungsweise Verwahrentgelte in Rechnung. Viele davon schon ab 25.000 Euro, ist auf dem Vergleichsportal Verivox nachzulesen. Aber auch kleinere Summen werden nicht verschont: Zwölf Banken und Sparkassen nehmen schon Minuszinsen ab 10.000 Euro auf dem Konto und selbst bei 5.000 Euro schlagen derzeit schon zwei Institute zu. Dabei handelt es sich nicht etwa um relativ unbekannte Geldhäuser, sondern betrifft Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken.
„Am Anfang waren die Banken noch zögerlich, doch nun geben sie die Zinsen, die sie bei der Europäischen Zentralbank für das Hinterlegen von Geld bezahlen müssen, an die Sparer weiter. Diese Dynamik wird in der zweiten Jahreshälfte noch zunehmen“, sagt Kreuz. 2014 waren es noch -0,1 Prozent, aktuell liegen viele Banken schon bei -0,5 Prozent Zinsen. Doch das muss gar nicht schlecht sein: „Wenn Banken ihren Kunden Negativzinsen berechnen, wird der Vermögensverlust direkt sichtbar“, sagt Kreuz. „Unsichtbar, dafür umso dramatischer, ist die Schneise, die die Inflation ins Vermögen schlägt.“ Verhaltensökonomisch ist das jetzt ein Weckruf, über die eigene Kapitalanlage nachzudenken.
Die Negativzinsen schmerzen mehr, weil der Effekt sichtbar ist. Aus 100 Euro auf dem Konto werden bei einem Negativzins von 0,5 Prozent und unter Vernachlässigung eines Freibetrages nach 30 Jahren 86 Euro. Unterstellt man die von der EZB gewünschte Inflationsrate von zwei Prozent, werden aus den 100 Euro nach 30 Jahren weniger als 55 Euro. „Der verhaltensökonomische Nachteil der Inflation ist nur: Man sieht die unmittelbaren Auswirkungen nicht, da auf dem Bankkonto ja immer noch nominal 100 Euro abzüglich der Verwahrentgelte stehen“, sagt Kreuz.
„So betrachtet ist der um sich greifende Negativzins fast schon ein willkommener Auslöser, der dazu antreibt, sich mit seinem Kapital zu beschäftigen“, so Kreuz. „Mit dem positiven Nebeneffekt, einen viel größeren Wertverlust aus anderer Quelle zu vermeiden.“ Denn laut Bundesbank-Statistik wird das Geldvermögen der Deutschen unverändert von wenig bis gar nicht rentierlichen Anlageformen dominiert. Einer Studie der Postbank zufolge ist die beliebteste Anlageform der Deutschen das Sparkonto, wie 53 Prozent angeben, direkt gefolgt vom Girokonto (34 Prozent).
„Aus Sicht der Neuro-Finanz ist der Schmerz, den wir durch den Negativzins empfinden, ein schlechter Ratgeber“, so Kreuz. Er verleitet zu einer panikartigen Fluchtreaktion, viele stecken Geld in fragwürdige Investments, nur weil die ein paar Prozente mehr versprechen, oder gehen gleich in Kryptowährungen. „Von Null auf Bitcoin ist definitiv keine gute Idee“, sagt Kreuz. Gerade jetzt gehe es darum, sich nicht vom emotionalen, schnell arbeitenden Gehirnteil dominieren zu lassen, sondern den rationalen, dafür aber auch langsamer arbeitenden Teil des Gehirns einzusetzen. Es geht also darum, Struktur ins Portfolio zu bringen. Diversifikation ist nicht nur unter Risikoaspekten wichtig, sondern auch verhaltensökonomisch. „Ohne größere Risiken wird es nie eine höhere Rendite geben, aber eine breite Streuung glättet die Wogen, lässt ruhiger schlafen, denn das Angstzentrum wird nicht stimuliert“, sagt Kreuz.
Für Bankkunden kann es dabei durchaus sinnvoll sein, darüber nachzudenken, wie Beträge auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto besser angelegt werden können. Beispielsweise kooperiert INVIOS mit Banken, die keine Verwahrentgelte in Rechnung stellen, stattdessen ihren Kunden für monatlich verfügbare Einlagen sogar noch Zinsen zahlen und über die Einlagensicherungssysteme abgesichert sind. Allerdings heißt es auch dabei aufzupassen, dass die Bank nicht nur Anlageprodukte vermittelt, die für sie günstig sind. Auch Fonds bieten Lösungen, um dem Verwahrentgelt zu entgehen. „Ein gutes Beispiel dafür können kurzlaufende Rentenfonds mit Währungsbeimischung oder mit Bonitätsabstufungen im BBB-Bereich sein“, sagt Kreuz. „Sozusagen als Zwischenspeicher, bevor in längerfristige Investments mit höherem Risiko investiert wird.“
NIKLAS KREUZ ist seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt tätig. Der Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer der INVIOS GmbH war davon 20 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen aktiv: bei der Deutschen Bank, der UBS und der DZ Privatbank in der Schweiz, Luxemburg und Deutschland sowie als Chief Investment Officer für zwei Landesbanken. Nikolas Kreuz führte über 100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich. Die von ihm betreuten Fonds wurden mehrfach ausgezeichnet. Seine langjährige Investmenterfahrung fließt als Know-how in den INVIOS Vermögensbildungsfonds (WKN A2N82F) ein, der laut Morningstar zu den besten Fonds weltweit gehört, ausgezeichnet mit fünf Sternen von Fuchs Kapital und Asset Standard sowie einem Top-5-Ranking bei Citywire.
QUELLE: http://www.aktiencheck.de/kolumnen/Artikel-Negativzinsen_sind_positiv_zumindest_aus_verhaltensoekonomischer_Sicht-13296720
VÖNIX Nachhaltigkeitsindex: Zusammensetzung bleibt bei 19 Unternehmen – Wiener Börse, 24.6.2021
Nach der jährlichen Überprüfung des VBV-Österreichischen Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) gemäß Regelwerk geben rfu, die VBV-Vorsorgekasse und die Wiener Börse bekannt: 19 heimische börsennotierte Unternehmen, die sich hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten führend zeigen, sind 2021/22 in der österreichischen Nachhaltigkeits-Benchmark enthalten. Grundlage des VÖNIX ist die Messung unternehmerischer Nachhaltigkeit auf Basis eines Modells mit ökologischen und sozialen Ausschluss- sowie Positivkriterien. Der VÖNIX ist einer der weltweit ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes und wird seit Juni 2005 berechnet.
19 Unternehmen können sich 2021/2022 VÖNIX-Mitglied nennen und das Mitgliedschaftslogo ausweisen:
AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AMAG AUSTRIA METALL AG
AT & S AUSTRIA TECH. & SYSTEMTECH.
BKS BANK AG
BURGENLAND HOLDING AG
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
ERSTE GROUP BANK AG
EVN AG
KAPSCH TRAFFICCOM AG
LENZING AG
PALFINGER AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
TELEKOM AUSTRIA AG
UNIQA INSURANCE GROUP AG
VERBUND AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG
WIENERBERGER AG
ZUMTOBEL GROUP AG
„Der Kapitalmarkt ist ein entscheidender Faktor auf dem Weg in eine CO2-neutrale Zukunft. Was 2005 mit dem VÖNIX eine Initialzündung war, ist heute gelebte Praxis. Nachhaltiges Veranlagen ist für die VBV-Vorsorgekasse, als auch für viele andere Akteure, heute ein zentrales Thema“, so Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des Beirates des VÖNIX und CEO der VBV-Vorsorgekasse.
„Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren, welche in jüngster Zeit auch von der EU-Regulatorik gefordert wird, ist im VÖNIX Nachhaltigkeitsindex schon seit 16 Jahren Wirklichkeit. Die langfristige Entwicklung des Index zeigt, dass dies nicht zum Schaden der Rendite ist“, sagt Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer des für das Nachhaltigkeits-Rating zuständigen Unternehmens rfu.
*** Über den VÖNIX ***
Der VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) ist ein nach Streubesitz-Kapitalisierung gewichteter Preisindex. Das Basisuniversum umfasst Aktien, die im prime oder standard market der Wiener Börse notieren und ausreichend Streubesitz sowie Handelsumsatz aufweisen. Namhafte Akteure des österreichischen Kapitalmarkts ermöglichen durch ihre Kompetenzen und Beiträge das laufende Indexmanagement und Nachhaltigkeitsresearch. Diese Partner sind die VBV-Vorsorgekasse, die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und die Security KAG. Die rfu ist für die Nachhaltigkeitsanalyse verantwortlich und die Wiener Börse für Indexmanagement, laufende Berechnung und Publikation.
QUELLE: https://r.info.wienerborse.at/mk/mr/40lviRXlJUhxYxYcTwNnTE2Xz53QkrZ5k4l9Tsz4L2Clla4pnXr8anukjUMq59Jfpjrm9v_p452XKpmYjTyBOBxD1fK0tF3rqqL0Zs6Ch-vpMQ
SIEHE DAZU http://www.voenix.at/
ZENTRALBANKEN
- USA / FED
Das vergessene andere Ende der Zinskurve: US-Notenbank bereitet geldpolitischen Kurswechsel vor – Im Blick: Anleihenkäufe und niedriger Leitzins – Bedeutung für Investoren: auf die Zinskurve achten – Zinskurve: am kurzen Ende herrschte lange Zeit Totenstille, wie lange noch? – Finanz & Wirtschaft, 22.6.2021
Seit Monaten rätseln Anleger darüber, wann die wichtigsten Zentralbanken ihren ultraexpansiven Kurs ändern werden. Sie blicken auf die milliardenschweren Käufe von Anleihen und anderen Wertschriften (QE), mit denen die Währungshüter die Kurse stützen und so für künstlich niedrige mittel- und langfristige Marktzinsen sorgen. Die Sitzung der US-Notenbank vergangene Woche brachte hier gleich zwei Überraschungen mit sich.
Zum einen zeigten sich Fed-Chef Jerome Powell und seine Kollegen besorgter über den Inflationsanstieg als in den vorangegangenen Wochen. Ihre Bereitschaft, gegenzusteuern, ist grösser geworden und sie liefern konkrete Leitlinien für eine geldpolitische Straffung: nicht die Drosselung der Anleihenkäufe (Tapering), sondern eine Anhebung des US-Leitzinses – das ist die zweite Überraschung. Die achtzehn anwesenden stimmberechtigten sowie nicht stimmberechtigten Fed-Mitglieder rechnen damit, dass sie das Zielband für den Fed-Funds-Geldmarktsatz rund ein Jahr früher erhöhen könnten als sie bisher annahmen: bereits 2023 statt erst ab 2024. Sieben Fed-Vertreter können sich sogar vorstellen, dass die Zinswende bereits im Dezember 2022 vollzogen wird.
*** Eine neue Perspektive für Anleger ***
Für Anleger bedeutet das, dass sie sich künftig wieder die gesamte Zinskurve anschauen sollten. Nicht nur die mittleren und langen Laufzeiten, die durch QE beeinflusst werden, sondern auch das kurze Ende bis zwei, drei Jahre Laufzeit, das seine Impulse durch die erwartete Zinspolitik der Notenbanken erhält. Dort herrscht seit langem absolute Ruhe. Nur wenige Zentralbanken in den Industrieländern resp. wichtigeren Währungsräumen fassen sie bislang ins Auge: Norwegen, beispielsweise. Und nun also auch die USA.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/das-vergessene-andere-ende-der-zinskurve
Fed wird an der Zinsfront Ruhe bewahren – Trotz des Inflationsschub spricht sich US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress dagegen aus, die Zinsen präventiv zu erhöhen – Finanz & Wirtschaft/Reuters, 23.6.2021
Trotz der rasant gestiegenen Inflation in den USA wird die Notenbank laut Fed-Chef Jerome Powell Geduld bewahren. Die Preisanstiege seien wie die Daten vom Arbeitsmarkt und beim Wirtschaftswachstum Ergebnis der «ungewöhnlichen Situation» in der abklingenden Pandemie, sagte er am Dienstag vor dem Corona-Unterausschuss im Kongress. Die Notenbank werde die Zinsen nicht präventiv aus Furcht vor einer einsetzenden Inflation erhöhen, betonte er. Die Preissprünge seien zum grossen Teil durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft bedingt, wie man etwa an den teurer gewordenen Gebrauchtwagen ablesen könne. Man brauche wohl noch «etwas Geduld», um zu sehen, was sich wirklich tue. Doch die zu beobachtenden Effekte sprächen nicht für eine weitgehend angespannte Wirtschaft, die höhere Zinsen erfordern würde.
Die Verbraucherpreise (CPI) hatten zuletzt kräftig anzogen: Sie kletterten um 5,0% und damit so stark wie seit rund 13 Jahren nicht mehr. Powell entgegnete auf eine Frage vor dem Ausschuss, ob ein solches Niveau für ihn akzeptabel sei: «Nein.» Doch sieht er den Preisanstieg als vorübergehendes Phänomen.
Der Fed-Chef geht zudem davon aus, dass der Arbeitsmarkt im Laufe des Jahres deutliche Fortschritte machen wird: «Ich glaube, wir werden im Herbst einen starken Stellenaufbau erleben.» Die Fed hat die Richtung vorgegeben, dass sie die monatliche Dosis ihrer Geldspritzen in Höhe von 120 Mrd. $ so lange beibehalten will, bis erhebliche Fortschritte bei Preisstabilität und Beschäftigung erreicht sind.
Nach der jüngsten Zinssitzung hatte Powell signalisiert, dass ein Plan zum Abschmelzen der Anleihenkäufe bei einem anhaltenden Aufschwung auf den kommenden Sitzungen zum Thema werden dürfte. Angesichts des kräftigen Aufschwungs kann die Fed nach Ansicht der Chefin des Notenbankbezirks San Francisco, Mary Daly, möglicherweise schon Ende dieses Jahres oder Anfang 2022 ihre Ankäufe herunterfahren.
Angesichts der längst nicht ausgestandenen Krise hatte die Fed den Leitzins zuletzt in der Spanne von null bis 0,25% belassen. Allerdings signalisierten die Währungshüter erstmals seit Ausbruch der Pandemie, dass es 2023 eine Erhöhung geben könnte.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/fed-wird-an-der-zinsfront-ruhe-bewahren/
Fed-Chef sieht deutliche Erholung: Konjunktur und Arbeitsmarkt im deutlichen Aufwind – Inflationsanstieg nur vorübergehend – Besorgnis über Niedriglohnsektor: Afroamerikaner und Hispanics arbeitsmarktlich am stärksten von Pandemie getroffen – Künftige Pandemie-Risiken nicht ausgeschlossen: FED wird weiter stützen – Reaktion auf Zinswenden-Andeutung: Rendite am sekundären Anleihemarkt steigt auf 1,5 Prozent – Finanz & Wirtschaft/Reuters, 22.6.2021
Im Rahmen seiner Rede vor dem Kongressausschuss zeigt sich US-Notenbankchef Jerome Powell zuversichtlich hinsichtlich der Erholung der Konjunktur und des Arbeitsmarktes.
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sieht die Konjunktur und den Arbeitsmarkt weiter auf einem guten Weg. Es gebe eine deutliche Wirtschaftserholung von den Folgen der Corona-Pandemie, sagte US-Notenbank-Chef Jerome Powell in vorab veröffentlichten Auszügen seiner Rede vor einem Kongressausschuss am Dienstag. Er wiederholte zudem seine Aussage, dass die Teuerungsrate nur vorübergehend höher sein dürfte. Zudem zeigte er sich erneut besorgt, dass die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt am stärksten den Niedriglohnsektor, Afroamerikaner und Hispanics treffen. Er rechnet insgesamt jedoch mit der Schaffung weiterer Stellen. Die Pandemie stelle dennoch weiterhin Risiken für die Konjunktur dar. Die Fed werde «alles tun, um die Wirtschaft so lange zu unterstützen, bis die Erholung abgeschlossen ist».
Die Auszüge wurden nach dem Schluss der Wallstreet veröffentlicht. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatenleihen legte auf ein Tageshoch von 1,497% zu. Die Fed hatte am Mittwoch signalisiert, dass sie eine frühere Zinswende ins Auge fasst als bislang erwartet, und damit die Märkte aufgeschreckt.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/us-notenbankchef-sieht-deutliche-konjunkturerholung/
Andrew Ackerman and David Benoit: Alle 23 US-Großbanken schneiden im Stresstest gut ab – Beschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe wieder aufgehoben – Deutsche Bank glänzt mit höchster Kapitalquote unter den getesteten Banken – Im Stresstest Mindestanforderungen ums Doppelte übertroffen: Kapitalquote sinkt unter Extrembedingungen auf maximal knapp 11 Prozent – Nach Dividenden-Stopp: hohe Auszahlungen für Aktionäre 2022 erwartet – DJN, 25.6.2021
Die US-Notenbank hat den großen Banken bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise ein gutes Zeugnis ausgestellt und die Beschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe wieder aufgehoben. Alle 23 Banken haben bei den jährlichen Stresstests gut abgeschnitten, so die Federal Reserve. Ein besonders gutes Ergebnis erzielte die US-Tochter der Deutschen Bank – sie erreichte im Krisenszenario die höchste Kapitalquote aller getesteten Banken.
„Im vergangenen Jahr hat die Federal Reserve drei Stresstests mit verschiedenen hypothetischen Rezessionen durchgeführt, und alle haben bestätigt, dass das Bankensystem stark positioniert ist, um die laufende Erholung zu unterstützen“, sagte Randal Quarles, den für die Aufsicht zuständigen Vize-Chairman der Fed.
Die Fed hatte im vergangenen Sommer die Dividenden gekappt und Rückkäufe mit der Begründung verboten, dass während des durch das Coronavirus verursachten Abschwungs Kapital einbehalten werden müsse. Nach einer zusätzlichen Runde von Stresstests lockerte die Notenbank einige dieser Beschränkungen, seitdem durften Dividenden und Rückkäufe die Gewinne der vorherigen Quartale zumindest nicht übersteigen.
*** Kapitalquote würde auf höchstens 10,6 Prozent sinken ***
Die Stresstests messen die Fähigkeit der Banken, in einer schweren Rezession ein hohes Kapitalniveau zu halten und weiterhin Kredite an Unternehmen und Haushalte zu vergeben. In einem Worst-Case-Szenario mit einer schweren globalen Rezession, in der die USA eine zweistellige Arbeitslosigkeit erleben, würden die 23 großen Banken zusammen mehr als 470 Milliarden Dollar verlieren, so die Fed. Ihre Kapitalquoten würden auf 10,6 Prozent sinken, immer noch mehr als das Doppelte der Mindestanforderungen.
Besonders gut schnitt die US-Tochter der Deutschen Bank ab: Im Krisenszenario erreichte sie eine Kapitalquote von 23,2 Prozent, wie aus den Unterlagen der Fed weiter hervorgeht. Ebenfalls über 20 Prozent lag die US-Tochter der UBS.
Die Fed führt den Test normalerweise jährlich durch, fügte aber im vergangenen Herbst einen zweiten Test hinzu, um pandemiebedingte Belastungen zu berücksichtigen.
Analysten gehen davon aus, dass die Aufhebung von Dividenden-Beschränkungen zu einem Anstieg der Ausschüttungen führen wird, wenn die Banken demnächst ihre Pläne bekannt geben. Nach Schätzungen der Analysten von Barclays könnten sich die Kapitalrückzahlungen an die Investoren im kommenden Jahr auf 200 Milliarden Dollar belaufen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53246308-us-grossbanken-schneiden-im-stresstest-gut-ab-deutsche-bank-glaenzt-015.htm
- GROSSBRITANNIEN / BoE
Andreas Plecko: Bank of England bestätigt Leitzins und Kaufprogramm – Beobachter rechnen mit Leitzinserhöhung erst in zweiter Jahreshälfte 2023 – DJN, 24.6.2021
Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent bestätigt. Auch das Kaufprogramm wurde auf dem bisherigen Niveau von 895 Milliarden Pfund belassen. Börsianer und Ökonomen hatten mit diesen Entscheidungen gerechnet. Der Beschluss zum Leitzins fiel einstimmig. Beim Kaufvolumen gab es eine abweichende Stimme; wie im Mai sprach sich Ratsmitglied Andrew Haldane dafür aus, das Kaufprogramm um 50 Milliarden Pfund zu kappen.
Bei ihrer Mai-Sitzung hatte die BoE das Kauftempo verringert, das derzeit 150 Milliarden Pfund umfassende Kaufprogramm wird voraussichtlich Ende 2021 auslaufen. Wegen der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat die britische Regierung die zunächst für den 21. Juni angekündigte Wiedereröffnung der Wirtschaft um vier Wochen verschoben.
Ökonomen rechnen damit, dass sich am Leitzins der BoE für lange Zeit nichts ändern wird; erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 werden erste Zinserhöhungen erwartet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53238936-bank-of-england-bestaetigt-leitzins-und-kaufprogramm-015.htm
SIEHE DAZU
=> DOKUMENTATION/Erklärung der Bank of England zur Ratssitzung
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53238869-dokumentation-erklaerung-der-bank-of-england-zur-ratssitzung-015.htm
- SCHWEIZ / SNB
Thomas Fuster: Eine Umfrage der Nationalbank zeigt: Das Bargeld verliert in der Schweiz markant an Bedeutung – NZZ, 23.6.2021
Zwar werden in der Schweiz trotz Coronavirus noch immer die meisten Transaktionen mit Bargeld getätigt. Wertmässig hat die Debitkarte aber das Bargeld als wichtigstes Zahlungsmittel abgelöst. Eine Umfrage der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zeigt weitere Veränderungen im Zahlungsverhalten.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/wirtschaft/das-bargeld-verliert-in-der-schweiz-markant-an-bedeutung-ld.1631827
SIEHE DAZU
=> Zahlungsmittel der Eidgenossen: Schweizer nehmen Abstand vom Bargeld – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.6.2021
QUELLE https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/schweiz-bargeld-verliert-als-zahlungsmittel-an-bedeutung-17403059.html
- EUROPÄISCHE UNION / EZB
Hans Bentzien: BIZ befürwortet kontenbasiertes digitales Zentralbankgeld – Gründe, die für Digitalgeld sprechen: immer häufigere digitale Abwicklung des Zahlungsverkehrs (über Handy, PC, Karte), private Anbieter wollen eigene Währungen (Stable Coins) herausbringen, große Tech-Firmen wie Google steigen in Zahlungsdienste und Finanzdienstleistungen ein, Öffentlichkeit ist mit Blick auf Bitcoin-Verwerfungen für das Thema sensibilisiert – Sechs technische Eckpunkte – DJN, 23.6.2021
Digitales Zentralbankgeld ist aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Zukunft der monetären Systeme. In einem vorab veröffentlichten Aufsatz ihres Jahresberichts wirbt die BIZ für ein multiples System digitaler Zentralbankgelder (multiple Central Bank Digital Currency – mCBDC), an dem viele Zentralbanken teilnehmen könnten. Den Zentralbanken empfiehlt die BIZ, auf digitales Zentralbankgeld zu setzen, das auf Konten basiert, zu denen Endkunden auf Basis einer digitalen ID Zugriff erhalten.
Zentralbankgeld für Privatpersonen und Unternehmen gibt es auch jetzt schon: Es ist das Bargeld, dessen Nutzung sich aus verschiedenen Gründen in den vergangenen Jahren stetig verringert hat. Die BIZ geht in ihrer Studie von der Annahme aus, dass Bargeld neben digitalem Zentralbankgeld erhalten bleiben wird. Auch Giralgeld in Form von Krediten oder Guthaben bei Banken soll es weiterhin geben.
Gleichwohl führt die BIZ verschiedene Gründe dafür an, warum sich Zentralbanken derzeit zurecht mit den Möglichkeiten digitalen Zentralbankgeldes auseinandersetzen:
Immer mehr Zahlungen werden digital abgewickelt (über Handy, PC, Karte), private Anbieter wollen eigene Währungen (Stable Coins) herausbringen, große Tech-Firmen wie Google steigen in Zahlungsdienste und Finanzdienstleistungen ein, und die Öffentlichkeit ist auch wegen des Booms von Bitcoin für das Thema sensibilisiert. Zudem hat sich das Volumen grenzüberschreitender Zahlungen in den vergangenen Jahren vervielfacht, diese seien aber oft noch teuer und langsam.
Folgende technische Eckpunkte nennt die BIZ in ihrem Bericht: 1. Infrastruktur, 2. Zugang, 3. Datenlagerung, 4. Geldwäsche, 5. Grenzüberschreitende Zahlungen, 6. Geschäftsbanken.
Die Europäische Zentralbank (EZB) berät nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde am 14. Juli darüber, ob sie in die vertiefte Prüfung eines digitalen Euro einsteigen soll.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53226551-biz-befuerwortet-kontenbasiertes-digitales-zentralbankgeld-015.htm
Hans Bentzien: EZB: Globalisierung beeinflusst strukturelle Inflation kaum – Ursachen des Inflationsrückgangs (Disinflation): (1) Beginn vor Jahrzehnten in Zeiten schwach ausgeprägter Globalisierung, (2) gegenläufige Inflationsausprägungen in einzelnen Wirtschaftssektoren, (3) Globalisierung allein als Ursache zu schwach – Globalisierungsminderung oder Renationalisierung dürfte kaum disinflationär wirken – Niedrigzinspolitik kann strukturelle Fakoren auf Inflation nicht mehr neutralisieren – DJN, 22.6.2021
Die Globalisierung hat nach Einschätzung von zwei bei der Europäischen Zentralbank (EZB) beschäftigten Ökonomen kaum Einfluss auf die strukturelle, also von Lohn- und Preissetzungsmechanismen bestimmte Inflation. Maria Grazia Attinasi und Mirco Balatti kommen in einem von der EZB veröffentlichten Aufsatz zu dem Ergebnis, dass der Globalisierungsprozess der Jahrzehnte vor der Großen Finanzkrise deshalb keine wesentliche Rolle beim weltweiten Rückgang der Inflationsraten gespielt hat.
Diese Schlussfolgerung stützt sich auf drei Hauptelemente. Erstens begann der starke Rückgang der Inflation und ihre anhaltende Komponente in den 1980er Jahren, als die Globalisierung nur latent vorhanden war, und kam etwa Mitte der 1990er Jahre zum Stillstand, als China noch nicht der Welthandelsorganisation (WTO) beigetreten war. „Darüber hinaus verlief der Inflationsrückgang bei Waren und Dienstleistungen synchron, und aufgrund ihrer unterschiedlichen Handelbarkeit dürften sie nicht homogen auf die grenzüberschreitende Integration reagieren“, merken die Ökonomen an.
Zweitens deuteten die untersuchten Belege darauf hin, dass die Globalisierung einen heterogenen Einfluss auf die einzelnen Wirtschaftssektoren hat, wobei das verarbeitende Gewerbe den disinflationären Kräften stärker ausgesetzt ist als der Dienstleistungssektor. „Dies stützt die Ansicht, dass die Globalisierung zu relativen Preisveränderungen, aber nicht unbedingt zu einem Rückgang der Gesamtinflation führt“, folgern Attinaso und Balatti.
Selbst wenn drittens die Globalisierung als disinflationäre Kraft wirke, seien die geschätzten Auswirkungen wirtschaftlich gering. Die Autoren folgern daraus, dass eine Umkehr oder weitere Verlangsamung der Globalisierung der Inflation nur begrenzten Rückenwind geben würde.
Ursache der anhaltend niedrigen Inflation könnte ihrer Meinung nach die Tatsache sein, dass die Geldpolitik wegen bereits niedriger Zinssätze nur noch begrenzten Spielraum habe, um den Einfluss struktureller Kräfte auf die Inflation (entweder inländischen oder ausländischen Ursprungs) zu neutralisieren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53214328-ezb-globalisierung-beeinflusst-strukturelle-inflation-kaum-015.htm
Hans Bentzien: Barclays als ungläubiger Thomas: EZB wird nicht durchschnittlich 2% Inflation ansteuern – Flexibles Inflation Targeting (FIT) zeitkonsistenter – Längeres Überschreiten des Inflationszieles führt zu größeren Schwankungen im Konjunkturzyklus – DJN, 24.6.2021
Barclays erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Strategieprüfung ein Inflationsziel von 2 Prozent flexibel verfolgen, aber keine Inflation von durchschnittlich 2 Prozent anstreben wird. „Einer Strategie, die wegen der jahrelang zu niedrigen Inflation für längere Zeit eine Inflation von deutlich über 2 Prozent verlangen würde, würde eine deutlich lockerere Geldpolitik als die aktuelle verlangen, und es ist nicht zu erkennen, wie die Zentralbank das auf glaubwürdige Weise schaffen sollte“, schreiben die Analysten dieses Hauses.
Barclays geht davon aus, dass die EZB ihr Inflationsziel von „unter, aber nahe 2 Prozent“ auf 2 Prozent ändern und in Aussicht stellen wird, dass die Inflation für einige Zeit von diesem Wert nach oben oder unten abweichen darf. Ein derart flexibles Inflation Targeting (FIT) sei auch zeitkonsistenter.
„Falls die Inflation deutlich über 2 Prozent steigen würde, wäre nicht klar, ob Zentralbanken tatsächlich an ihrer Strategie festhalten und so eine Entankerung der Inflationserwartungen riskieren würden“, argumentieren sie. Auch würde ein längeres Überschreiten des Inflationsziels wiederum zu einer stärker restriktiven Geldpolitik führen. „Das würde zu größeren Schwankungen im Konjunkturzyklus führen“, geben die Barclays-Analysten zu bedenken.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53240588-barclays-ezb-wird-nicht-durchschnittlich-2-inflation-ansteuern-015.htm
Hans Bentzien: Lagarde vor dem Europaparlament: EZB darf zur Mandatserfüllung von Marktneutralität abweichen – DJN, 21.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde dazu berechtigt, bei ihren Anleihekäufen von dem bisher befolgten Prinzip der Marktneutralität abweichen. „Ich möchte auf Artikel 1.2.7 des Vertrags über die Funktion der Europäischen Union zurückkommen, der klar sagt, dass die EZB in Übereinstimmung mit Prinzip einer offenen Marktökonomie mit freiem Wettbewerb handeln und dabei einen effizienten Einsatz der Ressourcen favorisieren soll“, sagte Lagarde in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.
Die Idee der Marktneutralität sei also nicht im Vertrag enthalten, sagte Lagarde und fuhr fort: „Das Konzept der Marktneutralität wurde benutzt, um dieses Prinzip zu operationalisieren. Aber die EZB kann von einer Marktallokation abweichen, die auf Marktneutralität basiert, wenn das zur Erfüllung ihres Mandats notwendig ist.“ Die EZB habe zunehmend Evidenz dafür, dass Finanzmärkte und Banken gegenwärtig nicht voll die Risiken managten und einpreisten, die sich aus dem Klimawandel ergeben könnten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53206132-lagarde-ezb-darf-zur-mandatserfuellung-von-marktneutralitaet-abweichen-015.htm
Hans Bentzien: Gültig ab 26. Juni 2021: EZB übernimmt Aufsicht über systemisch wichtige Investmentfirmen – diese Investmentfirmen sind noch nicht bekannt, aber jedenfalls hohem Kredit- und Marktrisiko ausgesetzt – Systemrelevante Wertpapierfirmen sind solche, die Handel auf eigene Rechnung betreiben, Wertpapiere zu fixen Konditionen platzieren, eine konsolidierte Bilanzsumme von über 30 Milliarden Euro aufweisen – EU-Gesetzgebung umfasst Wertpapierfirmen-Richtlinie zwecks mittelbarer nationaler Umsetzung und Wertpapierfirmen-Verordnung, die unmittelbar gilt – DJN, 25.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ab 26. Juni die größten und systemisch wichtigsten Investmentfirmen beaufsichtigen. Laut EZB-Mitteilung müssen die namentlich noch nicht genannten Institute eine Banklizenz beantragen. Es handelt sich laut EZB um solche Institute, die wichtige Markt- und Investmentbanking-Dienstleistungen erbringen und damit ähnlich wie Banken einem Kredit- und Marktrisiko ausgesetzt sind.
Die EU-Gesetzgebung definiert systemrelevante Wertpapierfirmen als solche, die mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung handeln oder Finanzinstrumente auf Basis einer festen Zusage platzieren und eine konsolidierte Bilanzsumme von über 30 Milliarden Euro aufweisen. Bei solchen Wertpapierfirmen wird davon ausgegangen, dass sie bedeutende Risiken in ihrer Bilanz halten.
Die EU-Gesetzgebung zu Wertpapierfirmen umfasst die Wertpapierfirmen-Richtlinie, die von den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss, und die Verordnung über Wertpapierfirmen, die ab dem 26. Juni 2021 in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar gilt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53247763-ezb-uebernimmt-aufsicht-ueber-systemisch-wichtige-investmentfirmen-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Lagarde fordert EU auf, Stabilitäts- und Wachstumspakt rechtzeitig reformieren – Modernisierung nötig: reformiertes Rahmenwerk soll nach Ende der Aussetzung der EU-Defizit-Regeln 2022 greifen – Grund dafür ist der geänderte makroökonomische Kontext seit dem Start der Wirtschafts – und Währungsunion – Mehr Antizyklizität: Neue Regelungen für eine antizyklische und nachhaltige Fiskalpolitik erforderlich – Geldpolitik wurde Stabilisierung aufgebürdet, da bisherige Haushaltsregelung der Staaten insbesondere prozyklisch wirkte – DJN, 21.6.2021
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die EU aufgefordert, den Stabilitäts- und Wachstumspakt mit seinen Haushaltsregeln rechtzeitig zu reformieren. „Ein reformiertes Rahmenwerk ist hoffentlich schon da, wenn die allgemeine Öffnungsklausel deaktiviert ist“, sagte Lagarde in ihrer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Die EU-Defizitregeln sind bis 2022 ausgesetzt.
Lagarde räumte ein, dass der Pakt während der Pandemie den Regierungen ausreichend Spielraum für Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise gelassen habe. Gleichwohl müsse der Pakt reformiert werden. „Seit dem Start der Wirtschafts- und Währungsunion hat sich der makroökonomische Kontext deutlich verändert. Europa braucht einen modernisierten Rahmen mit transparenten, flexiblen und glaubwürdigen fiskalischen Regeln die eine antizyklische und nachhaltige Fiskalpolitik ermöglichen“, sagte die EZB-Präsidentin.
Sie hoffen, dass die momentan laufende Prüfung eine Lösung liefere, die diesen Anforderungen gerecht werde. „Wenn ich mir das aus einem geldpolitischen Blickwinkel ansehe, muss das Leitprinzip jeder Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts mehr Antizyklizität der Fiskalpolitik sein“, sagte sie.
Zu oft habe eine prozyklische Fiskalpolitik die Fähigkeit der Fiskalpolitik zur Stabilisierung des Output eingeschränkt. Das wiederum habe zu oft alleine der Geldpolitik die Aufgabe der Stabilisierung der Wirtschaft und des Erreichens des Inflationsziels aufgebürdet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53206628-ezb-lagarde-stabilitaets-und-wachstumspakt-rechtzeitig-reformieren-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Lagarde: Diskutieren gemeinsame Folgen einzelner Strategiepunkte für die Geldpolitik – Treffen des EZB-Rats behandelte Preisstabilität, mittelfristige geldpolitische Ausrichtung und die Rolle des Klimawandels dabei sowie die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation – DJN, 21.6.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat offenbar die Diskussion der einzelnen Punkte der Strategiedebatte abgeschlossen und befasst sich nun mit ihrer Integration in die neue geldpolitische Strategie. „Da alle in den Seminaren behandelten Themen in hohem Maße voneinander abhängig sind, werden sich die verbleibenden Diskussionen auf die Ableitung ihrer gemeinsamen Implikationen für die geldpolitische Strategie konzentrieren“, sagte Lagarde in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Der Rat habe während der Klausurtagung (am Wochenende) gute Fortschritte gemacht und werde das Ergebnis der Strategieüberprüfung nach der formellen Beschlussfassung bekannt geben.
Lagarde hatte kürzlich gesagt, sie hoffe, dass dies in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein werde. Analysten vermuten, dass die EZB spätestens Ende Jahres über die Zukunft des Pandemiekaufprogramms PEPP entscheiden und bis dahin ihre geldpolitische Strategie aktualisiert haben will.
Zu den am Wochenende diskutierten Themen gehörten unter anderem die Definition und Messung von Preisstabilität, der zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53205775-ezb-lagarde-diskutieren-gemeinsame-folgen-einzelner-strategiepunkte-015.htm
Hans Bentzien: EZB / Euroraum: Unternehmenskredite wachsen im Mai erneut schwächer – Nach 5,3 Prozent im März und 3,2 Prozent im April nun 1,9 Prozent mehr an Buchkrediten – Kreditvergabe insgesamt wuchs p.a. mit 6,7 Prozent, das Kreditvolumen an Privathaushalte mit 3,9 Prozent, jenes an die öffentliche Hand mit 15,4 Prozent – Geldmenge M3 wächst mit einer Jahresrate im Mai von 8,4 Prozent und einer Drei-Monats-Rate von 9,2 Prozent – DJN, 25.6.2021
Das Wachstum der Kreditvergabe im Euroraum hat sich im Mai weiter verlangsamt. Die Jahreswachstumsrate der Buchkreditvergabe an Nicht-Finanz-Unternehmen sank nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) auf eine Jahresrate von 1,9 Prozent. Im April waren es noch 3,2 Prozent gewesen, im März 5,3 und im Februar 7,0 Prozent. Ursache war der pandemiebedingte Anstieg der Unternehmenskreditvergabe im Frühjahr des Vorjahres. Im Mai 2020 nahm die Kreditvergabe um 51 Milliarden Euro zu, während sie im Berichtsmonat um 12 Milliarden Euro sank.
Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,9 (3,8) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 5,4 (5,4) Prozent zunahmen. Die Konsumentenkredite wuchsen mit einer Jahresrate von 0,6 (0,3) Prozent.
Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 6,7 (7,7) Prozent, wobei das Wachstum der Kreditvergabe an Private 3,5 (4,0) Prozent betrug. Die an den Staat vergebenen Kredite wuchsen mit einer Jahresrate von 15,4 (18,0) Prozent.
Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Mai mit einer Jahresrate von 8,4 (9,2) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 8,5 Prozent gerechnet. Die Dreimonatsrate betrug 9,2 Prozent. Das Wachstum der engeren Geldmenge M1 verringerte sich auf 11,6 (12,3) Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53248642-ezb-unternehmenskredite-wachsen-im-mai-erneut-schwaecher-015.htm
Hans Bentzien: EZB: NPL-Volumen sinkt 2020 weiter – 37,5% mehr „Evergreening“: Kreditstundungen und Kreditstreckungen nehmen zu – Deutschland, Niederlande, Frankreich und Spanien gewähren die meisten Erleichterungen – Italien, Griechenland und Portugal mit großen Fortschritten beim NPL-Abbau – Deutschland mit niedrigster NPL-Quote – EZB erwartet NPL-Anstieg wegen Pandemie in ungewisser Höhe – DJN, 25.6.2021
Das Volumen der notleidenden Kredite (Non Performing Loans – NPL) der im Euroraum tätigen Inlandsbanken hat sich 2020 trotz der Corona-Krise weiter verringert. Allerdings nahm zugleich das Volumen der Kreditstundungen und -streckungen zu, und zwar vor allem in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.
Wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, sank das NPL-Volumen per Ende 2020 um 11,4 (2019: 12,4) Prozent auf 480 (542) Milliarden Euro. Diese Zahl umfasst die in den 19 Ländern des Euroraums ansässigen Banken. Der Anteil notleidender Kredite an den insgesamt ausstehenden Krediten (NPL-Quote) ging auf 1,8 (2,2) Prozent zurück, während die Bilanzsumme aller Institute um 8,1 (2,8) Prozent stieg.
Die Daten zeigen, dass erneut besonders Italien (minus 22,6 Prozent), Griechenland (minus 21,6 Prozent) und Portugal (minus 19,1 Prozent) große Fortschritte beim Abbau notleidender Kredite gemacht haben. Griechenlands NPL-Quote betrug allerdings immer noch 19,8 (28,6) Prozent. Den niedrigsten Wert wies Deutschland mit 0,7 (0,7) Prozent auf.
Laut den EZB-Daten nahm die aggregierte Bilanzsumme deutscher Banken 2020 um 6,8 (minus 4,4 Prozent) zu, während die französischer, italienischer und spanischer Institute um 12,0 (plus 5,8), 7,2 (plus 10,7) und 4,6 (plus 3,4) Prozent stieg.
Oft umgehen Banken eine Deklarierung eines Kredits als „notleidend“, indem sie den Kredit umstrukturieren, stunden oder die Zahlungsfrist verlängern, ehe jene 90 Tage ohne Zahlung abgelaufen sind, die aus einem Kredit ein notleidendes Darlehen machen. Diese Praxis wird „Evergreening“ genannt. Die EZB spricht von „forbearance measures“.
Das Volumen dieser Kredite nahm im Euroraum um 37,5 (minus 10,0) Prozent auf 180,9 (131,6) Milliarden Euro zu. Der größte Teil von ihnen lag in Deutschland (34,0 nach 11,7 Milliarden Euro), den Niederlanden (31,7 nach 14,1 Milliarden Euro), in Spanien (30,9 nach 35,6 Milliarden Euro) und in Frankreich (23,7 nach 13,0 Milliarden Euro).
Die EZB rechnet damit, dass das NPL-Volumen wegen der Pandemie wieder steigen wird. Derzeit ist wegen diverser Sonderregelungen nicht absehbar, wie stark dieser Anstieg ausfallen wird.
Es folgt eine Tabelle der notleidenden Kredite von 19 Euroraum-Ländern (Studung/Streckung, NPL-Quote).
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53247833-ezb-npl-volumen-sinkt-2020-weiter-aber-37-5-mehr-evergreening-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Lane: Noch viel Arbeit bei Etablierung von Bankeinlagensicherung – Restierende Sorgen trotz großer Erfolge bei der Risikoreduzierung in der Vergangenheit – Richtiges Tempo beim Übergang vom nationalen zum europäischen Sicherungssystem finden – DJN, 22.6.2021
Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, ist optimistisch, dass es eines Tages zur Gründung einer gemeinsamen europäischen Sicherungseinrichtung für Bankeinlagen (European Deposit Insurance System – Edis) kommen wird – er sieht aber auch noch viel Arbeit. „Wir wissen, wo wir ankommen werden, aber es ist natürlich noch ein bedeutender politischer Prozess“, sagte Lane in einer von der Athens University of Economics and Business organisierten Diskussion.
Er wolle nicht die großen Erfolge bei der Risikoreduzierung in den vergangenen Jahren kleinreden, aber es gebe diesbezüglich doch noch Sorgen. Auch hätten sich die öffentlichen Schuldenquoten während der Pandemie „in die entgegengesetzte Richtung bewegt“. Lane sagte, es gebe weiterhin eine Debatte über das richtige Tempo beim Übergang von nationalen Sicherungssystemen auf eine gemeinsame europäische Einrichtung. „Es ist aber wichtig, an dieser Vision festzuhalten“, betonte der EZB-Chefvolkswirt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53218104-ezb-lane-noch-viel-arbeit-bei-etablierung-von-bankeinlagensicherung-015.htm
Bankenpräsident rechnet zum Abschied mit EZB ab: „Es ist mir auch nach intensiven Kämpfen mit Herrn Draghi nicht gelungen, die EZB davon zu überzeugen, wie Negativzinsen den Banken schaden“ – Geld fehlt für nötige Neustrukturierungen: Negativzins-Zahlungen der europäischen Banken belasten massiv Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den US-Banken – DJN, 26.6.2021
Der scheidende Bankenpräsident Hans-Walter Peters rechnet zum Abschied von seinem Amt mit der Europäischen Zentralbank (EZB) ab. „Es ist mir auch nach intensiven Kämpfen mit Herrn Draghi nicht gelungen, die EZB davon zu überzeugen, wie Negativzinsen den Banken schaden“, sagte Peters der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am 1. Juli übernimmt Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing das Spitzenamt der privaten Banken Deutschlands.
Wie Peters der Zeitung sagte, werden die europäischen Banken allein dieses Jahr 15 Milliarden Euro an Negativzinsen zahlen, Geld das sie an anderer Stelle dringend gebrauchen könnten. „Das passt nicht“, sagte Peters, in einem Umfeld mit Pandemie, Digitalisierung und Klimawandel, was der Finanzbranche zusetze. „Den Banken werden die Milliarden genommen, die sie für die Neustrukturierung des Geschäftes und die Bildung von Eigenkapital brauchen.“
Er könne nicht verstehen, dass die EZB-Spitze verkennt, wie sehr sie die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzbranche in Europa gefährdet, mahnte Peters. „Ein Wiedererstarken der Banken wird es erst geben, wenn wir uns von den Negativzinsen verabschieden.“ Die Entwicklung seit der Jahrtausendwende sei dramatisch, sagte Peters. „Wir haben massiv an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Amerikanern verloren.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53257061-bankenpraesident-rechnet-zum-abschied-mit-ezb-ab-015.htm
USA
Defizit in der US-Leistungsbilanz im ersten Quartal geringer angestiegen als erwartet – DJN, 28.6.2021
Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2021 zwar gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 195,74 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 205,30 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im vierten Quartal 2020 auf 175,08 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 188,48 Milliarden Dollar genannt worden war.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53227890-defizit-in-der-us-leistungsbilanz-im-ersten-quartal-gestiegen-015.htm
Martin Lüscher: Der Chart des Tages – BIP-Revision nach unten – Finanz & WIrtschaft, 24.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/20212206-ip2-640×378.png
Die Wirtschaftswissenschaft ist keine exakte Wissenschaft. Vor allem wenn es sich um zeitnahe Indikatoren wie Wachstumsraten zum soeben beendeten Quartal handelt, sorgen oft grobe Schätzungen für Schlagzeilen. Kaum überraschend gibt es in den USA darum mehrere Revisionen des Wirtschaftswachstums, damit der Wert am Ende möglichst genau die Realität abbildet.
Revisionen gibt es aber auch bei anderen Indikatoren wie beispielsweise der Industrieproduktion. Jährlich gibt das Federal Reserve seine Anpassung für die letzten Jahre bekannt. Meist handelt es sich dabei um wenig bewegende Revisionen von geringem Ausmass. Diesmal ist es hingegen anders.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2082/
USA: Konsumklima der Uni Michigan hellt sich im Juni wieder auf und erreicht 85,5 Zähler – Künftiges Kaufverhalten: Konsumenten sehen aktuelle Lage pessimistischer, die Zukunft aber deutlich optimistischer – Kurz- und Langfrist-Inflationserwartungen gesunken – dpa-AFX/DJN, 25.6.2021
Das Konsumklima in den USA hat sich im Juni wieder verbessert. Die von der Universität Michigan erhobene Verbraucherstimmung stieg gegenüber dem Vormonat um 2,6 Punkte auf 85,5 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Erhebung mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit 86,5 Punkten gerechnet.
Allerdings wurde die erste Schätzung etwas nach unten korrigiert. In der ersten Erhebung war noch ein Indexwert von 86,4 Punkten gemeldet worden. Im Mai hatte sich die Konsumlaune eingetrübt. Der Indexwert war bis auf 82,9 Punkte gefallen.
Während sich die Beurteilung der aktuellen Lage im Juni weiter eintrübte, hellten sich die Erwartungen der Konsumenten deutlich auf. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 83,5 (Vormonat: 78,8, vorläufig: 83,8), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 85,5 (89,4 bzw 90,6) angegeben.
Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,2 von 4,6 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 2,8 von 3,0 Prozent.
Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53253060-usa-konsumklima-der-uni-michigan-hellt-sich-wieder-auf-016.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53253534-stimmung-der-us-verbraucher-im-juni-verbessert-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.sca.isr.umich.edu/
Sarah Chaney Cambon: Konsum der US-Haushalte stagniert im Mai – Weniger größere Ausgaben, mehr für Dienstleistungen – Einkommensrückgang von minus 2 Prozent – Deflator für persönliche Konsumausgaben steigt annualisiert um 3,9 Prozent, ohne die Komponenten Nahrung und Energie um 3,4 Prozent p.a. – DJN, 25.6.2021
Die US-Konsumausgaben sind im Mai konstant geblieben, da sich die Verbraucher bei größeren Anschaffungen zurückhielten und mehr für Dienstleistungen ausgaben. Zugleich sanken die Einkommen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stagnierten die Ausgaben gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Für April wurde ein revidiertes Plus von 0,9 Prozent (vorläufig: 0,5 Prozent) genannt.
Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Rückgang von 2,0 Prozent. Volkswirte hatten eine Abnahme um 2,7 Prozent erwartet. Das für April gemeldete Minus von 13,1 Prozent wurde bestätigt.
Das ist aber schon der zweite Rücksetzer bei den Einkommen in Folge.
Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent. Auf Jahressicht erhöhte sich der Index um 3,9 Prozent.
Die Fed verfolgt ein flexibles Inflationsziel: Die Preissteigerung darf für eine Weile höher als 2 Prozent liegen, wenn sie sich zuvor für einen längeren Zeitraum darunter bewegt hat.
In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 0,5 Prozent auf Monats- und 3,4 Prozent auf Jahressicht.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53252078-konsum-der-us-haushalte-stagniert-im-mai-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53251843-usa-konsumausgaben-stagnieren-inflation-legt-deutlich-zu-016.htm
US-Wirtschaft wächst gering stärker als der historische Wachstumstrend: Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Mai auf über Null – April-Stand war knapp unter Null – DJN, 21.6.2021
Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Mai verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,29, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den April wurde der Indexstand auf minus 0,09 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,24 genannt worden war.
Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich ebenfalls und notierte im Mai bei plus 0,81. Für den April wurde ein revidierter Wert von plus 0,17 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von plus 0,07 gemeldet worden war.
Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53204321-wirtschaftsindex-der-chicago-fed-steigt-im-mai-015.htm
Markit: US-Wirtschaft verliert im Juni an Schwung – Sammelindex für Produktion in der Privatwirtschaft fiel auf 63,9 Punkte (Mai: 68,7) – DJN, 23.6.2021
Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Juni verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel auf 63,9 von 68,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 62,6 von 62,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 61,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 64,8 von 70,4 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 70,0 gelautet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53229040-markit-us-wirtschaft-verliert-im-juni-an-schwung-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en
Kräftige Erholung der US-Wirtschaft: Wachstumsrate für erstes Quartal mit Plus von annualisiert 6,4 Prozent bestätigt – Deflator für persönliche Konsumausgaben (PCE) steigt um annualisiert 3,7 Prozent, der BIP-Deflator geringer als erwartet um 4 Prozent – DJN, 24.6.2021
Die US-Wirtschaft hat im ersten Quartal ihre kräftige Erholung fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die zweite Veröffentlichung wurde damit – wie von Ökonomen erwartet – bestätigt. Im ersten Quartal wurden staatliche Hilfszahlungen wie zum Beispiel erweiterte Arbeitslosenhilfe und Barschecks an Haushalte verteilt. Im vierten Quartal war das BIP um 4,3 Prozent gewachsen.
Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, stieg der als alternatives Inflationsmaß verwendete Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) annualisiert um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Vor allem die US-Notenbank favorisiert den PCE-Deflator bei ihren geldpolitischen Analysen.
Der BIP-Deflator, ein weiteres Inflationsmaß, stieg im ersten Quartal um 4,0 Prozent. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 4,3 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53240380-us-wachstumsrate-fuer-erstes-quartal-bestaetigt-015.htm
US-Aufträge für langlebige Güter steigen im Mai solide um 2,3 Prozent, solche für Investitionsgüter ohne Flugzeuge sanken um minus 0,1 Prozent – Ordereingang ohne Transportbereich mit Plus von 0,3 Prozent, außerhalb des Rüstungsbereiches mit Plus von 1,7 Prozent – DJN, 24.6.2021
Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Mai solide gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wuchsen die Orders gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 2,6 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 0,8 (vorläufig: 1,3) Prozent nach oben revidiert.
Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,3 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Zunahme um 1,7 Prozent. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, sanken um 0,1 Prozent.
In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53240259-us-auftraege-fuer-langlebige-gueter-steigen-im-mai-solide-015.htm
US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken – Benzinlager leeren sich – Gering gewachsene Ölproduktion im Jahresvergleich – DJN, 23.6.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 18. Juni verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,614 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 4,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,355 Millionen Barrel reduziert.
Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 7,2 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,93 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Plus von 0,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,954 Millionen gestiegen waren. Die API-Daten hatten einen Anstieg von 0,96 Millionen Barrel angezeigt.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11,1 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53229617-us-rohoellagerbestaende-ueberraschend-deutlich-gesunken-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
USA: Zweiter Rückgang in Folge: Neubauverkäufe geben weiter stark nach: minus 5,8 Prozent – Revidierter Rückgang im April bei minus 7,8 Prozent (zuvor: 5,9) – dpa-AFX, 23.6.2021
In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser erneut stark gefallen. Die Neubauverkäufe sanken im Mai im Monatsvergleich um 5,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es war der zweite Rückgang in Folge. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel einen leichten Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.
Außerdem war der Rückschlag im April stärker als bisher bekannt ausgefallen. Das Ministerium revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf 7,8 Prozent. Zuvor war nur ein Dämpfer um 5,9 Prozent gemeldet worden.
Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Mai 769 000 neue Häuser in den USA verkauft, wie das Ministerium weiter mitteilte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53229274-usa-neubauverkaeufe-geben-weiter-stark-nach-016.htm
Nicole Friedman: Preise bestehender Häuser in den USA erreichen im Mai Rekordhoch – Plus von 24 Prozent innerhalb eines Jahres: Medianpreis erreicht erstmals 350.000 USD – Nach Rückgang im Vorjahr: Anstieg der Hausverkäufe auf Jahressicht um 45 Prozent – Vierter Rückgang im Monatsvergleich – DJN, 22.6.2021
Der Medianpreis für bestehende Eigenheime in den USA hat im Mai erstmals 350.000 US-Dollar erreicht. Nach Mitteilung der National Association of Realtors (NAR), stieg der Preis exakt auf 350.000 Dollar und lag damit um 23,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Laut NAR führten ein Mangel an bestehenden Häusern und niedrige Zinssätze im Frühjahr zu zweistelligen monatlichen Preissteigerungsraten. Der starke Preisanstieg habe mehr Käufer zurückgehalten und so zum vierten Monat mit rückläufigen Verkaufszahlen in Folge bei Eigenheimen beigetragen.
Die Zahl der Verkäufe bestehender Häuser fiel im Mai um 0,9 Prozent gegenüber April auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 5,8 Millionen. Zum Vorjahr stiegen die Verkäufe um 44,6 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatten die coronabedingten Lockdowns zu einem Rückgang bei den Hausverkäufen geführt.
Der Lage am US-Häusermarkt hat sich somit im Mai weiter eingetrübt, allerdings nicht so stark wie von Analysten erwartet. Es ist der vierte Rückgang in Folge und wird mit einem geringeren Angebot begründet.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53217555-preise-bestehender-haeuser-in-den-usa-erreichen-im-mai-rekordhoch-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53217086-usa-verkaeufe-bestehender-haeuser-gehen-weiter-zurueck-016.htm
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich über Vorkrisen-Niveau, sinken nur leicht um 7.000 auf 411.000 Anträge (Vorkrisenniveau: 200.000 je Woche) – Vorwochenwert auf 418.000 Erstanträge hinaufrevidiert – Anzahl der Empfänger der Arbeitslosenunterstützung sinkt auf 3.4 Mio Personen – DJN, 24.6.2021
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 19. Juni abgenommen, doch der Rückgang war nicht so groß wie erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 7.000 auf 411.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 380.000 vorhergesagt.
Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 418.000 von ursprünglich 412.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 1.500 auf 397.750.
Tendenziell sinkt die Zahl der Erstanträge bereits seit Beginn des Jahres. In den vergangenen Wochen war die Erholung aber ins Stocken geraten. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt verbessert sich dank eines robusten Aufschwungs wegen gewaltiger Staatshilfen und Fortschritten bei den Corona-Impfungen.
Die Hilfsanträge liegen weiter deutlich über dem Niveau, das vor der Corona-Krise üblich war. In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche gut 200 000 Neuanträge gestellt.
In der Woche zum 12. Juni erhielten 3,39 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 144.000.
QUELLE:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53240131-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-sinken-nur-leicht-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53240214-usa-erstantraege-auf-arbeitslosenhilfe-sinken-nur-leicht-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
EUROPA
Der Chart des Tages – Europa dreht auf: Unternehmen revidieren Gewinne weit häufiger nach oben als weltweit üblich – Einkaufsmanagerindizes signalisieren Optimismus für die Zukunft – Finanz & Wirtschaft, 22.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/screenshot-2021-06-21-120105-640×433.jpg
In der europäischen Industrie stehen die Zeichen weiterhin auf Erholung. Darauf deuten etwa die Einkaufsmanagerindizes (PMI) hin, die als Frühindikatoren genutzt werden und in der Eurozone jüngst den höchsten Stand seit Umfragebeginn 1997 markiert haben.
Ermunternde Signale liefern auch die Gewinnrevisionen (Earnings Revisions): Gegenwärtig werden für die europäischen Unternehmen die Analystenschätzungen für die kommenden zwölf Monate deutlich öfter erhöht denn gekürzt.
Die Differenz zwischen positiven und negativen Gewinnrevisionen – die Earnings Revisions Ratio (ERR) – liegt im globalen Vergleich aussergewöhnlich hoch. So übertrifft sie das entsprechende Verhältnis im Weltindex (MSCI All Country World) um über drei Prozentpunkte (dunkelblaue Kurve, Dreimonatsdurchschnitt), was dem grössten Vorsprung seit sechs Jahren entspricht. In Europa werden die Gewinnprognosen gegenwärtig also deutlich häufiger nach oben angepasst als im Rest der Welt.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2080/
RUSSLAND – DEUTSCHLAND
Stimmung bei deutschen Firmen in Russland besser als seit Jahren – Nahezu alle Unternehmen zufrieden mit Geschäftsgang – Unternehmen erwarten russischen Post-Corona-Boom. stellen mehr Mitarbeiter*innen ein und investieren wieder – Sanktionen gegen Russland in der Krtitik – Klares Ja zu Nord Stream 2: Gasleitung zwecks Energieversorgung Deutschlands nötig – Nord Stream 2 als Brückentechnologie auf dem Weg zur Energiewende – DJN, 23.6.2021
Das Geschäftsklima von deutschen Unternehmen mit Russlandgeschäft ist so positiv wie seit vielen Jahren nicht mehr. Eine überwältigende Mehrheit von 95 Prozent der Unternehmen bewertet ihr Russlandgeschäft als sehr gut, gut oder befriedigend, wie aus der Umfrage der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) hervorgeht. Gut zwei Drittel erwarten eine positive oder leicht positive Entwicklung der russischen Wirtschaft im zweiten Halbjahr, so die AHK.
„Die Ergebnisse der AHK-Geschäftsklimaumfrage fallen viel besser aus als in den Vorjahren. Wir rechnen mit einem Post-Corona-Boom der russischen Wirtschaft, von dem auch die fast 4.000 deutschen in Russland registrierten Firmen profitieren werden“, sagte AHK-Vorstandschef Matthias Schepp.
Das größte Wachstum erwarten die deutschen Unternehmen in den Branchen IT und Telekom, Land- und Ernährungswirtschaft sowie Gesundheitswirtschaft.
*** Neue Stellen und höhere Investitionen ***
Mehr als die Hälfte der Unternehmen will mehr Mitarbeiter einstellen, lediglich drei Prozent planen Entlassungen. Auch kündigte knapp die Hälfte der Unternehmen an, in den nächsten zwölf Monaten ihre Investitionen in Russland auszubauen.
„Nach schwierigen Jahren, die von Corona, Sanktionen und politischen Konflikten geprägt waren, sind die deutschen Unternehmen in Russland auf Wachstumskurs und holen offenkundig verschobene Investitionen in Milliardenhöhe nach“, sagte Schepp.
Laut der Bundesbank betrugen die deutschen Nettodirektinvestitionen in Russland im ersten Quartal 2021 rund 1,1 Milliarden Euro.
Kritisch bewerten die Unternehmen die Sanktionen gegen Russland, die aufgrund der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim verhängt wurden. Diese zählten zu den größten Störfaktoren im Russlandgeschäft und würden von der deutschen Wirtschaft scharf abgelehnt, so die AHK. Von den befragten Unternehmen forderten 33 Prozent ein sofortiges Ende der Russlandsanktionen, 60 Prozent einen schrittweisen Abbau.
Rainer Seele, Präsident der AHK, forderte die Politiker auf, neue Wege zur Deeskalation zu finden. „Sanktionen schaden der Wirtschaft und haben nicht geholfen, politische Ziele zu erreichen“, so Seele.
*** Energiesicherheit: Nord Stream 2 unbedingt nötig ***
Auch bei der umstrittenen russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 positionierten sich die Unternehmen klar für die Röhre. Danach halten 94 Prozent der befragten deutschen Unternehmen die Gasverbindung für wichtig oder sogar unverzichtbar für die europäische Energieversorgung, 97 Prozent sind der Meinung, dass die Bundesregierung die Fertigstellung und Inbetriebnahme politisch durchsetzen muss.
„Nord Stream 2 ist unbedingt notwendig als Brückentechnologie auf dem Weg zur Energiewende“, sagte Seele. „Die Pipeline genießt nicht nur die Unterstützung der deutschen Wirtschaft, sondern bei der Mehrheit der gesamten deutschen Bevölkerung.“
Für die Umfrage wurden zwischen Mai und Juni die 1.000 Mitglieder der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer befragt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53224552-stimmung-bei-deutschen-firmen-in-russland-besser-als-seit-jahren-015.htm
GROSSBRITANNIEN
Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich leicht ein – Inflationssorgen: Lieferkettenprobleme schlagen auf Preise durch – 2021Q1: Wirtschaftsschrumpfung, 2021Q2e: Wirtschaftswachstum erwartet – dpa-AFX, 23.6.2021
Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Juni leicht eingetrübt, allerdings von sehr hohem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit fiel um 1,2 Punkte auf 61,7 Zähler, wie die Marktforscher am Mittwoch in London mitteilten. Dennoch liege der Indikator so hoch wie selten seit Erhebungsbeginn im Jahr 1998, erklärte Markit.
Obwohl sich die Stimmung sowohl in der Industrie als auch unter Dienstleistern eintrübte, berichteten die Unternehmen von einer hohen Bereitschaft, neues Personal einzustellen. Zugleich seien die Preise für Vorprodukte und Rohstoffe weiter gestiegen, was vor allem eine Folge von Problemen in den Lieferketten sei.
Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach daher von zunehmenden Inflationssorgen. Zugleich sei im zweiten Quartal mit einem starken gesamtwirtschaftlichen Wachstum zu rechnen. Im ersten Quartal war die britische Wirtschaft coronabedingt geschrumpft.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53224720-grossbritannien-unternehmensstimmung-truebt-sich-leicht-ein-016.htm
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
Wirtschaft in Eurozone boomt: Die Wirtschaft der Eurozone profitiert von den Lockerungen der Coronamassnahmen und erlebt einen Boom wie schon seit 2006 nicht mehr – Finanz & Wirtschaft/Reuters, 23.6.2021
Lockerungen vom Corona-Lockdown bescheren der Wirtschaft der Eurozone das kräftigste Wachstum seit 15 Jahren. Der Einkaufsmanagerindex – der Industrie und Dienstleister zusammenfasst – kletterte im Juni unerwartet deutlich um 2,1 auf 59,2 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 58,8 gerechnet. Das Barometer signalisiert ab 50 Punkten Wachstum. «Angesichts der rasanten Nachfrage boomt die Eurozone wie seit 15 Jahren nicht mehr», sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. «Wobei der Aufschwung zunehmend an Breite gewinnt und sich von der Industrie auf weitere Dienstleistungssektoren ausweitet, insbesondere auf die konsumnahen Unternehmen.»
Die Daten signalisierten ein «beeindruckendes» Wirtschaftswachstum im laufenden zweiten Quartal – auf das ein noch stärkeres Wachstum im Sommer folgen werde. «Die Zuversicht darauf, dass das Leben zunehmend zur Normalität zurückkehrt, hat auch die Geschäftsaussichten auf ein neues Allzeithoch steigen lassen, die Investitionen angekurbelt und Neueinstellungen gefördert», betonte Williamson. Zugleich dürfte der Inflationsdruck in den nächsten Monaten weiter steigen, da die Firmen Engpässe bei Rohstoffen und Personal spürten.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/wirtschaft-in-eurozone-boomt/
Andreas Plecko: Markit: Stärkstes Wachstum im Euroraum seit 15 Jahren – DJN, 23.6.2021
Die zunehmende Erholung der Wirtschaft, gelockerte Corona-Restriktionen, Fortschritte bei den Impfkampagnen und die gestiegene Zuversicht haben im Juni für das stärkste Wachstum in der Eurozone seit 15 Jahren gesorgt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – erhöhte sich auf 59,2 Zähler von 57,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit Juni 2006. Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 58,8 Punkte vorhergesagt.
Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung hin. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes verharrte bei 63,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 62,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 58,0 Punkte von 55,2 im Vormonat. Das entsprach exakt der Prognose von Ökonomen.
Die Verkaufspreise für Güter und Dienstleistungen stiegen jedoch mit neuer Rekordrate, da die Nachfrage das Angebot abermals übertraf. Gleichzeitig erhöhten sich die Geschäftsaussichten auf den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung dieser Daten im Jahr 2012, angeheizt von der boomenden Nachfrage und der Aussicht auf eine weitere Erholung der Wirtschaft. „Die Daten liefern die Grundlage für ein beeindruckendes BIP-Wachstum im zweiten Quartal 2021, auf das ein noch stärkeres Wachstum im dritten Quartal folgen wird“, sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53224285-markit-staerktes-wachstum-im-euroraum-seit-15-jahren-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases
Hans Bentzien: ING: Phase erhöhter Inflation könnte etwas länger dauern – Beeinflussung der Verbraucherpreise erst in sechs Monaten: Erzeugerpreise steigen teils zweistellig – Verzögerter Inflationsanstieg, aber nicht von Dauer – Jahresendhoffnung: Kreditverknappung in China senkt Druck auf Rohstoffpreise – EZB: nur kräftige Lohnsteigerungen wirken inflationstreibend – Trotz Arbeitskräftenachfrage: Kurzarbeit-Rückkehrer in den Arbeitsmarkt halten Löhne stabil – DJN, 22.6.2021
Die Inflationsraten in Europa steigen seit einiger Zeit stärker als allgemein erwartet. Auch ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski erklärt sich das überwiegend mit Sonderfaktoren, die vorübergehender Natur sein dürften. Er weist aber darauf hin, dass diese Phase erhöhter Inflationsraten länger dauern könnte, als derzeit allgemein angenommen. Eine regelrechte Lohn-Preis-Spirale, die eine straffere Geldpolitik nach sich ziehen würde, sieht Brzeski allerdings nicht.
Derzeit fallen im Europa vor allem die hohen, teilweise zweistelligen Steigerungsraten der Erzeugerpreise auf. Brzeski weist darauf hin, dass es normalerweise sechs bis zwölf Monate dauert, bis eine solche Entwicklung bei den Verbraucherpreisen ankommen. „In der aktuellen Situation, sowohl in den USA als auch in der Eurozone, deuten hohe Auftragsbestände im verarbeitenden Gewerbe und zahlungskräftige Verbraucher darauf hin, dass es ein großes Potenzial für ein Überwälzen gibt“, schreibt Brzeski in einem Kommentar.
Hinzu komme der erwartete Preisanstieg im Einzelhandel aufgrund des bevorstehenden Sommergeschäfts und der weiteren Öffnung der Volkswirtschaften, so dass eine höhere Inflation in den kommenden Quartalen so gut wie sicher scheine. „All dies deutet darauf hin, dass das erhöhte Inflationsniveau vorübergehend sein wird, aber diese Übergangsphase könnte länger sein als bisher angenommen“, so Brzeski.
Selbst wenn einige der einmaligen Faktoren im nächsten Jahr aus der Inflationsrate herausfallen, könnten die verzögerte Überwälzung höherer Erzeugerpreisen sowie die Preisvolatilität im Zusammenhang mit Lockdowns die Inflation laut Brzeski noch bis weit ins Jahr 2022 hinein beeinflussen. „Die gute Nachricht ist, dass die Kreditverknappung in China gegen Ende 2021 einen Teil des Drucks auf die Rohstoffpreise beseitigen wird“, meint er aber auch.
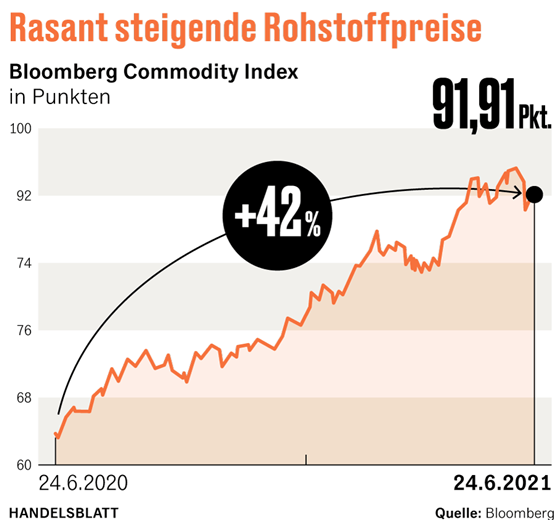
Aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) wären wohl nur kräftig steigende Löhne ein ernsthaftes Anzeichen für eine anziehende Inflation. Eine solche Entwicklung hält der ING-Ökonomen aber für wenig wahrscheinlich. Er argumentiert: „Mit der Wiedereröffnung des Einzelhandels, des Gastgewerbes und der Freizeiteinrichtungen ist es möglich, dass auch in der Eurozone ein vorübergehender Mangel an Fachkräften entsteht. Solange jedoch nicht anderswo neue Arbeitsplätze entstehen, scheint eine Rückkehr von Menschen aus Kurzarbeit in Vollzeitbeschäftigung das plausibelste Szenario zu sein.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53217781-ing-phase-erhoehter-inflation-koennte-etwas-laenger-dauern-015.htm
Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich auf – DJN, 22.6.2021
Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Juni verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 1,8 auf minus 3,3 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 3,5 prognostiziert. Für die EU-28 verbesserte sich der Wert um 1,5 Punkte auf minus 4,5. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Juni wird in der kommenden Woche veröffentlicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53217057-stimmung-der-verbraucher-im-euroraum-hellt-sich-auf-015.htm
Hans Bentzien: Finanzstabilität sichern: EU-Behörden fordern Marktteilnehmer zu aktiver Abkehr vom Libor auf – 35 Libor-Sätze spätestens ab 31. Dezember 2021 nicht mehr für neue Geschäfte nutzen – DJN, 24.6.2021
EU-Kommission, Europäische Zentralbank (EZB) sowie die Finanzaufsichtsbehörden Eba und Esma haben die Marktteilnehmer zu einer „aktiven Abkehr“ von den Libor-Sätzen aufgefordert. „Eine signifikante Abhängigkeit von einem der Libor-Sätze zum Zeitpunkt ihrer Einstellung oder bei Verlust ihrer Repräsentativität könnte die Funktionsfähigkeit des europäischen Finanzsystems beeinflussen“, heißt es darin.
Für einen reibungslosen Übergang von Libor zu anderen Zinssätzen sollten Marktteilnehmer ihre Libor-Exponierung aktiv verringern und nicht darauf warten, dass die EU-Kommission von ihrer neuen Befugnis Gebrauch macht, und einen Ersatz zu benennen.
Die Behörden raten den Finanzmarktteilnehmern, die 35 Libor-Sätze spätestens ab 31. Dezember 2021 nicht mehr für neue Geschäfte zu nutzen. Außerdem sollten sie den „synthetischen Libor“ nur wenn unbedingt nötig einsetzen und in ihre Verträge robuste Rückfallklauseln unter Verwendung andere Zinssätze integrieren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53239394-eu-behoerden-fordern-marktteilnehmer-zu-aktiver-abkehr-von-libor-auf-015.htm
FRANKREICH
Frankreich: Geschäftsklima steigt auf 14-Jahreshoch – Günstige Corona-Lage weckt Hoffnungen: starke Stimmungsaufhellung im vor allem Einzelhandel und bei Dienstleistern – dpa-AFX, 24.6.2021
Die französischen Unternehmen schöpfen angesichts einer günstigeren Corona-Lage wieder Zuversicht. Das Geschäftsklima stieg im Juni auf den höchsten Stand seit 14 Jahren, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Zum Vormonat erhöhte sich der Indikator um fünf Punkte auf 113 Zähler. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2007.
Der aktuelle Stand ist höher als das Niveau vor der Corona-Pandemie. Auch der langfristige Durchschnitt von 100 Punkten wird klar übertroffen. Besonders stark hellte sich die Stimmung unter Dienstleistern und im Einzelhandel auf. Das sind die Branchen, die von den Corona-Beschränkungen besonders hart getroffen wurden. Entsprechend profitieren sie jetzt überdurchschnittlich von den Lockerungen./bgf/mis
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53235146-frankreich-geschaeftsklima-steigt-auf-14-jahreshoch-016.htm
BELGIEN
Belgiens Geschäftsklima erklimmt im Juni Rekordhoch seit 1980 – Fast alle Wirtschaftssektoren optimistisch – Nach fünf Anstiegen in Folge: Bauhauptgewerbe mit gering gesunkener Zuversicht – DJN, 24.6.2021
Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juni stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 3,3 Punkte auf 9,8. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1980. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 8,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei 6,5 notiert hatte.
Mit Ausnahme des Baugewerbes, in dem die Zuversicht nach fünf Monaten ununterbrochenen Anstiegs erstmals wieder etwas gesunken ist, hat sich das Geschäftsklima in allen befragten Branchen wieder verbessert, also dem verarbeitenden Gewerbe, dem Einzelhandel und den unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53240589-belgiens-geschaeftsklima-erklimmt-im-juni-rekordhoch-015.htm
DEUTSCHLAND
Andreas Kißler (WSJ): Lockdown-Folgen verblassen: GfK-Konsumklima verzeichnet höchsten Wert seit August 2020 auf minus 0,3 – Verbesserung im Juli kräftiger als erwartet – Anschaffungsneigung mäßig, aber Einkommens- und vor allem Konjunkturerwartung verblüffend gut – DJN, 25.6.2021
Die Stimmung der Verbraucher hellt sich wesentlich spürbarer auf als erwartet. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juli einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 0,3 von revidierten minus 6,9 Punkten im Vormonat. Zunächst hatten sie für Juni noch einen Wert von minus 7,0 Zählern berichtet. Die Erholung im Juli fällt deutlich kräftiger aus als erwartet, denn die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten auf Basis der ursprünglichen Zahlen lediglich eine Zunahme auf minus 4,0 Zähler angenommen.
Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen legten im Juni deutlich zu, die Anschaffungsneigung verzeichnete moderate Zuwächse. Bemerkenswert sei, dass die Verbraucher sehr zuversichtlich seien, wenn es um die Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage in Deutschland gehe. Die Konjunkturerwartung lege nach dem sprunghaften Anstieg im Vormonat noch einmal um 17,3 auf 58,4 Zähler zu. Dies ist laut GfK der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren.
„Wir lassen den Lockdown mehr und mehr hinter uns“, stellte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl fest. Stark sinkende Inzidenzen sowie signifikante Fortschritte beim Impfen erlaubten immer umfangreichere Lockerungen und Öffnungen. Zudem sei nun auch Urlaub wieder möglich. „Dies sorgt für steigenden Optimismus, der sich auch in der besseren Konsumstimmung ausdrückt.“ Der für Juli prognostizierte Wert sei der höchste seit Sommer vergangenen Jahres. Im August 2020 wurde laut Bürkl mit minus 0,2 Punkten zuletzt ein besserer Wert gemessen.
*** Privater Konsum vor deutlicher Erholung ***
Damit werde eine spürbare Erholung des privaten Konsums in der zweiten Jahreshälfte 2021 wahrscheinlicher. Die Binnenkonjunktur würde damit wieder einen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten. Bislang werde das Wachstum in erster Linie durch die gute Exportentwicklung, speziell im Warenverkehr mit China und den USA, gestützt.
*** Spürbar bessere Konjunkturerwartung ***
Ähnlich der Konjunkturerwartung legte auch die Einkommenserwartung im Juni spürbar zu. Der Indikator gewann 14,6 auf 34,1 Punkte. Ein besseres Niveau verzeichnete die Einkommensstimmung laut den Angaben zuletzt im Februar 2020 mit 41,2 Zählern, also noch vor der Corona-Krise. Die sinkenden Inzidenzzahlen erlaubten nun auch Öffnungen in der Außen- und Innengastronomie, und eine Reihe von Beschäftigten würden die Kurzarbeit verlassen und verbesserten damit ihre Einkommensposition. „Dies wirkt belebend auf die Einkommenserwartungen.“
*** Moderater Zuwachs der Anschaffungsneigung ***
Die Anschaffungsneigung profitiere von den spürbaren Zuwächsen der Einkommensaussichten, wenn auch wesentlich moderater. Der Indikator gewann 3,4 auf 13,4 Zähler hinzu. Im Gegensatz zur Einkommensstimmung seien die Verbraucher im Hinblick auf ihre Konsumneigung noch etwas vorsichtig. Trotz Öffnungen und Rücknahme von Beschränkungen seien nach wie vor eine Reihe von Branchen – vor allem im Dienstleistungsbereich – stark eingeschränkt. Dies gelte etwa für den Veranstaltungsbereich. Zudem bestehe weiter die Maskenpflicht beim Einkaufen, was nach Einschätzung der Konsumforscher „die Freude am Einkaufserlebnis auch künftig in Grenzen halten“ dürfte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53246835-gfk-konsumklima-verzeichnet-hoechsten-wert-seit-august-015.htm
Ifo-Exporterwartungen der Industrie auf höchstem Stand seit Januar 2011 – Nachholeffekte treiben fast alle Branchen, nur Bekleidungshersteller sind pessimistisch – DJN, 25.6.2021
Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im Juni auf 26,0 Punkte von 22,5 im Mai gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Januar 2011. „Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung deutlich verbessert“, berichtete das Ifo-Institut. „Die Exportwirtschaft profitiert unter anderem von den weltweiten Nachholeffekten der Corona-Krise.“
Nahezu alle Branchen rechnen mit steigenden Exporten. Eine Ausnahme sind die Bekleidungshersteller, die rückläufige Auslandsumsätze erwarten. In der Automobilindustrie haben sich die Exporterwartungen nach dem Rückschlag im Vormonat wieder erholt. Gleiches gilt für die Hersteller von Nahrungsmitteln.
Weiterhin sehr gut aufgestellt sind die Elektrobranche und der Maschinenbau. In der chemischen Industrie sowie der Möbelbranche werden die Zuwächse an Auslandaufträgen allerdings etwas kleiner ausfallen als zuletzt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53246551-ifo-exporterwartungen-auf-hoechstem-stand-seit-januar-2011-015.htm
Hans Bentzien u.a.: Deutschland schüttelt Coronakrise ab: Ifo-Geschäftsklima steigt mit 101,8 Punkten auf höchsten Stand seit November 2018 – Analystenerwartungen wurden übertroffen: Geschäftserwartungen und Lagebeurteilungen jeweils deutlich aufgehellt – Insbesondere Dienstleister und Handel, speziell Einzelhandel optimistischer – Materialmangel als großes Problem: Bauhauptgewerbe bleibt pessimistisch, wenn auch weniger als im Vormonat – dpa-AFX, 24.6.2021
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni erneut deutlich verbessert. Der Index für das Geschäftsklima stieg um 2,6 Punkte auf 101,8 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag bekanntgab. Dies ist der höchste Stand seit November 2018.
Analysten hatten mit einem schwächeren Zuwachs auf 100,7 Punkte gerechnet. Sowohl die Geschäftserwartungen der befragten Unternehmen als auch die Lagebeurteilung hellten sich deutlich auf. „Die deutsche Wirtschaft schüttelt die Coronakrise ab“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.
Im verarbeitenden Gewerbe stieg der Index und erreichte den höchsten Wert seit April 2018. Die Unternehmen waren deutlich zufriedener mit den laufenden Geschäften. Die Erwartungen fielen etwas weniger optimistisch aus. Unter der generell sehr guten Entwicklung in den Industriebranchen ragten insbesondere der Maschinenbau und die Elektroindustrie heraus. Sorgen bereiteten vielen Unternehmen die zunehmenden Engpässe bei Vorprodukten.
Im Dienstleistungssektor machte der Geschäftsklimaindex einen deutlichen Sprung nach oben. Die Indikatoren zu Lage und Erwartungen legten merklich zu. Vor allem die Logistikbranche und die IT-Dienstleister berichteten von sehr gut laufenden Geschäften. Die Dienstleister rechneten mit markant steigenden Umsätzen, auch im krisengeplagten Gastgewerbe.
Im Handel führten die Öffnungen zu einer deutlichen Verbesserung des Geschäftsklimas. Dies war auf merklich besser laufende Geschäfte zurückzuführen. Auch die Erwartungen fielen optimistischer aus. Insbesondere im Einzelhandel war die Entwicklung steil nach oben gerichtet. Der Index zur aktuellen Lage legte so stark zu wie noch nie zuvor.
Im Bauhauptgewerbe stieg der Index leicht. Die Urteile zur aktuellen Lage blieben nahezu unverändert. Die Erwartungen legten zu, blieben aber pessimistisch. Materialknappheit war weiterhin ein sehr großes Problem.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53236267-deutschland-ifo-geschaeftsklima-steigt-auf-hoechsten-stand-seit-november-2018-016.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53236440-ifo-geschaeftsklimaindex-im-juni-etwas-hoeher-als-erwartet-015.htm
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im April kräftig auf höchsten jemals erhobenen Wert für April – Anstieg im April um fast 10 Prozent saison- und kalenderbereinigt, auf Jahressicht 4,1 Prozent – Aufträge wachsen im ersten Jahresdrittel gegenüber dem des Vorjahres um 1,2 Prozent – Auftragswert beträgt 8 Mrd Euro oder nominal 7 Prozent mehr als im April 2020 – DJN, 25.6.2021
Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im April saison- und kalenderbereinigt um 9,8 Prozent gegenüber dem März gestiegen. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 7,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren nominal 7,0 Prozent mehr als im April des Vorjahres und zugleich der höchste jemals gemessene Wert an Neuaufträgen in einem April in Deutschland.
Im Jahresvergleich lag der Auftragseingang kalenderbereinigt um 4,1 Prozent höher. In den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg der reale Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53246949-auftragseingang-im-bauhauptgewerbe-steigt-im-april-kraeftig-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): IMK: Wirtschaft kommt mit Schwung aus der Corona-Krise: BIP-Zunahme 2021e um 4,5 und 2022e um 4,9 Prozent – Lieferengpässe verschieben Aufschwung zeitlich geringfügig in die Zukunft verschoben – Treibende Kräfte 2021: dynamischer Außenhandel, Ausrüstingsinvestitionen und zunehmender Privatkonsum – Arbeitslosigkeit geht zurück in 2021e auf 5,8 und in 2022e auf 5,3 Prozent – Jahresinflation: 2021e 2,5 und 2022e 1,7 Prozent – „Unbestritten tragfähige Verschuldung“: Budgetdefizit geht von 4,3 Prozent auf in 2022e auf 1,7 Prozent zurück – Fiskalhilfen noch aufrechterhalten: Schulden mindern nicht nur Pandemiefolgen, sondern lösen jahrelang aufgelaufenen Investitionsstau auf – DJN, 23.6.2021
Das IMK hat seine Prognose für das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in diesem Jahr auf 4,5 Prozent von bisher erwarteten 4,9 Prozent gesenkt. Für 2022 hob das Düsseldorfer Institut seine Prognose auf 4,9 Prozent von 4,2 Prozent an. „Im Gegensatz zu vielen anderen Instituten haben wir unsere Prognose im Frühjahr nicht zurückgenommen, weil wir von einer starken Erholung mit fortschreitenden Impfzahlen überzeugt waren“, erklärte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Allerdings seien die coronabedingten Einschränkungen länger nötig gewesen als gehofft.
„Der Aufschwung hat sich daher zeitlich etwas verschoben, und daran passen wir unsere Prognose an.“ Das Gesamtbild bleibe aber unverändert positiv. „Die deutsche Wirtschaft kommt mit Schwung aus der Corona-Krise“, erklärte das IMK. Die gegenwärtigen Engpässe bei einigen Rohstoffen und Vorprodukten wie Halbleitern bremsten, aber man rechne damit, „dass die Probleme im Jahresverlauf geringer werden“. Parallel zu steigenden Impfraten, den Lockerungen der Corona-Beschränkungen und hoher Nachfrage aus dem Ausland erhole sich die deutsche Wirtschaft kräftig.
Treibende Kräfte des Wachstums seien in diesem Jahr sowohl der sehr dynamische Außenhandel als auch der wieder zunehmende private Konsum, der 2022 zum dominierenden Wachstumsfaktor werde. Die Investitionen lieferten in beiden Jahren ebenfalls spürbar positive Impulse. Das IMK rechnet mit einem Wachstum der Exporte um 10,9 Prozent im Jahr 2021 und um 7,4 Prozent im nächsten Jahr. Die Importe legen laut der Prognose 2021 um 9,9 Prozent und 2022 um 8,6 Prozent zu.
Nach einem tiefen Einbruch 2020 nehmen die privaten Konsumausgaben 2021 um 2,0 Prozent zu. Für das kommende Jahr prognostiziert das IMK bei weiter sinkender Sparquote ein noch stärkeres Wachstum der privaten Konsumausgaben um 7,0 Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen erholen sich laut der Prognose ebenfalls vom Corona-Schock. Das liege vor allem an der guten Kapazitätsauslastung der Industrie. 2021 nehmen die Ausrüstungsinvestitionen nach den Berechnungen des IMK daher um 9,7 Prozent und 2022 um 6,6 Prozent zu.
*** Arbeitslosigkeit geht zurück ***
Die Zahl der Arbeitslosen sinkt laut der Prognose in diesem Jahr um knapp 40.000 Personen auf 2,66 Millionen Menschen im Jahresmittel und die Arbeitslosenquote geringfügig auf 5,8 Prozent. 2022 gehe die Arbeitslosigkeit dann deutlicher auf gut 2,43 Millionen zurück, die Quote werde im Jahresdurchschnitt bei 5,3 Prozent liegen.
Die Inflation steige in diesem Jahr erstmals seit längerem zwar über das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp 2 Prozent auf 2,5 Prozent im Jahresmittel. Da dafür neben dem Wirtschaftsaufschwung aber auch temporäre Sonderfaktoren wie die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz eine Rolle spielten, werde die Teuerungsrate im kommenden Jahr wieder auf 1,7 Prozent zurückgehen.
Da der Staat zur Krisenbekämpfung weiterhin sehr viel Geld einsetze, Anfang 2021 der Solidaritätszuschlag für die meisten Steuerzahler abgeschafft und einige andere Steuern sowie die EEG-Umlage gesenkt worden seien und sich die Einnahmen generell erst langsam erholten, ergebe sich 2021 ein Budgetdefizit von 4,3 Prozent des BIP. Im kommenden Jahr werde sich die erwartete konjunkturelle Belebung dann stärker positiv auf die öffentlichen Haushalte auswirken, und zudem wirke die Fiskalpolitik weniger expansiv, sodass das Defizit auf 1,4 Prozent zurückgehe.
Das IMK riet, die aktivere Fiskalpolitik beizubehalten. Denn erstens erlaube nur ein länger anhaltender, europaweiter Aufschwung der EZB, ihre expansive Geldpolitik mit Nullzinsen und Ankaufprogrammen mittelfristig zurückzunehmen, und zweitens bestehe in Deutschland weiterhin ein großer Bedarf, den in vielen Jahren entstandenen öffentlichen Investitionsstau aufzulösen. Der staatliche Schuldenstand sei im Zuge der Antikrisenpolitik zwar deutlich gestiegen, „aber unbestritten tragfähig“, betonte das Institut.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53223556-imk-wirtschaft-kommt-mit-schwung-aus-der-corona-krise-015.htm
BDI erhöht Prognose für BIP-Wachstum 2021 auf 3,5 Prozent – Binnenkonjunktur läuft: Nachholeffekte im Privatkonsum, Investitionen und wachsende Auslandsgeschäfte machen sich bemerkbar – Industrieproduktion soll um 8 Prozent zulegen – BIP-Rückkehr auf Vorkrisenniveau noch in 2021Q4e – Pandemie und Lieferengpässe als Risikofaktoren – Mangelwirtschaft droht, aber nicht lange: Mangel an Chips, Kunststoffen, Verpackungsmaterial, Stahl und Metallen – DJN, 22.6.2021
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr erhöht. Der BDI erwartet nun ein wirtschaftliches Wachstum von 3,5 Prozent. Im April war der Verband noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,0 Prozent ausgegangen.
„Unseren Optimismus ziehen wir aus einer erwarteten Belebung der Binnenkonjunktur aufgrund von Nachholeffekten im privaten Konsum und aufgrund deutlich steigender Investitionen sowie aus dem Auslandsgeschäft, wo wir eine starke Erholung in Asien erwarten und von den Konjunkturpaketen in den USA profitieren dürften“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm beim Tag der Industrie in Berlin.
Die Industrieproduktion dürfte in diesem Jahr um 8 Prozent steigen, so der BDI. Das deutsche BIP sollte damit im vierten Quartal dieses Jahres auf Vorkrisenniveau zurückkehren. Allerdings gebe es Abwärtsrisiken, die die wirtschaftliche Erholung bedrohten, warnte der BDI. Dazu zählt der Verband als entscheidenden Faktor die Corona-Pandemie.
Als eine weitere Gefahr für die konjunkturelle Erholung nannte der BDI-Präsident zunehmende Lieferengpässe und Rohstoffknappheiten. „Chipmangel führt in der Automobilindustrie bereits zu teils weitreichenden Produktionseinschränkungen“, so Russwurm. Die Probleme beträfen die gesamte Lieferkette. Auch mangele es an Kunststoffen, Verpackungsmaterial, Stahl und Metallen. Allerdings zeigte er sich zuversichtlich, dass dieses Thema der deutschen Industrie zumindest nicht langfristig Probleme bereiten werde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53211193-bdi-erhoeht-prognose-fuer-bip-wachstum-2021-auf-3-5-prozent-015.htm
Bundesbank: Erspartes treibt Wachstum an – Auf Corona-Flaute folgt Corona-Boom – Abschwächung des Konmunkturbooms erst 2023 – Langfristig Rückkehr der Sparquote auf 10 Prozent erwartet – n-tv, 21.6.2021
In der Corona-Pandemie halten viele Deutsche möglichst ihr Geld zusammen – wegen der Ungewissheit, aber auch wegen mangelnder Möglichkeiten, es auszugeben. Doch das gesparte Geld dürfte nun zum Treiber des Wirtschaftswachstum werden
Der von der Pandemie ausgebremste private Konsum dürfte nach Einschätzung der Bundesbank nun zu einem kräftigen Treiber für den Wirtschaftsaufschwung werden. „Im laufenden Sommerhalbjahr sollte sich der private Konsum schnell erholen“, erklärt die Notenbank in ihrem Monatsbericht für den Juni, den sie nun vorgelegt hat.
Die Ökonomen der Bundesbank gehen davon aus, dass sich das starke Wirtschaftswachstum nach dem Corona-Tiefschlag erst im Jahr 2023 abschwächen wird. Vor allem der private Konsum werde weiterhin „außerordentlich kräftig“ zulegen: „Er bleibt die maßgebliche Triebfeder des starken Aufschwungs.“ Im Krisenjahr 2020 hielten viele Menschen ihr Geld zusammen, Schließungen im Einzelhandel und Reisebeschränkungen bremsten den Konsum zudem.
Die Sparquote in Deutschland stieg nach neuester Berechnung des Statistischen Bundesamtes auf das Rekordhoch von 16,2 Prozent. Heißt: Von 100 Euro verfügbarem Einkommen legten die Haushalte im Schnitt gut 16 Euro auf die hohe Kante. In einer Umfrage der Bundesbank im März gab die Hälfte der 2402 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, in den vorangegangenen zwölf Monaten am Monatsende im Durchschnitt mehr Geld übriggehabt zu haben als vor der Pandemie.
*** Ein Viertel der Ersparnisse für den Konsum? ***
Viele Volkswirte rechnen damit, dass Verbraucher in den kommenden Monaten zumindest einen Teil aufgeschobener Anschaffungen, Reisen und Unternehmungen nachholen werden – und damit die Konjunktur anschieben. Die Bundesbank führt aus, es werde angenommen, dass vor allem in diesem und im nächsten Jahr „etwa ein Viertel der Ersparnisse, die während der Pandemie unfreiwillig gebildet wurden, (…) für zusätzliche Konsumausgaben verwendet wird“.
Langfristig dürfte die Sparquote in Deutschland somit „wieder ein ähnliches Niveau erreichen wie vor der Pandemie“. 2019 betrug die Quote 10,9 Prozent. Insgesamt erwartet die Bundesbank nach dem Rückschlag im ersten Quartal 2021 schon im Frühjahr wieder einen kräftigen Anstieg der Wirtschaftsleistung in Deutschland – vor allem weil Dienstleistungsbereiche wie Gastgewerbe und Handel nach Auslaufen der Corona-Einschränkungen wieder bessere Geschäfte machen.
Die aktuellen Belastungen der Industrie durch Lieferengpässe dürften sich nach Einschätzung der Bundesbank „in Grenzen halten“. Ihre neuesten Prognosen für das Gesamtjahr 2021 sowie die Folgejahre hatte die Notenbank bereits Mitte Juni veröffentlicht. Demnach legt das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in kalenderbereinigter Betrachtung 2021 um etwas unter vier Prozent zu, 2022 dann um gut fünf Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft in die tiefste Rezession seit der globalen Finanzkrise 2009 gerissen. Das BIP brach real um 4,8 Prozent ein.
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Auf-Corona-Flaute-folgt-Corona-Boom-article22633580.html
Deutschland: Renten dürften im kommenden Jahr wieder steigen – Beitragseinnahmen der Rentenversicherung stiegen im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent – Beitragssatz bleibt bis 2022 konstant – Maximaler Beitragssatz von 20 Prozent wird auch bis 2025 nicht erreicht – Rentenversicherungspräsidentin spricht von bewährtem Umlagensystem: negative Langfristvoraussagen zur Lage der Pensionsversicherer bislang nicht eingetroffen – dpa-AFX, 24.6.2021
Nach der Renten-Nullrunde in diesem Jahr können sich die Rentnerinnen und Rentner im kommenden Jahr voraussichtlich wieder auf steigende Bezüge einstellen. „Steigen die Löhne in diesem Jahr wie erwartet, wird es im nächsten Jahr voraussichtlich wieder eine positive Rentenanpassung geben“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Anja Piel, am Donnerstag bei einer Bundesvertreterversammlung. Genaueres wisse man derzeit aber noch nicht. „Die Höhe steht erst im Frühjahr 2022 fest“, sagte Piel.
Aufgrund des Corona-Einbruchs stagnieren die Renten in diesem Jahr im Westen. In den neuen Bundesländern steigen die Renten zum 1. Juli um 0,7 Prozent.
Die Einnahmen der Rentenversicherung aus Beiträgen stiegen im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent. Nach den aktuellen Schätzungen dürften sich die Pflichtbeiträge im Jahr 2021 um 1,9 Prozent erhöhen. Diese Entwicklung weise auf eine langsame Normalisierung hin, so Piel.
Nach den aktuellen Vorausberechnungen bleibe der Beitragssatz mindestens noch 2022 konstant. „2023 könnte eine kleine Anhebung auf 18,7 Prozent erforderlich sein“, so Piel. Im Oktober 2020 war für 2023 noch ein Beitragssatz von 19,3 Prozent prognostiziert worden.
Der laut Gesetz maximale Beitragssatz von 20 Prozent werde bis 2025 aus heutiger Sicht nicht erreicht. Auch beim Rentenniveau werde die Haltelinie von 48 Prozent bis 2025 eingehalten. Im laufenden Jahr betrage das Rentenniveau 49,4 Prozent. Durch einen statistischen Effekt werde das Rentenniveau dabei ab dem 1. Juli 2021 rechnerisch um rund einen Prozentpunkt höher ausgewiesen.
Rentenversicherungspräsidentin Gundula Roßbach nannte es wichtig, die Rentendiskussion ruhig und sachlich zu führen. Sie warnte davor, immer wieder negative Prognosen zur Rentenversicherung herauszugeben, wenn bei den Menschen nicht deutlich wird, dass sie auf spekulativen Annahmen basieren. Viele negative Langfristvoraussagen zur Rente in der Vergangenheit hätten sich nicht bewahrheitet. Die umlagefinanzierte Rentenversicherung habe sich gerade auch in schwierigen Zeiten bewährt, zuletzt in der Finanzkrise und während der Corona-Pandemie.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53237800-deutschland-renten-duerften-im-kommenden-jahr-wieder-steigen-016.htm
Deutschland: Grundrente nur für Neurentner – Verzögerte Auszahlung: hoher Verwaltungsaufwand und kompliziertes Verfahren lassen Details noch im Dunkeln – 1,3 Mio Menschen profitieren künftig von Grundrente – dpa-AFX, 25.6.2021
Mit Beginn der Auszahlungen der Grundrente in diesem Juli werden zunächst nur Neurentner von dem Zuschlag profitieren. So genannte Bestandsrentner, die Anspruch darauf haben, müssen mit der Auszahlung bis zu einem Jahr und länger warten. Die Deutsche Rentenversicherung bekräftigte im Magazin „Spiegel“ dieses Verfahren. Demnach sind Rentner, die schon länger im Ruhestand sind, bis Ende 2022 an der Reihe. Wie viele Versicherte die Grundrente zu Beginn erhalten, ließ die Rentenkasse dem Bericht zufolge noch offen.
Hintergrund ist das komplizierte Verfahren und der Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung der Grundrente. Die Rentenversicherung muss nach früheren Angaben aus den knapp 26 Millionen Renten mit Hilfe von Daten der Finanzämter diejenigen herausfiltern, bei denen ein Anspruch besteht. In Kraft ist das Gesetz seit Januar. Rentner, die Anspruch haben, bekommen den Zuschlag rückwirkend zum Januar ausgezahlt.
Von der Grundrente sollen etwa 1,3 Millionen Menschen mit geringen Altersbezügen profitieren. Im Schnitt gibt es einen Zuschlag von 75 Euro. Der rentenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, sagte am Freitag, Sozialminister Hubertus Heil (SPD) habe mit seinem Lieblingsprojekt vor allem verwaltungstechnisches Chaos erreicht. Erst 2023 würden alle Menschen mit Anspruch erreicht. „Das ist schlichtweg keine gute und verlässliche Politik.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53252149-deutschland-grundrente-nur-fuer-neurentner-016.htm
Hans Bentzien: Bundesbank: Deutsche Wirtschaft wächst im 2. Quartal kräftig – Lockerungen und sich erholender Dienstleistungsektor als Treiber – Lieferkettenprobleme und konsekutive Materialknappheiten bremsen – DJN, 21.6.2021
Die deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal nach Aussage der Bundesbank kräftig gewachsen sein. „Zuzuschreiben ist dies vor allem dem Dienstleistungssektor“, schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Bereits im Mai seien viele der zuvor verhängten coronabedingten Einschränkungen entweder erheblich gelockert oder sogar vollständig aufgehoben worden. „Davon dürften vor allem Dienstleistungsbereiche wie das Gastgewerbe und der Handel profitieren“, so die Bundesbank.
Andererseits prägen laut Bundesbank weitere Belastungen, die nur indirekt mit der Pandemie zusammenhängen, die wirtschaftliche Aktivität. „Verstärkte Lieferengpässe – vor allem bei Vorprodukten wie Halbleitern – bremsen wie schon im ersten Quartal die Produktion insbesondere in der Autoindustrie“, merkt die Bundesbank an.
Über Materialknappheit bei Vorprodukten wie Holz, Stahl und Dämmmaterialien sei zuletzt auch in der Baubranche vermehrt berichtet worden. Gleichwohl erwarte die Mehrzahl der Industrieunternehmen laut jüngsten Umfragen des Ifo-Instituts eine weitere Verbesserung ihrer Geschäftstätigkeit. „Dies spricht dafür, dass sich die Belastungen durch die Lieferengpässe in Grenzen halten.“
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im ersten Quartal um 1,8 Prozent gesunken.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53202217-bundesbank-deutsche-wirtschaft-waechst-im-2-quartal-kraeftig-015.htm
Olaf, Ridder (WSJ): Rohstahlproduktion Deutschland im Mai im Vergleich zum April stark gestiegen – Nach Corona-Absturz: anhaltende Zuwächse seit Oktober 2020 – DJN, 22.6.2021
Die Stahlerzeugung in Deutschland hat im Mai gegenüber April deutlich angezogen. Insgesamt 3,7 Millionen Tonnen Rohstahl meldete die Wirtschaftsvereinigung Stahl, das sind 300.000 Tonnen oder 9 Prozent mehr als im Vormonat. Gegenüber dem massiv vom ersten Corona-Lockdown geprägten Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg von 43 Prozent. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden 15 Prozent mehr Rohstahl produziert.
Mit Ausnahme des Monats Februar verzeichnete die deutsche Stahlindustrie seit Oktober vergangenen Jahres wieder Zuwächse – im März war mit 3,8 Millionen Tonnen dabei der höchste Wert erreicht worden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53211281-rohstahlproduktion-deutschland-im-mai-stark-gestiegen-015.htm
Andreas Plecko: Deutsche Exporte in Drittstaaten sinken im Mai um 3,0 Prozent – Exporte in Drittstaaten 5,8 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020 – Exportwaren-Wert im Mai 48 Mrd Euro: Anstieg um 28 Prozent auf Jahressicht – USA und China als wichtigste Exportländer mit starken basiseffektbedingten Zuwächsen im Jahresvergleich – DJN, 24.6.2021
Die deutschen Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind im Mai gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt voraussichtlich um 3,0 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines neuen monatlichen Frühindikators mitteilte, lagen die Exporte in Drittstaaten kalender- und saisonbereinigt 5,8 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.
Der Indikator erlaubt die Schätzung erste Ergebnisse für Exporte in Nicht-EU-Staaten bereits 20 bis 25 Tage nach Monatsende und damit mehr als zwei Wochen früher als bisher.
Nach vorläufigen Ergebnissen wurden im Mai Waren im Wert von 48,4 Milliarden Euro in Drittstaaten exportiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2020 stiegen die Exporte im Mai 2021 um 27,9 Prozent.
Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure waren im Mai die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 9,1 Milliarden Euro exportiert. Damit stiegen die Exporte in die Vereinigten Staaten gegenüber Mai 2020 um 40,9 Prozent. In die Volksrepublik China wurden Waren im Wert von 8,4 Milliarden Euro exportiert, das waren 17,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Exporte in das Vereinigte Königreich stiegen im Vorjahresvergleich um 44,6 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Die starken Anstiege begründen sich auch durch das sehr niedrige Außenhandelsniveau im Mai 2020.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53234691-deutsche-exporte-in-drittstaaten-sinken-im-mai-um-3-0-prozent-015.htm
Einzelhandel: Pandemie-Profiteure: Oxfam beklagt Unfairness: Supermärkte machen Kassen, Nahrungsmittelerzeuger kämpfen um ihre Existenz – Handel gewinnt: Kaffee- und Teehandel als Beispiele – Arbeiter in Ursprungsländern als Verlierer – Lieferkettengesetz: Oxfam fordert Nachbesserung in Deutschland und Regulierung durch EU – Deutsche Welle, 21.6.2021
Laut einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam haben die Profite deutscher Supermarktketten während der Corona-Pandemie zugelegt. Dagegen habe sich die Situation der zuliefernden Bauern weltweit verschlechtert.
Im Corona-Jahr 2020 seien die Supermärkte zu „Krisengewinnern“ geworden, heißt es in der neuen Oxfam-Studie „Pandemie-Profiteure und Virus-Verliererinnen“. Laut Oxfam-Recherchen konnten deutsche Discounter wie Aldi und Lidl ihre Umsätze um neun Prozent steigern, klassische Supermärkte wie Rewe und Edeka sogar um 17 Prozent. Nach stärker haben laut Bericht die Vermögen einiger Supermarkt-Eigentümer zugenommen. So sei das Vermögen der beiden Haupteigentümer von Aldi Süd, Beate Heister und Karl Albrecht Junior, um fast 30 Prozent auf knapp 25 Milliarden gewachsen. Bei Dieter Schwarz, dem die Ketten Kaufland und Lidl gehören, habe der Anstieg sogar mehr als 30 Prozent betragen, sein Vermögen wird auf rund 30 Milliarden Euro geschätzt. „Während die Supermarktketten Kasse machten, kämpfen die Arbeiterinnen, die unser Essen herstellen, um ihre Existenz“, sagt Tim Zahn, Oxfam Experte für Wirtschaft und Menschenrechte.
Oxfam-Berechnungen für Kaffee aus Brasilien, Tee aus Indien und Wein aus Südafrika zeigen, dass Bauern und Landarbeiter immer weniger vom Preis bekommen, den Konsumenten in deutschen Supermärkten bezahlen.
Nur rund ein Prozent
Den Oxfam-Berechnungen zufolge erhielten Arbeiterinnen auf Traubenplantagen in Südafrika und auf Teeplantagen im indischen Bundesstaat Assam nur rund ein Prozent des Verkaufspreises. Das entspricht im Beispiel der Teepfückerinnen in Assam einem Tageslohn von umgerechnet 1,91 Euro.

GRAPHIK „Tee“: https://static.dw.com/image/57987773_7.png
Auf den Kaffeeplantagen im brasilianischen Minas Gerais liegen die Löhne laut Oxfam um 40 Prozent unter einem existenzsichernden Niveau.
„Dabei wäre Geld genug da“, so Tim Zahn. „Allein die Pandemiegewinne der Eigentümer von Aldi Süd hätten ausgereicht, um rund vier Millionen Beschäftigten im brasilianischen Kaffee-Sektor existenzsichernde Löhne zu zahlen.“
„Moderne Sklaverei“
Den Oxfam-Recherchen zufolge gab es auf Kaffeeplantagen in Brasilien besonders drastische Fälle von Ausbeutung. Arbeiterinnen und Arbeiter berichteten von Unterkünften ohne fließendes Wasser, extremer körperlicher Arbeit und fehlendem Schutz gegen Pestizide oder das Coronavirus. Obwohl einige Plantagenbesitzer wegen „moderner Sklaverei“ auf einer Liste der brasilianischen Regierung stünden, habe Oxfam Belege für ihre Verbindungen zu deutschen Supermarktketten.

GRAPHIK „Kaffee“: https://static.dw.com/image/57987779_7.png
Die Entwicklungsorganisation fordert zum einen eine bessere Behandlung und Bezahlung der Arbeiter. Außerdem müssten die Supermarktketten „ihr Geschäftsmodell verändern, so dass die Beschäftigten in den globalen Lieferketten von ihrer Arbeit leben können und ihre Rechte geachtet werden“.
Das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Lieferkettengesetz sei ein erster Schritt, doch nur eine Minimallösung. Die Bundesregierung müsse hier nachbessern und sich zudem für eine weitreichendere Regelung in der EU einsetzen. (bea/ul/ack (Oxfam))
QUELLE: https://www.dw.com/de/pandemie-profiteure-oxfam-beklagt-unfairness/a-57983017
Corona bremst Innovationen im Mittelstand: angespannte Liquiditätslage und unsicherer Zukunftausblick als Hemmschuhe – KfW-Chefvolkswirtin mahnt: „Wir können es uns nicht leisten, zurückhaltend zu handeln“ – Kontinuierlicher Verlust an Innovationskraft seit 15 Jahren, Finanzierungsschwäche als Ursache – Personalmangel verschärft Innovationsschwäche – Förderungen nötig – Pressetext, 24.6.2021
Deutsche Unternehmen verlieren seit eineinhalb Jahrzehnten kontinuierlich ihre Innovationskraft. Verbliebene Neuentwicklungen kommen zudem fast nur noch von Großunternehmen. Dieser Trend hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 verfestigt. So gingen die Innovationsaktivitäten im Mittelstand laut aktuellem KfW-Innovationsbericht http://kfw.de nach einem kurzen Schub zu Beginn der Krise weiter zurück. Inzwischen haben drei von zehn KMU ihre Innovationsanstrengungen gegenüber 2019 gedrosselt. Dem stehen nur zwölf Prozent der Mittelständler mit gesteigerten Innovationsaktivitäten gegenüber.
*** Finanzierung als Hemmschuh ***
„Auch nach Überwindung der akuten Krisenphase dürfte Finanzierung als Innovationshemmnis weiter an Bedeutung gewinnen. Aufgrund der angespannten Liquiditätslage und der höheren Verschuldung der Unternehmen verschärft sich der Zielkonflikt zwischen dem Wunsch nach einer höheren Resilienz einerseits, und der Notwendigkeit zu verstärkten Investitionen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit anderseits“, sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.
Mehr finanzielle Anreize seien nötig, um für einen Innovationsschub zu sorgen. Auch bremse weiter gerade in der Breite des Mittelstands der Fachkräftemangel die Innovationstätigkeit. Fördermaßnahmen zum Aufbau der Innovationskompetenz dieser Unternehmen müssten daher ausgeweitet werden. „Innovationen sind entscheidend für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, wie etwa Klimawandel, Gesundheitsfürsorge oder demografische Entwicklung. Wir können es uns nicht leisten, zurückhaltend zu handeln“, so Köhler-Geib.
*** Erst einmal die Krise meistern ***
Der heute, Donnerstag, vorgestellte „Innovationsbericht Mittelstand 2020“ zeigt die Lage auf. So waren es im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem KMU mit weniger als fünf Beschäftigten, die sich aus der Innovationstätigkeit zurückgezogen haben. Gerade die schwierige Finanzlage und die unsicheren Perspektiven, die die Pandemie für viele Firmen mit sich bringt, wirken sich aus: Firmen verzichten – unabhängig von ihrer Mitarbeiterzahl – verstärkt auf Innovationen, wenn sie existenziell von der Krise betroffen sind und ausgeprägte Liquiditätsengpässe aufweisen. Gleiches gilt für jene, die mit einer langen Krisendauer rechnen, heißt es in dem Bericht.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210624010
SIEHE DAZU
Innovationsbericht Mittelstand 2020 der KfW
QUELLE (33-Seiten-PDF): http://bit.ly/3zSX6Dp
Florian Fügemann: Deutsche Immobilienpreise steigen weiter – Wohnimmobilien steigen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,4 Prozent – Wohnungen in Großstädten über 100.000 Einwohnern im Vorjahresquartalsvergleich um 11,3 Prozent teurer – Nach starkem Anstieg in 2020: Nebenkosten für Immobilienerwerb leicht gesunken – Neuregelung der Aufteilung von Maklerkosten wirkt kostensenkend – Pressetext, 25.6.2021
Deutschlands Wohnimmobilienpreise sind im ersten Quartal 2021 binnen Jahresfrist um 9,4 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt http://destatis.de mitteilt, ist diese Preisentwicklung sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen zu beobachten. Stark kletterten die Preise für Wohnungen in Großstädten über 100.000 Einwohnern mit plus 11,3 Prozent und in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) mit plus 11,1 Prozent sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen (plus 11,3 Prozent).
*** Nebenkosten leicht gesunken ***
Die Nebenkosten für den Erwerb einer Immobilie sind für Käufer aufgrund des am 23.12.2020 in Kraft getretenen Gesetzes über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Während sie zwischen dem vierten Quartal 2019 und dem vierten Quartal 2020 noch deutlich angestiegen waren (plus 7,9 Prozent), sanken sie zum 1. Quartal 2021 um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal.
Für den bundesweiten Häuserpreisindex im Jahr 2020 ergibt sich eine Revisionsdifferenz von 0,5 Prozentpunkten bezogen auf die Veränderungsrate zum Vorjahr (vorläufiger Wert: plus 7,3 Prozent, revidierter Wert plus 7,8 Prozent), wie die Wiesbadener Statistiker informieren. „Es ist davon auszugehen, dass die Veränderungsraten zum Vorquartal in den jeweils ersten Quartalen eines Jahres derzeit (insbesondere außerhalb der Metropolen) leicht unterschätzt werden“, verdeutlicht das Bundesamt abschließend.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210625014
SIEHE DAZU: Deutsche Wohnimmobilien verteuern sich weiter – DJN, 25.6.2021
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53247041-deutsche-wohnimmobilien-verteuern-sich-weiter-015.htm
Staatliche Verschuldung Deutschlands: Anleihe-Rekordvolumen am Kapitalmarkt für 2021 vorgesehen – CORONA SPEZIAL HANDELSBLATT MORNING BRIEFING, 21.6.2021
Der Bund muss sich am Kapitalmarkt im Sommer wegen der Corona-Kosten mehr Geld leihen als vorgesehen. Geplant sei die zusätzliche Aufnahme von zwei Milliarden Euro, wie die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur mitteilte. Insgesamt will sich der Bund in diesem Jahr das Rekordvolumen von mehr als 480 Milliarden Euro von Investoren leihen.
QUELLE nicht verlinkbar
Andreas Kißler (WSJ): Steuereinnahmen auch im Mai deutlich über Vorjahr – Relativierung der Frohbotschaft: Basiseffekt „schönt“ Steuereinnahmszuwachs – Erfreulicher Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Aktivität – DJN, 21.6.2021
Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai vor dem Hintergrund eines coronabedingt schwachen Vorjahres um 19,1 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. „Beim Vergleich ist dabei zu beachten, dass das Steueraufkommen im Vorjahresmonat erneut deutlich durch die steuerlichen Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (wie Stundungen) gemindert war“, erklärte das Ministerium.
Gegenüber Mai 2019 – also dem entsprechenden Monat im Vorkrisenjahr – lagen die Steuereinnahmen laut den Angaben um 4,6 Prozent beziehungsweise rund 2,4 Milliarden Euro niedriger. Im April waren die Steuereinnahmen bereits vor dem Hintergrund eines coronabedingt deutlich geminderten Aufkommens im Vorjahresmonat um 31,9 Prozent in die Höhe geschossen. Im März hatten sie um 0,9 Prozent zugelegt.
Der Bund verbuchte im Mai 29,1 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 20,6 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 23,4 Milliarden Euro um 20,4 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Mai auf rund 50,0 Milliarden Euro. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 nahmen die Steuereinnahmen insgesamt um 4,2 Prozent auf 273,4 Milliarden Euro zu. Der Bund verbuchte dabei ein Minus von 0,4 Prozent, und die Länder verzeichneten einen Zuwachs von 6,9 Prozent.
*** Indikatoren deuten auf Anstieg gesamtwirtschaftlicher Aktivität
Für die weitere Konjunkturentwicklung erklärten die Ökonomen des Ministeriums, insgesamt deuteten die Indikatoren „nun auf einen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Aktivität im zweiten Quartal hin, nachdem die deutsche Wirtschaft in das Jahr 2021 pandemiebedingt mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gestartet ist“. In der Industrie dürfte sich im April die nach wie vor bestehende Knappheit wichtiger Vorprodukte dämpfend bemerkbar gemacht haben.
„Exporterwartungen, Auftragseingänge und das Geschäftsklima sehen die Industrie aber weiterhin auf Expansionskurs“, betonte das Finanzministerium. In den durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stärker eingeschränkten Wirtschaftsbereichen habe sich angesichts der deutlich gesunkenen Infektionszahlen im Mai die Stimmung spürbar aufgehellt. Der Einzelhandel habe seine Zukunftsaussichten deutlich positiv eingeschätzt und die Kurzarbeit reduziert.
Am Arbeitsmarkt hätten sich positive Signale im Einklang mit einer einsetzenden Erholung gezeigt. „Neben der insgesamt rückläufigen Kurzarbeit sank auch die Arbeitslosigkeit“, betonten die Konjunkturexperten des Ministeriums. Zur Inflation erklärten sie, auch in den nächsten Monaten dürften Sonder- und Basiseffekte noch spürbar zur Inflationsrate beitragen, wenn auch in etwas schwächerer Form als aktuell. Gleichzeitig ergebe sich im zweiten Halbjahr ein kurzfristig deutlich inflationssteigernder Effekt daraus, dass das Preisniveau im Vergleichszeitraum durch die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze niedriger gewesen sei.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53208471-steuereinnahmen-auch-im-mai-deutlich-ueber-vorjahr-015.htm
Steuerpläne von CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP: Wer profitiert und wer verliert – Vergleichsstudie – Institut der deutschen Wirtschaft, 22.6.2021
Drei Monate vor der Bundestagswahl haben die meisten Parteien ihre Pläne für eine Einkommensteuerreform vorgelegt. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, was die Pläne von CDU/CSU, SPD, FDP, Grünen und Linken für Singles, Ehepaare und Alleinerziehende bedeuten würden.
[Es folgt eine Kurzzusammenfassung der Stuervorhaben der einzelnen Parteien und eine tabellarische Übersicht.]
QUELLE: https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/martin-beznoska-tobias-hentze-wer-profitiert-und-wer-verliert.html
SIEHE DAZU
Tabellarische Übersicht: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Grafik_Tarife_Bundestagswahl-IW-Medien.jpg
Studie (3-Seiten-PDF): https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/martin-beznoska-tobias-hentze-wer-profitiert-und-wer-verliert.html
Deutschland: Fünf Millionen Beschäftigte im Staatsdienst – Zuwachs bei Kitas und Polizei – Pandemie-Effekt trifft besonders Hochschulen: geringfügig Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Sinkflug – dpa-AFX, 22.06.21
In Deutschland waren Mitte 2020 rund fünf Millionen Menschen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Damit arbeiteten etwa elf Prozent aller Erwerbstätigen hierzulande im Staatsdienst, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vorjahresvergleich wurde ein leichter Zuwachs von 83 200 Beschäftigten oder 1,7 Prozent verzeichnet.
Besonders in Kitas und bei der Polizei gab es demnach steigende Zahlen. In den Kindertagesstätten stieg die Personalzahl innerhalb von zwölf Monaten um 4,4 Prozent auf 243 600. Zwischen 2010 und 2020 wurde bei den Erzieherinnen und Erziehern sogar ein Anstieg von 61 Prozent verzeichnet. Bei der Polizei kam es den Angaen zufolge binnen eines Jahres zu einem Zuwachs von 2,1 Prozent auf insgesamt 341 400 Beschäftigte. Das war nach 2017 der zweitgrößte Anstieg seit Mitte der 1990er Jahre.
Deutlich gesunken ist dagegen die Zahl der geringfügig Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Diese war Mitte letzten Jahres 7,8 Prozent niedriger als zwölf Monate zuvor. „Dieser Rückgang ist insbesondere auf die Hochschulen, wo auch die meisten geringfügig Beschäftigten beschäftigt sind, und den kommunalen Bereich zurückzuführen und dürfte bereits ein Effekt der Corona-Pandemie sein“, hieß es.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53211945-deutschland-fuenf-millionen-beschaeftigte-im-staatsdienst-zuwachs-bei-kitas-016.htm
Deutschland: Frauen kommen auf immer mehr Arbeitsjahre bis zur Rente: von 27,7 Jahre im Jahr 2000 auf zuletzt 36,3 Jahre – Vermehrte Erwerbsbeteiligung der Frauen und weniger Möglichkeiten der Frühverrentung als Ursachen – dpa-AFX, 21.6.2021
Frauen in Deutschland bekommen für immer mehr Arbeitsjahre Rente ausgezahlt. So stieg bei den Frauen die Dauer der gesetzlichen Rentenabsicherung vor dem Ruhestand auf durchschnittlich 36,3 Jahre im vergangenen Jahr an, wie aus neuen Daten der Rentenversicherung hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen. Im Jahr 2000 kamen Frauen bei Beginn ihrer Altersrente erst auf durchschnittlich 27,7 Versicherungsjahre. 2019 waren es 35,3.
Besonders deutlich ist der Anstieg bei Frauen in den alten Bundesländern. Hier nahm die Anzahl der durchschnittlichen Versicherungsjahre zwischen 2000 und 2020 von 24,2 auf 34,5 Jahre zu. In Ostdeutschland stieg die Dauer von 40,9 auf 43,1 Jahre. Hier waren Frauen schon zu DDR-Zeiten weit stärker im Arbeitsleben verwurzelt.
„Die Zunahme der Versicherungsjahre ist hauptsächlich auf eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen zurückzuführen“, sagte der Vorsitzende der Bundesvertreterversammlung der Rentenversicherung, Jens Dirk Wohlfeil, der dpa. Das Gremium tagt an diesem Donnerstag. Zu Buche schlage außerdem, dass es weniger Möglichkeiten als früher gebe, vorzeitig in Rente zu gehen. Früher war Rente teils schon mit 60 Jahren möglich. Auch wirke sich bei Rentnerinnen die erhöhte Anrechnung von Kindererziehungszeiten durch die Mütterrente aus.
Zu den Versicherungsjahren zählen neben Zeiten der Erwerbstätigkeit zum Beispiel auch Zeiten der Kindererziehung, des Sozialleistungsbezugs und der Pflege.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53201332-deutschland-frauen-kommen-auf-immer-mehr-arbeitsjahre-bis-zur-rente-016.htm
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“: Berufliche Aus- und Weiterbildung benötigt digitale Modernisierung – Raschere digitale Berufsausbildung und langfristiger, finanziell gestützter Pakt für berufsbildende Schulen sinnvoll – Gut und flexibel integriert im Arbeitsalltag: Unternehmen setzten schon jetzt erfolgreich verstärkt E-Learning-Formate ein – Kontraproduktiv wirkt der Ruf nach verstärkter Verrechtlichung der Weiterbildung – Institut der deutschen Wirtschaft, 22.6.2021
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ widmete sich fast drei Jahre lang der Frage, welche Bedeutung die berufliche Bildung für den Wirtschaftsstandort Deutschland hat. Heute hat die Kommission ihren 650-seitigen Bericht im Rahmen einer Abschlussveranstaltung dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble übergeben. Der Bericht identifiziert vor allem zwei große Handlungsfelder.
Für die digitale Berufsausbildung braucht es mehr Geschwindigkeit. Der Investitionsbedarf in den Berufsschulen übersteigt die verfügbaren Mittel des DigitalPakts Schule schon heute. Um Planungssicherheit zu schaffen, Lehrkräfte zu entlasten und die Modernisierung zu beschleunigen, muss ein langfristiger Pakt für berufsbildende Schulen aufgelegt werden. Diese Unterstützung muss auf Dauer angelegt sein, IT-Fachkräfte finanzieren und didaktische Konzepte fördern. Nur so lassen sich modernste Technologien aus der Berufspraxis berücksichtigen, nur so werden Lehrer und Ausbilder bestmöglich qualifiziert und nur so können Berufsschulen Innovationen ermöglichen.
Die Ausgaben für berufliche Weiterbildung haben stark zugenommen, die Weiterbildungsförderung in Deutschland ist breit aufgestellt und wurde durch die neuen Fördergesetze deutlich ausgebaut. Allerdings hat die Corona-Krise den Strukturwandel beschleunigt und dazu geführt, dass Unternehmen immer öfter E-Learning-Formate nutzen, vor allem, weil sie sich gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Informelles, mediengestütztes Lernen bietet eine hohe zeitliche und räumliche Flexibilität, die es weiter zu stärken gilt. „In eine falsche Richtung weisen hingegen Vorschläge von Teilen der Kommission zu einem Systemwandel in der Weiterbildung mit einem eigenen Weiterbildungsgesetz“, sagt IW-Geschäftsführer Hans-Peter Klös, der als Sachverständiger für die FDP an dem Kommissionsbericht mitgewirkt hat. „Auch erweiterte Rechts- und Freistellungsansprüche auf Weiterbildung, ein Bildungsgrundeinkommen, Weiterbildungsfonds oder die Einführung einer Arbeitsversicherung sind kontraproduktive Ideen.“
QUELLE: https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/beitrag/hans-peter-kloes-digitale-modernisierung-noetig.html
SIEHE DAZU Studie (41-Seiten-PDF): https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2021/IW-Policy-Paper_2021_Weiterbildung_in_Deutschland.pdf
Reichenforscher Rainer Zitelmann: Finanzielle Freiheit ab Vermögen von 10 Millionen Euro – Vor allem Deutsche und Franzosen sind neidisch auf reiche Menschen – Vermögende Personen schwimmen gegen den Strom und sind besonders offen für neue Erfahrungen – Business Insider, 23.6.2021
Wir Deutschen neigen bekannterweise zu einer Neidkultur. Vermögen und Reichtum wird hierzulande kritischer begutachtet als in anderen Ländern. Dass dem wirklich so ist, zeigt auch eine neue Untersuchung des Unternehmers und Reichenforschers Rainer Zitelmann. Er analysierte in sieben Staaten die Haltung der Menschen zu Reichtum und beantwortet auch die Frage, welche Eigenschaften reiche Menschen oft teilen.
Viel Geld wird oft mit viel Freiheit verbunden. Für Zitelmann heißt das: „Ich entscheide, ob ich arbeite, was ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite“. Finanzielle Freiheit genießt man seiner persönlichen Meinung nach ab einem Nettovermögen von zehn Millionen Euro, wie er in einem Gespräch mit der „Wirtschaftswoche“ sagt.
Doch wer Vermögend ist, macht sich nicht immer beliebt. Wie groß der finanzielle Neid ist, hängt auch vom jeweiligen Wohnort der Superreichen ab, wie sich in der Untersuchung zeigt. „Die Franzosen sind am negativsten gegenüber Reichen eingestellt, danach kommen die Deutschen. Am anderen Ende der Skala stehen Amerikaner und Briten, was viele sicher nicht überrascht, aber ebenso die Schweden“, berichtet der Reichenforscher. Allerdings spielt hier auch das Alter der Befragten eine Rolle. In Italien haben zum Beispiel vor allem junge Menschen eine positive Einstellung gegenüber reichen Menschen. Die ältere Generation ist dagegen eher negativ eingestellt. In den USA verhält es sich der Studie zufolge genau anders herum.
Fest steht allerdings auch, dass besonders in Deutschland der Anteil derer hoch ist, die mit Missgunst und Neid auf Reiche Blicken. In der Untersuchung wurden die Teilnehmer Folgendes gefragt: Wenn ich höre, dass ein Millionär mal durch ein riskantes Geschäft viel Geld verloren hat, denke ich: Das geschieht dem recht. Würden Sie dieser Aussage sehr zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen, überhaupt nicht zustimmen? „Deutschland war das einzige Land, in dem eine relative Mehrheit der Befragten diesem Statement zustimmte“, so Zitelmann in der „Wirtschaftswoche“.
Doch der Forscher beschäftigte sich nicht nur mit der Meinung anderer über Reiche, sondern auch mit der Psychologie der Millionäre. Zitelmann führte für seine Doktorarbeit Tiefeninterviews und psychologische Tests mit Reichen durch, um herauszufinden, welche Eigenschaften vermögende Menschen ausmachen. Demnach zeigte sich, dass sich bei vielen Reichen gewisse Persönlichkeitsmerkmale überlappen. Reiche schwimmen der Studie zufolge eher gegen den Strom, machen sich selbst und nicht andere für Rückschläge verantwortlich und sind offener für neue Erfahrungen.
QUELLE: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/finanzen/reichenforscher-finanzielle-freiheit-ab-vermoegen-von-10-millionen-euro/
ÖSTERREICH
STATISTIK AUSTRIA
Arbeitsmarkt im 1. Quartal 2021: weiterhin deutlich von der COVID-19-Pandemie geprägt“
Endgültige Außenhandelsdaten 2020: markante Rückgänge bei Importen (-8,5%) und Exporten (-7,1%); trotz Corona-Pandemie Außenhandelsvolumen über 140 Mrd. Euro
Rohmilchproduktion 2020: mehr Kuhmilch, Schaf- und Ziegenmilch rückläufig
QUELLE: https://www.statistik.at
Umwelt – Kromp-Kolb warnt vor exponentieller Unwetter-Entwicklung: zunehmende Bedrohung für Menschen, Landwirtschaft und Natur – Künftig mehr Hagelereignisse – Klimaschutz hat politisch erste Priorität – Science-APA, 25.6.2021
Tornados werden auch in Österreich intensiver sowie Hagelunwetter noch häufiger und stärker werden – das prognostizierte die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur in einer Pressekonferenz mit dem oö. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Die Expertin warnte: „Es geht nicht linear weiter, sondern exponentiell“. Man müsse daher in Sachen Klimaschutz „endlich ins Handeln kommen“.
„Wenn sich die Lufthülle der Erde erwärme, entsteht mehr Energie“, erklärte Kromp-Kolb den Mechanismus, der der zunehmenden Häufigkeit von Unwettern zugrunde liegt. Zudem könne die wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen. „Wenn sich das entlädt – mehr Energie und mehr Wasser -“ seien heftigere Regenfälle, Unwetter und Hagel sowie eventuell sogar Tornados die Folge.
Ob Tornados in Zukunft häufiger werden, sei wissenschaftlich nicht ganz klar, so Kromp-Kolb. Das hänge u.a. mit Datenlage und der Kleinräumigkeit dieser Ereignisse zusammen: Wenn sie Siedlungsgebiete betreffen, können sie – wie in der Nacht auf Freitag in Tschechien – katastrophale Auswirkungen haben, über unbesiedeltem Gebiet werden sie manchmal gar nicht registriert. Sicher sei aber, dass die Heftigkeit der Tornados auch bei uns zunehmen werde.
*** Mehr Hagelereignisse zu erwarten ***
Beim Hagel müsse man davon ausgehen, dass sowohl die Ereignisse häufiger als auch die Körner größer werden, das zeige die Statistik bereits jetzt deutlich. Grund für diese Entwicklung sei, dass die Luftmassen mit der Erwärmung labiler werden. In Österreich sei vor allem der „Gürtel um die Alpen“ betroffen, also der Bereich nördlich des Gebirges und hinunter in das Burgenland und die Steiermark. Hagel entstehe schneller als ein Tornado, bei dem auch spezielle Windbedingungen erfüllt sein müssten.
Die Ereignisse dieses Sommers seien insgesamt nicht überraschend, „es entwickelt sich so, wie die Wissenschaft das erwartet hat“, sagte die Klimaforscherin und betonte, dass die weitere Entwicklung nicht linear, sondern exponentiell verlaufen werde. Das nächste halbe Grad Erwärmung werde daher deutlich mehr Probleme bringen als das vorangegangene. „Wir spielen mit dem Feuer“ und da dürfe man sich nicht wundern, „wenn man sich die Finger verbrennt. Wir als Gesellschaft und als Österreich haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht“. Die Politik sei immer noch mit dem Formulieren von Zielen beschäftigt anstatt mit der Umsetzung von Maßnahmen. Grund sei vermutlich die „Angst vor Verzicht“, wobei Klimaschutzmaßnahmen nicht nur Verzicht, sondern vor allem auch „ein besseres Leben“ bringen würden, appellierte Kromp-Kolb.
*** „Klimaschutz muss oberste Priorität haben“ ***
Kaineder kritisierte, dass im oberösterreichischen Wiederaufbauplan „bei einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro gerade 20 Millionen für Klimaschutz“ reserviert seien. Allein die Schäden der vergangenen 48 Stunden würden sich auf „mindestens das Doppelte“ belaufen. Die Klimaschutzreferenten der Länder, die am Freitag getagt haben, seien sich einig, dass „Klimaschutz oberste Priorität bei allen politischen Entscheidungen haben muss“, man dürfe nicht riskieren „unseren Kindern einen unwirtlichen Planeten zu übergeben“.
„Fakt ist, Wetterereignisse wie der gestrige Tornado werden durch die Klimakrise häufiger und extremer. Das bedeutet auch eine zunehmende Bedrohung für Menschen, Landwirtschaft und Natur“, unterstrich auch Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin von Greenpeace in Österreich. „Wenn man Kohle, Öl und Gas verbrennt, steigen die Temperaturen auf der Erde. Je heißer es wird, desto mehr nimmt die Intensität von Extremwetterereignissen zu. Solche Stürme wie gestern werden wir in Zukunft immer öfter erleben“, so die Expertin.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/1831764804484928391
IHS-Prognose für 2021 und 2022 – Pressekonferenz: BIP-Wachstum von 3,4% heuer und 4,5% für 2022 – Weiterhin über Vorkrisenniveau: Arbeitslosenquote dürfte auf 8,4% in diesem und 7,9% im nächsten Jahr zurückgehen – Institut für Höhere Studien (IHS), 24.6.2021

QUELLE und COPYRIGHT 2021: Institut für Höhere Studien (IHS)
GRAPHIK: https://pbs.twimg.com/media/E4oegwiXMAImhen?format=jpg&name=small
(GRAPHIK – Legende: https://pbs.twimg.com/media/E4tdB1VXIAADhmU?format=jpg&name=small)
QUELLEN:
https://twitter.com/IHS_Vienna/status/1407979809645338656
https (inkl. 1:08:12-min-Video): https://www.ihs.ac.at/konjunkturprognose
SIEHE DAZU
=> Prognose auf Deutsch
QUELLE (7-Seiten-PDF): https://www.ihs.ac.at/fileadmin/public/2016_Files/Documents/2021/Prognose_Juni/ihs-prognose-kurzfassung-juni-2021-oesterreich-aufschwung-pandemie.pdf
=> Prognose auf Englisch
QUELLE (4-Seiten-PDF): https://www.ihs.ac.at/fileadmin/public/2016_Files/Documents/2021/Prognose_Juni/ihs-forecast-shortversion-june-2021-austria-upswing-pandemic.pdf
WIFO-Prognose für 2021 und 2022: Kräftiger Konjunkturaufschwung in Österreich – Schwungvolle Industriekonjunktur: reales BIP-Wachstum von 4% bzw. 5% für 2021 und 2022 erwartet – Schnellerer Aufschwung als bisher erwartet – Erstarken des privaten Konsums – Lebhafterer Investitionsdynamik – Inflationserwartung für 2021 bei 2,3 Prozent – Beschäftigung bereits im Frühjahr auf Vorkrisenniveau – Arbeitslosigkeit 2021e bei 8,5 Prozent, 2022e bei 8 Prozent – WIFO, 24.6.2021
Weltweit haben sich die wirtschaftlichen Aussichten seit der letzten Prognose deutlich verbessert. Dies hat auch Folgen für die erwartete Erholung in Österreich. Vorlaufindikatoren deuten
auf den Beginn einer Hochkonjunkturphase, die 2021 vorwiegend von der günstigen Industriekonjunktur getragen wird. 2022 wird der Tourismus überproportional zum heimischen Wirtschaftswachstum beitragen. Nach dem Rückgang im Vorjahr (minus 6,3%) erwartet das WIFO für 2021 und 2022 ein reales BIP-Wachstum von 4% bzw. 5%.
„Die schwungvolle Industriekonjunktur prägt insbesondere im laufenden Jahr die gesamtwirtschaftliche Expansion. 2022 werden hingegen die marktbezogenen Dienstleistungen überproportional zum Wachstum beitragen, vor allem aufgrund der Erholung im Tourismus“, so der Autor der aktuellen WIFO-Prognose Christian Glocker.
Die österreichische Volkswirtschaft überwindet die COVID-19-Krise deutlich schneller als bisher
erwartet und steht am Beginn einer Aufschwungphase. Hierbei prägt vor allem der rasche Fortschritt der Impfkampagne die wirtschaftlichen Perspektiven, da die damit einhergehende Aufhebung der behördlichen Einschränkungen die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität ermöglicht. Neben dem Erstarken des privaten Konsums tragen eine hohe Investitionsdynamik, die durch öffentliche Investitionsanreize sowie zunehmende Kapazitätsengpässe getrieben wird, und die kräftige Ausweitung der Exporte zum Konjunkturaufschwung bei. Die heimischen Ausfuhren profitieren hierbei von der Erholung der Weltwirtschaft.
Vor diesem Hintergrund wird das reale Bruttoinlandsprodukt der österreichischen Volkswirtschaft 2021 um 4% und 2022 um rund 5% expandieren. Dabei wird das Vorkrisenniveau schon im Laufe des Sommers 2021 erreicht. Die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung (Outputlücke) dürfte bereits 2022 wieder überdurchschnittlich sein. Aus heutiger Sicht sollte die österreichische Volkswirtschaft Ende 2022 auf jenen Wachstumspfad zurückgefunden haben, den das WIFO vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie prognostiziert hatte.
Der Konjunkturaufschwung dürfte sich deutlich auf die Preise auswirken. Die Inflationsrate laut
Harmonisiertem Verbraucherpreisindex (HVPI) wird 2021 auf 2,3% anziehen (2020: 1,4%). Ausschlaggebend dafür ist neben der kräftigen Konsumnachfrage die Weitergabe der hohen Preise für Rohstoffe und Intermediärgüter. Auch 2022 dürfte der Preisauftrieb mit 2,1% hoch bleiben, nicht zuletzt aufgrund der überdurchschnittlichen Kapazitätsauslastung der Gesamtwirtschaft, die vor allem die inländische Preisdynamik antreibt.
Die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt dürfte auch 2022 anhalten. Da die Beschäftigung bereits im Frühjahr 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreichte, wird jedoch eine Abschwächung des Wachstums erwartet: Die unselbständige Aktivbeschäftigung dürfte 2021 um 2,1% und 2022 um 1,6% ausgeweitet werden. Parallel dazu dürfte die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgehen, wodurch die Arbeitslosenquote 2021 auf 8,5% und 2022 auf 8,0% sinken sollte. Damit wird das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 (7,4%) im Prognosezeitraum nicht erreicht werden.
QUELLE (2-Seiten PDF inkl. tabellarischer Übersicht): https://newsletter.wifo.ac.at/sys/r.aspx?sub=1bt05v_4hScRa&tid=1-KhgPF-17IMlo&link=s7oE
SIEHE DAZU
=> WIFO-Pressekonferenz am 24.6.2021: Sommerprognose für 2021 und 2022
QUELLE: (inkl. 21:07-min-Video): https://www.wifo.ac.at/main.jart?rel=de&content-id=1487278189573&j-cc-node=news&j-cc-id=1621537943782
Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex – 23. Kalenderwoche 2021 – BIP-Lücke in der Kalenderwoche 23 (7. bis 13. Juni 2021) um 0,3 Prozentpunkte verringert und damit nahezu geschlossen (–0,1%) – BIP aktuell um 11,8% höher als vor einem Jahr – WIFO, 22.6.2021
Im Vergleich zum Vorkrisenniveau, einer Durchschnittswoche im Jahr 2019 als fixe Referenzperiode, hat sich die BIP-Lücke in der Kalenderwoche 23 (7. bis 13. Juni 2021) nach vorläufiger Berechnung um 0,3 Prozentpunkte verringert und damit nahezu geschlossen (–0,1%). Gegenüber der Vergleichswoche im Vorjahr ist das BIP aktuell um 11,8% höher.
QUELLE: https://www.wifo.ac.at/main.jart?rel=de&content-id=1487278189573&j-cc-node=news&j-cc-id=1612794804236
Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB für die Kalenderwochen 22 bis 24: BIP Mitte Juni rund 1 % unter Vorkrisenniveau – OeNB, 25.06.2021
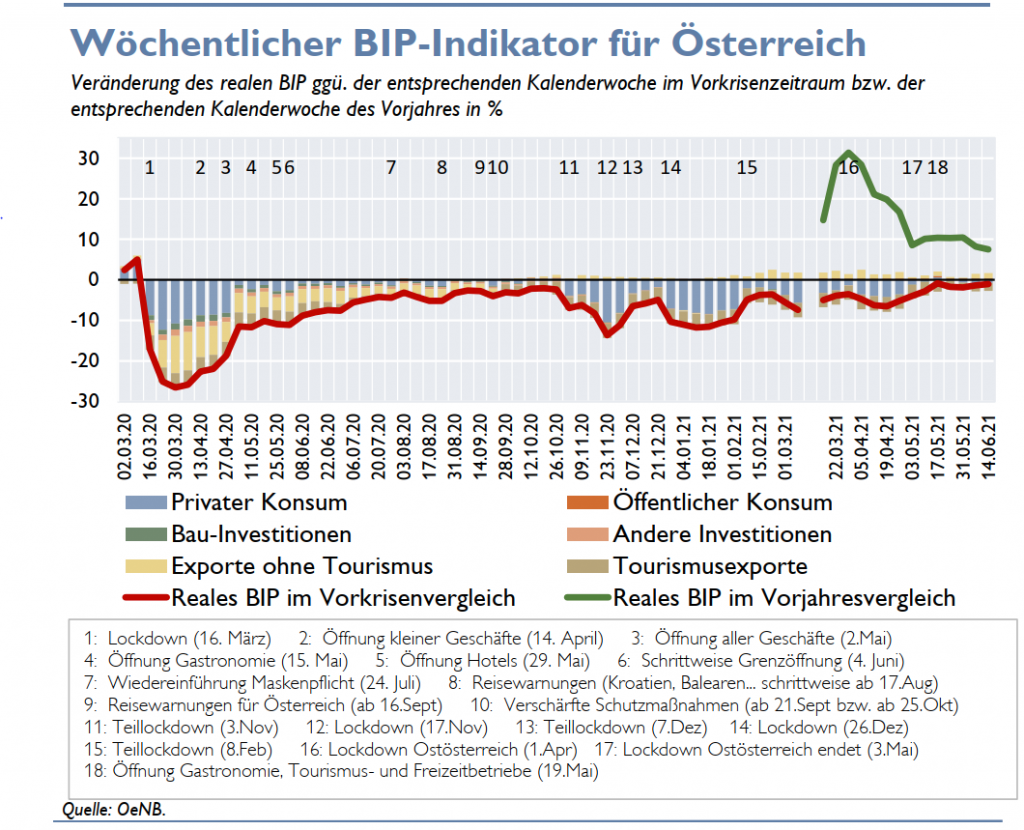
In den Kalenderwochen 22 bis 24 (31. Mai bis 20. Juni 2021) lag die Wirtschaftsleistung in Österreich 1,9 %, 1,3 % bzw. 1,1 % unter dem Vorkrisenniveau, d. h. unter dem Niveau der Vergleichswochen 2019. Damit erreichte die BIP-Lücke in den vergangenen fünf Wochen die niedrigsten Werte seit Ausbruch der COVID-19-Krise im Frühjahr 2020, es kam allerdings in diesem Zeitraum zu keiner weiteren Verbesserung.
Der Anstieg der privaten Konsumausgaben nach den Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Tourismus- und Freizeitbetriebe am 19. Mai hat sich in den letzten drei Wochen nicht weiter fortgesetzt, die Ausgaben der privaten Haushalte gingen sogar geringfügig zurück. Dafür dürften abklingende Nachholeffekte, wie sie auch schon in der Vergangenheit nach Öffnungsschritten zu beobachten waren, verantwortlich zeichnen. Im internationalen Tourismus hat sich der Aufwärtstrend hingegen fortgesetzt. Die Ausgaben ausländischer Gäste mit Zahlungskarten lagen in den beiden Wochen nach den Öffnungen am 19. Mai noch um rund zwei Drittel unter dem Vorkrisenniveau, in den vergangenen drei Wochen nur noch um die Hälfte. In der exportorientierten Industrie wurde das Vorkrisenniveau bereits Ende 2020 erreicht, danach kam es jedoch trotz ausgezeichneter Stimmungsindikatoren zu einer Seitwärtsbewegung. Für die letzten Wochen signalisieren die LKW-Fahrleistungsdaten wieder einen Aufwärtstrend. Noch ist es aber zu früh, um beurteilen zu können, ob die angebotsseitigen Engpässe bei Vormaterialien und Lieferengpässe, die seit einiger Zeit einer stärkeren Produktionsausweitung entgegenwirken, bereits im Abklingen sind.
Beim Vergleich zur jeweiligen Vorjahreswoche ergeben sich aktuell aufgrund eines ausgeprägten Basiseffektes stark positive Wachstumsraten (grüne Linie in der Grafik, siehe methodische Erläuterungen weiter unten). In Kalenderwoche 24 lag die Wirtschaftsleistung 7,5 % über dem Wert der entsprechenden Vorjahreswoche.
QUELLEN:
=> Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB für die Kalenderwochen 22 bis 24
QUELLE (3-Seiten-PDF): https://www.oenb.at/dam/jcr:2cd9d702-f1c0-499e-9d1b-f8abfb7f6726/woechentlicher_bip-indikator_KW_22_bis_24_2021.pdf
=> Daten zum wöchentlichen BIP-Indikator für KW 22 bis 24 (XLSX, 0,1 MB)
https://www.oenb.at/dam/jcr:a0f65a52-4729-4b50-a6ed-4d80b2c700b6/daten_bip-indikator_KW_22_23_24_2021.xlsx
=> Weekly OeNB GDP indicator: data (XLSX, 0,1 MB)
https://www.oenb.at/dam/jcr:a0f65a52-4729-4b50-a6ed-4d80b2c700b6/daten_bip-indikator_KW_22_23_24_2021.xlsx
=> Weekly OeNB GDP indicator: data (CSV, 0 MB)
https://www.oenb.at/dam/jcr:7c5ab44b-204d-4d45-a802-884d1019f7f5/data_on_the_weekly_GDP-indicator.csv
Containerfrachtverkehr: Verzögerungen und Preissteigerungen – WIFO Research Brief beleuchtet Bedeutung für den österreichischen Außenhandel – WIFO, 23.6.2021
Ein WIFO Research Brief von Elisabeth Christen und Yvonne Wolfmayr beschreibt die aktuellen Verzögerungen und starken Preissteigerungen im Containerfrachtverkehr und analysiert deren Bedeutung für den österreichischen Außenhandel.
Ab der Jahresmitte 2020 kletterten die Frachtraten für Schiffscontainer in ungeahnte Höhen. Die rasch einsetzende Erholung der Sachgütererzeugung und Besonderheiten im Erholungsmuster des Welthandels durch ein verändertes Konsumverhalten während der COVID-19-Pandemie zählten zu den wichtigsten Gründen. Die Verlangsamung in der maritimen Lieferkette und die Suezkanal-Blockade verschärften die Situation weiter. Vor allem die Schiffsroute von Asien nach Europa war von den Preissteigerungen betroffen.
Österreich importiert Waren im Wert von 14,5 Mrd. € aus Asien und rund 40% (5,6 Mrd. €) davon über den Seeweg. Aus China stammen davon mehr als die Hälfte dieser maritimen Importe aus Asien. Der Großteil entfällt auf Kraftfahrzeuge, mechanische und elektrische Geräte (z. B. Waschmaschinen, Kühlschränke), Möbel und andere Konsumgüter. Insgesamt dürften rund 17% der österreichischen Extra-EU-Importe, bzw. rund 4% der österreichischen Gesamtimporte, von der rasanten Kostensteigerung auf den Schiffsrouten von Asien nach Europa betroffen sein. Internationale Prognosen gehen derzeit davon aus, dass sich die daraus ergebende Lieferproblematik im weiteren Jahresverlauf beruhigt und die Wachstumsaussichten für die Produktion und den Außenhandel nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
QUELLE: https://www.wifo.ac.at/main.jart?rel=de&content-id=1487278189573&j-cc-node=news&j-cc-id=1621537943695
Milliardärsranking: 100 reichste Österreicher besitzen zehn Prozent des Gesamtvermögens – Die Familien Porsche und Piech verfügen in Österreich über das größte Vermögen. Erstmals sind auch heimische Start-up-Gründer in dem Ranking vertreten – AK fordert Millionärsabgabe – Der Standard/APA, 25.6.2021
Mehr als ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise haben die 100 reichsten Österreicher ihr Vermögen deutlich erhöht. Mittlerweile sitzen sie auf mehr als 200 Milliarden Euro, das sind knapp zehn Prozent des gesamten Vermögens in Österreich, schreibt der „Trend“ in seiner aktuellen Ausgabe. Im Vorjahr war das Vermögen der 100 Reichsten noch auf 155 Milliarden Euro gesunken. Im Ranking finden sich heuer nicht nur altbekannte Gesichter, sondern erstmals auch einige Start-up-Gründer.
Mit hochdotierten Finanzierungsrunden und damit stark steigenden Firmenbewertungen machten in den vergangenen Monaten die beiden heimischen Start-ups Bitpanda und Gostudent auf sich aufmerksam. Im März konnte die Krypto-Handelsplattform Bitpanda Investments in Höhe von 170 Millionen lukrieren, mittlerweile wird es mit rund einer Milliarde bewertet. Das Vermögen der drei Gründer Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer schätzt der „Trend“ auf über 600 Millionen Euro, sie landen damit auf Platz 67.
Überholt wird der Unternehmenswert von Bitpanda in Österreich nur von dem Start-up Gostudent. Erst vor einigen Tagen konnte die Nachhilfeplattform mit einer 205 Millionen schweren Finanzierungsrunde seinen Wert auf rund 1,4 Milliarden Euro steigern. Die beiden Gründer Felix Ohswald und Gregor Müller halten jeweils Anteile an dem Unternehmen über Stiftungen, beide gemeinsam kommen auf rund 22 Prozent. Das Vermögen der beiden wird auf rund 300 Millionen Euro geschätzt, im aktuellen Ranking nehmen sie damit den 89. Rang ein.
Abseits der jungen Reichen aus der Start-up-Szene blieben die Top Ten der wohlhabendsten Österreicher relativ unverändert zu den Vorjahren. An erster Stelle lagen unangefochten die Familien Porsche und Piech (51,1 Milliarden Euro), die große Anteile an der deutschen Porsche SE und damit an Volkswagen Porsche und dem Salzburger Autohändler Porsche Holding halten. Der Zugewinn zum Vorjahr macht damit rund 16 Milliarden Euro aus. Der steigende Aktienkurs bei VW und großzügige Porsche-Dividenden halfen beim Vermögenszuwachs, schreibt das Wirtschaftsmagazin „Trend“.
Auf Platz zwei blieb Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit einem geschätzten Vermögen von 16,4 Milliarden Euro, Rang drei belegte heuer Elisabeth Schaeffler, die gemeinsam mit ihrem Sohn Georg Continental-Großaktionärin ist und ein Vermögen von 9,4 Milliarden Euro besitzt. Auch sie profitierte vom der sich wieder stabilisierenden deutschen Autobranche.
Novomatic-Gründer Johann Graf, der im vergangenen Jahr auf dem dritten Platz lag, rutschte mit einem Vermögen von 5,5 Milliarden Euro auf den fünften Platz zurück. Neu aufgestiegen in die Top Ten ist dagegen Michael Tojner, der von dem steigenden Aktienkurs beim Batteriehersteller Varta, der zu Tojners Montana Tech Components gehört, profitiert und dessen Vermögen mittlerweile auf 4,7 Milliarden Euro geschätzt wird. Er belegt damit Platz sieben, im vergangenen Jahr lag er noch auf Platz 15.
Unverändert auf Platz sechs liegt der Immobilien-Investor René Benko mit einem Vermögen von 4,9 Milliarden Euro. Trotz der Turbulenzen bei Karstadt/Kaufhof konnte sein Signa-Konzern an Wert gewinnen. Hauptgrund dafür seinen Zukäufe gewesen, heißt es in dem Magazinbericht.
Insgesamt gibt es in Österreich nun 46 Milliardäre, um fünf mehr als im Vorjahr. Die Schere zwischen Arm und Reich dürfte auch in Zukunft hierzulande immer weiter auseinanderdriften. Der Anteil der 500 reichsten Familien in Österreich am gesamten Finanzvermögen liege derzeit bei 34 Prozent, so der „Trend“ unter Bezugnahme auf Daten der Boston Consulting Group (BCG). Bis 2025 dürfte der Anteil auf 36 Prozent ansteigen.
*** AK fordert Millionärsabgabe ***
Die Arbeiterkammer (AK) und die Gewerkschaft (ÖGB) nahmen das Ranking heute zum Anlass, um einmal mehr eine Millionärssteuer zu fordern. „Wir müssen die Armut verringern und können nicht zuschauen, wie Reiche ihr Vermögen steuerfrei vermehren. Eine Millionärsabgabe ist eine Frage der Gerechtigkeit, auch immer mehr Superreiche selbst sehen das so und fordern das lautstark ein“, so AK-Präsidentin Renate Anderl laut einer Aussendung vom Freitag. Gefordert wird von den Organisationen ein progressiver Steuertarif ab einem Nettovermögen von einer Million Euro. Bei Steuersätzen von 0,5 bis 1,5 Prozent wären damit Einnahmen für den Staat von bis zu fünf Milliarden Euro möglich, heißt es in der Aussendung.
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000127718919/100-reichste-oesterreicher-besitzen-zehn-prozent-des-gesamtvermoegens
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER
Michael Ferber: Die Angst vor dem Stagflations-Gespenst steigt: Sind die höheren Inflationsraten temporär oder dauerhaft? Darüber gehen bei Anlageexperten die Meinungen auseinander. Manche sehen Parallelen zu den 1970er Jahren – Neue Zürcher Zeitung, 26.6.2021
In diesem Artikel passieren diverse Meinungen Revue. Neben anderen diese und die folgenden:
«Der Geist der Inflation ist aus der Flasche»… Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen dürfte 2022 weiterhin hoch bleiben, was ideale Bedingungen für Preisüberwälzungen schaffe, schreibt der Chefökonom der Bantleon Bank Daniel Hartmann.
Hinzu kommen aus Sicht von Hartmann langfristige Effekte wie die weltweit schrumpfende Erwerbsbevölkerung, die Umgestaltung der globalen Lieferketten sowie die gerade erst anlaufenden Investitionen in den Klimaschutz. Letztere machten eine anhaltend expansive Fiskalpolitik wahrscheinlich. Zusammen könnten diese Faktoren der Inflation zusätzlichen Auftrieb geben. Hartmann erwartet, dass der Kostendruck nicht gleich wieder abebben wird, zudem sieht er erste Anzeichen für Lohndruck. Sowohl in den USA als auch in Europa hätten Unternehmen Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen.
*** Was spricht dagegen ein Aufkommen von Inflation? ***
Die derzeitige Situation ermögliche es Arbeitnehmern in den USA, höhere Löhne zu erzielen, heisst es bei der Investmentgesellschaft DWS. Dieser Druck dürfte aber nachlassen, wenn immer mehr Menschen in die Beschäftigung zurückkehren. Ein gewisser Inflationsdruck entstehe derzeit wegen der Unterbrechung von Lieferketten und der hohen Rohstoffpreise. Beide Impulse dürften sich aber in Bälde abschwächen – die 2020er Jahre seien folglich keine Neuauflage der 1970er Jahre.
Laut dem ZKB-Chefstrategen Ferreira gab es in den 1970er Jahren eine Art «perfekten Sturm». Bereits in den 1960er Jahren war der US-Staatshaushalt deutlich defizitär, gleichzeitig stiegen die Löhne stark an. 1971 hatten die USA die Golddeckung des Dollars aufgegeben, und 1973 brach das Bretton-Woods-System zusammen. Die Folge war eine starke Abwertung des Dollars. Die Notenbanken hätten damals laut Ferreira weder über die nötige Erfahrung noch über effektive Instrumente verfügt, um die Inflation zu bändigen – bis die Federal Reserve unter Paul Volcker die Zügel anzog.
Laut dem ZKB-Vertreter bilden derzeit die Stimulierung der Wirtschaft, Lieferengpässe, Nachholbedarf, Deglobalisierungsideen nach der heftigen Rezession eine inflationäre Basis. Damit die Inflation aber dauerhaft werde, müsse sich die Produktionslücke schliessen, es brauche Vollbeschäftigung, und die Löhne und Preise für unerlässliche Güter müssten stetig steigen. Er hält eine Inflationsentwicklung wie in den 1970er Jahren vor diesem Hintergrund für «sehr unwahrscheinlich».
QUELLE: https://www.nzz.ch/finanzen/stagflation-angst-vor-1970er-jahre-szenario-steigt-an-der-boerse-ld.1632257
Europäische Union als Geldautomat – Recherche der europäischen Grüne-Fraktion rechierte: kaltschnäuzig gestellte Förderanträge nicht vereinbar mit Vorgaben für den EU-Wiederaufbaufonds – Steingarts Morning Briefing, 22.6.2021
für viele Mitgliedsstaaten ist Europa vor allem ein großer Geldautomat. Mit routinierter Kaltschnäuzigkeit werden Förderanträge gestellt und Subventionen eingefordert. Den mit 750 Milliarden Euro ausgestatteten EU-Wiederaufbaufonds verstehen nicht alle, aber viele als Einladung zur Selbstbedienung – zumal ein Gutteil der Gelder nicht zurückgezahlt werden muss.
Die Chefin der europäischen Grünen-Fraktion heißt Franziska Maria „Ska” Keller. Sie hat mit einem Team von Abgeordneten und Experten recherchiert, in welche Projekte denn diese Milliarden fließen sollen und ob denn alles so umwelt- und klimafreundlich ist, wie in den Statuten des Fonds verlangt.
Das Ergebnis fiel ernüchternd aus. Unglücklicherweise habe ihre Recherche „zu ernsten Zweifeln” an der ordnungsgemäßen Durchführung des Plans geführt, schreibt Keller. Vieles verstoße gegen „Geist und Buchstaben” des Aufbaufonds. Nicht wenige Mitgliedsstaaten würden die ökologischen Vorgaben „umgehen oder einfach ignorieren”, wie Ska Keller in einem Schreiben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen formuliert. Im Detail listet sie Projekte auf, die dem Anspruch einer grünen Investition nicht genügen:
- In Italien, Polen und Tschechien wurden mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel als „grün” deklariert und für die hundertprozentige Förderung angemeldet.
- Tschechien, aber auch Deutschland und Frankreich, haben Unterstützungen für Hybridautos als Teil der klimafreundlichen Subventionen ausgewiesen. Die genannten Länder wollen ihre ohnehin schon beschlossenen Kaufanreiz-Programme von der EU fördern lassen. Das europäische Geld würde das nationale Geld substituieren.
- In Italien sollen klimafreundliche Hausrenovierungen mit 110 Prozent gefördert werden, was bedeuten würde, dass der Empfänger noch Geld geschenkt bekommt. Doch es fehlen jegliche Regelungen, die festlegen, wie klimafreundliche Renovierungen aussehen.
- Ebenfalls in Italien möchte man die Anschaffung von Diesel-Traktoren für die Landwirtschaft als klimafreundliche Investition deklarieren, um sie aus dem EU-Topf finanzieren zu können. Die EU würde „damit den Gebrauch fossiler Brennstoffe incentivieren”, heißt es in dem Schreiben.
- In verschiedenen Ländern (Deutschland, Tschechien, Slowakei, Italien und Polen) sollen Gasheizungen für private Häuslebauer aus dem EU-Aufbauprogramm finanziert werden.
- In Tschechien, Polen, Italien, Slowenien, Lettland und Ungarn will man Bewässerungssysteme für eine extensiv betriebene Landwirtschaft durch Brüssel finanzieren lassen.
QUELLE: nicht verlinkbar.
IMF: Building a Better Digital Economy – Speech of Geoffrey Okamoto, First Deputy Managing Director, IMF
Remarks to IDB Miami-LAC Conference The Light Box at Wynwood, Miami, Florida – IMF, 24.6.2021
I want to thank the IDB for inviting me to be here with all of you this week. As a technologist, who then went into finance, and now is in public service, I think the need for discussing these issues has never been greater, and there’s no better context to have it in than with respect to Latin America and to be here in Miami.
This is one of the first conferences I’ve been to since the onset of the COVID-19 pandemic and it’s impossible to have lived through the past year and not come out with a different perspective. One thing for certain is that our reliance on technology lessened the impact on the pandemic. You could order meals, sign mortgage loan agreements, and hold a virtual quinceanera thanks not only to technological innovation, but the accompanying societal adoption. This trend, by all indications, is going to continue at light-speed. We all need to be ready.
All countries should do everything they can to use this technological super cycle for a much-needed growth tailwind that raises living standards and addresses longstanding challenges. It is important for me to be here, in Miami, and to speak with leaders like you is because building a better digital economy is particularly important for Latin America and the Caribbean. Our research at the IMF indicates that this region has lagged others in ensuring that all people can share in the prosperity that a digital transition brings.
This digital divide exists because many do not have access to digital technology, or if they do, they lack the skills to use it productively. This digital divide is already giving way to an economic divide, and if further left unaddressed, a social divide isn’t out of the question. That’s something this region cannot afford. The people of Latin America and the Caribbean deserve every opportunity to pursue prosperity — prosperity that is now inextricably linked to continued technological innovation and commercialization.
There are proper roles for the government and for the private sector. Both will need to collaborate to maximize the growth opportunities that present themselves. If done well, governments will be able to deliver prosperity to citizens after a year in which IMF data shows standards of living in most countries declined, and the private sector will be able to offer transformational products, in new markets, to more customers, with higher incomes. It truly can be win-win.
We know how this can work, because it works in other places. I come from California, a then-frontier that people flocked to in the 1800s in search of gold, leaving behind their more comfortable and established lives on the East Coast. I’m convinced that spirit, somehow and someway, persisted in the California ether and gave rise to the Silicon Valley that has powered California’s economy. But all people, by our nature, want to push the boundaries of what’s possible to improve our lives and secure a better future for the next generation. That same spirit has ignited tech hubs all over the world, where disrupters and the investors that believe in them are injecting dynamism and growth into their economies.
To make this work in Latin America, we need to focus on some key issues.
First, there needs to be sufficient investment in basic digital infrastructure. Governments and private firms both need to play a role, but governments should focus on investments that may be inaccessible or unprofitable for private providers. Some of this is physical infrastructure — after all, it’s impossible to participate in the digital economy if you’re not connected — but a lot of it is also digital identity infrastructure and critical data on SMEs that private firms can use to construct a better ecosystem for startups. It is reassuring that we have a strong partner in IDB that understands this and can help build out digital infrastructure of various types throughout the region. In some areas of work, where it’s possible to coordinate this across countries as well, the region will see even greater benefits.
Second, governments need to reconsider their regulatory frameworks and make sure ey are conducive to private sector investment and innovation. Regulation that is too tight favors companies that are large enough to afford expensive and complex compliance. Right-sizing regulation with an eye toward facilitating the entry of smaller firms may be opposed by established players, but a more dynamic economy is in everyone’s interest, attracting investment and creating better-paying jobs. We can start today. In the case of FinTech, for example, mechanisms like guidance units set up within regulators and so-called “sandboxes” can be used as a stop-gap measure to encourage innovation while more thorough reviews are undertaken.
Third, new firms need access to the right people. Developing human capital is key. Governments need to invest properly in education, particularly in STEM fields, while the private sector needs to assist by investing in training employees for that “last-mile” on technical skills specific to their business. The two go hand in hand, and this is an example where coordination makes all the difference.
Fourth, the financial sector needs to be capitalized and regulated with an eye toward maintaining stability while also channeling capital to new market entrants. The safest entity to lend to may be a government, a state-owned enterprise, or a conglomerate with outsized market power, but a financial sector that is overly incentivized to allocate capital to these entities is effectively starving more dynamic parts of the private sector of the resources they need to grow. In the long-term the goal is to have a mix of banks, capital markets, and even FinTechs themselves allocating capital to new firms, each able to finance at different scales, on different terms, and assume different risks. Governments that maintain capital account openness can avail themselves of foreign investment, much of which is engaged in a global search of good investment opportunities at a time when yields are low in many Advanced Economies.
Fifth, investors and firms need access to a sound and stable legal framework with a judicial system that understands property rights, including the importance of intellectual property rights. Startup investing is almost by definition one of the highest-risk investments you can make, and it’s difficult to attract it at sufficient scale if the private sector isn’t clear on what their rights are or if they will be able to enforce their rights when needed.
Many countries in Latin America and the Caribbean need to make substantial improvements in one or more of these areas to fully unlock a digital economy that powers growth and is inclusive of people that, to date, are falling further behind.
It’s also worth noting that there are emerging challenges that need to be addressed. Safe, trusted, and reliable digital ecosystems lie at the heart of adoption and usage of new digital products and services. Cyber threats increase exponentially as consumers connect through their mobile devices to a host of communication networks such as public Wi-Fi. It becomes important then to ensure that the entire digital ecosystem is designed with cyber security in mind. The development of global standards in this domain must keep pace with the changes, especially as we move into a quantum processing world with super computers. Of course, with such computing power and advanced analytics, we need to equally be aware of biases that may be built into algorithms that may impact the digital divide.
At the International Monetary Fund, we want to do all we can to support countries during this transition. It starts with deploying our expansive analytical expertise to help countries understand the amount of growth that they could be leaving on the table without acting now, as many of the elements that I highlighted can understandably be politically difficult to execute. In the FinTech space, the IMF along with the World Bank proposed the Bali FinTech Agenda, which reinforces competition and commitment to open, free, and contestable markets. We are preparing to deepen our work on digital money and the implications this has for the international monetary system that we have been responsible for since our creation. Crypto currencies, stable coins, and central bank digital currencies have sweeping implications for monetary policy, capital flows, and the role of the financial sector.
Building a better digital economy is therefore a collective effort amongst a wide set of stakeholders and it’s great to have the IDB convening all of us here to put some energy into the conversation. We need to take action now and Latin America can show others how to successfully accelerate development of the digital economy. We need greater enhanced focus to ensure that the digital revolution benefits the many and not just the few.
Thank you very much for your time this afternoon. I’m very optimistic on the prospects for the region and you can count on me, my colleagues at the IMF, and of course the IDB, to do all we can to help this region realize the full growth potential that digital innovation brings.
QUELLE: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/24/sp062421-building-a-better-digital-economy?cid=em-COM-123-43305
Peter Kurer: Der Staat ist digital inkompetent. Und das ist gut so – Neue Zürcher Zeitung, 24.6.2021
Digitaler Staat: Wie gross der Umfang des Staates sein soll, ist ein Thema vieler politphilosophischer Reflexionen. Wichtiger ist aber die Frage nach seiner Kompetenz. Vor allem in der Digitalisierung sollte der Staat nie eine überbordende Rolle innehaben, wie das Beispiel China zeigt. Der moderne Staat kann nämlich nur unter einer Bedingung digitale Kompetenz ausspielen, und das ist die Tyrannei.
Wir leben in einer Welt, in der wir über alles streiten und uns über wenig einig sind. Einer der schönsten Zankäpfel der öffentlichen Diskussion betrifft die Rolle des Staates. Was soll er tun, und was soll er besser lassen? Dieser uralten Frage setzen wir soeben eine neue Variation hinzu, die wir in ihren möglichen Auswirkungen nicht unterschätzen dürfen: Soll der Staat eine digitale Macht sein?
Wie gross der Umfang des Staates sein soll, ist ein Dauerbrenner der politphilosophischen Reflexion. Doch wichtiger als die Frage nach der Quote ist die Frage nach der Kompetenz.
*** Die Quote ***
Zum Glück gibt es Fakten, die eine unsichtbare Grenze um dieses Treiben setzen. Die wichtigste davon bilden die finanziellen Ressourcen. Der Anteil des Staates am Bruttosozialprodukt hat sich in den demokratischen Ländern irgendwo zwischen gut 30 und gut 50 Prozent eingependelt. Wo ein bestimmtes Land auf diesem Kontinuum genau liegt, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise der Organisation des Gesundheitswesens, der Rolle privater Anbieter im Bildungsbereich, der Finanzierungsform für die Sozialhilfe.
Interessanterweise gibt der Anteil des Staates am Bruttosozialprodukt nur eine unzureichende Antwort darauf, ob wir in ihm ein erfolgreiches oder ein weniger erfolgreiches Modell sehen. Am unteren Ende des Spektrums (ich folge den Zahlen des «Economist» für das Jahr 2019) tummeln sich Länder wie Neuseeland, Australien, die baltischen Staaten und auch die Schweiz, denen wir im Grossen und Ganzen ein gutes Management öffentlicher Angelegenheiten nachsagen.
Am oberen Ende der Skala finden sich beispielsweise Frankreich und Italien, Paradebeispiele von inkompetenten Demokratien. Interessanterweise sieht man aber auch das Gegenteil: alle skandinavischen Länder, die durchwegs als erfolgreich gelten, haben hohe Staatsquoten, während die USA, die Mühe mit der fairen Erledigung öffentlicher Aufgaben haben, dafür (noch) einen relativ tiefen Anteil des Bruttoinlandprodukts aufwenden. Das sind starke Vereinfachungen, sie lassen aber den Schluss zu, dass wir über die Staatsquote nur unzureichend die Qualität staatlichen Wirkens erklären können.
*** Die Kompetenz ***
Es gibt nun aber eine weitere faktische Grenze staatlichen Tuns, und das ist das Gesetz der Kompetenz. Man kann sich Gebiet für Gebiet überlegen, was der Staat gut macht und was nicht. Die Wirtschaftsgeschichte gibt dazu reiche empirische Antworten, und Corona sollte uns zusätzlich die Augen geöffnet haben.
Viele Staaten haben ihre Bürger einigermassen heil durch die Pandemie geführt; oftmals haben sie die delikate Balance zwischen gesundheitlicher Vorsorge und Begrenzung des wirtschaftlichen Schadens gut adjustiert; und insgesamt haben sie sich fürsorglich um die Verlierer in der Pandemie gesorgt. Umgekehrt haben Regierungen, insbesondere auch in Europa, oft in zwei Bereichen versagt: der Logistik und der digitalen Bearbeitung der Krise.
Obwohl eine grosse Pandemie schon seit Jahren zuoberst auf der globalen Risikoliste stand, gab es am Tage X keine Masken, zu wenig Beatmungsgeräte, keine Systeme zum raschen digitalen Datenaustausch. Vakzine wurden zu spät bestellt, Impfzentren nur mühsam aufgebaut.
In der Logistik machte der Staat im Laufe der Zeit sichtbare Fortschritte, kaum aber im digitalen Bereich. Die Covid-19-App löschen wir jetzt ungebraucht. Und hier knüpft meine zentrale These an: Digitalisierung ist jenseits der Grenze staatlicher Kompetenz. Der Staat wird sich zwar in einigen Bereichen digitale Fähigkeiten aneignen. Zumindest unter demokratischen Bedingungen wird er aber nie irgendeine gestaltende und führende Rolle spielen, wenn es um die eigentliche Digitalisierung der Gesellschaft geht.
*** Die Unterscheidung ***
Für diese Sicht gibt es viele Gründe. Der wichtigste ist aber, dass das staatliche Leben nach ganz anderen Regeln abläuft als die digitale Welt; die beiden Universen verhalten sich zueinander wie Öl und Wasser. Staaten sind hierarchische Gebilde, die nach vorgegebenen Regeln operieren. Die digitale und technologische Sphäre ist demgegenüber nach den Regeln von Netzwerken geformt. Diese gliedern sich durch Knoten und Verbindungen, sie nutzen und kreieren Skaleneffekte, verdichten sich zu riesigen Plattformen, um sich dann im nächsten Moment wieder neu zu konfigurieren oder gar zu zerfallen.
Diese Dichotomie zwischen Hierarchien und Netzwerken, die Niall Ferguson in seinem Buch «The Square and the Tower» brillant beschreibt, ist ein gutes Paradigma, um sinnvolles staatliches Wirken zu lokalisieren. Die meisten von uns könnten sich wohl darauf einigen, dass erfolgreiche Staaten in vier oder fünf Bereichen gut gearbeitet haben: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung, Bildungswesen (Eliminierung des Analphabetismus), Gesundheitswesen (Erhöhung der Lebenserwartung) und Wohlfahrt (Verhinderung von Armut). Dies sind aber genau die Bereiche, die sich nach hierarchischen Gesetzen organisieren lassen, in Form von Armeen, Polizeikorps, Schulen und Universitäten, Spitälern und Universitätskliniken, Sozialagenturen und Arbeitsämtern.
Viel grössere Mühe haben alle Staaten in Bereichen, die nicht nach vorgegebenen Hierarchien und Regeln ablaufen: die makroökonomische Entwicklung, Märkte, Innovation und Handel. In diesem Reiche Merkurs, des Gottes der Händler und Diebe wie auch des lateinischen Namensgebers des Quecksilbers, herrschen andere Gesetze als hierarchisch erfassbare, es sind die Regeln von fluiden Netzwerken, Skaleneffekten, tausendfachen und kaum sichtbaren Marktinformationen und sinnvollen Zufällen. Auch in diesen Bereichen kann und muss der Staat wichtige Funktionen erfüllen wie umsichtiges Regulieren, Grundlagenforschung oder direkte Krisenintervention. Indessen kann er kein merkurial Beteiligter sein.
In den allermeisten Fällen, in denen Staaten solche unsichtbare Kompetenzgrenzen überschritten, endete dies im Unglück. Systeme, die sich als Totalunternehmer sahen wie die DDR, sind am Schluss implodiert, weil sie die einfachsten Produktionsprobleme nicht mehr lösen konnten. Staaten, die von ihrer DNA her zum Merkantilismus und zur Dauerintervention neigen wie Frankreich und Indien, marschieren nahe am Abgrund. Viele Länder mussten in den achtziger und neunziger Jahren wichtige Elemente ihrer Infrastruktur privatisieren, nicht weil die Politiker und die Beamten dies lustig fanden, sondern weil die Wasserrohre verrosteten, Briefe nicht mehr zugestellt wurden und Züge chronisch zu spät kamen.
*** Die Digitalisierung ***
Im Bereich der Digitalisierung sind wir nun gerade im Begriff, einen neuen Mammutfehler gouvernementaler Inkompetenz zu setzen. Amerika will 50 Milliarden Dollar in die Förderung des Chipsektors stecken, obwohl es die führende Technologienation ist und Firmen wie Intel und Nvidia wohl in der Lage sein sollten, ihre momentanen Kapazitätsengpässe mit eigenen finanziellen Mitteln zu überwinden. Die EU beabsichtigt, mehr als 145 Milliarden Euro in digitale Projekte wie den Aufbau eigener Chipfabriken zu investieren. Zudem gibt es Pläne für eine europäische Cloud. Auch in der Schweiz wird zunehmend von digitalen Offensiven des Staates und Public-private-Partnerships in diesem Bereich gesprochen, worin man eine verkappte Industriepolitik sehen kann.
Solche Initiativen sind gefährliche Trugbilder. Die amerikanische Technologie bedarf keiner Förderung mehr, und es wird kaum je eine europäische Cloud geben, die Amazon, Microsoft oder Google die Stirn bieten kann. Und ebenso wenig eine europäische Chipindustrie, die zu den Taiwanern aufschliesst.
All dies heisst aber nicht, dass der Staat nicht in seine eigene digitale Kompetenz investieren soll, wo das notwendig und angezeigt ist. Die rasche Digitalisierung des Gesundheitswesens ist wichtig, ebenso die Cybersecurity im staatlichen Bereich. Smarte Strom- und Wasserzähler sparen Geld und Ressourcen. All dies setzt weder eine digitale Industriepolitik noch grosse Anschubfinanzierungen und Public-private-Partnerships voraus.
Die meisten der notwendigen technologischen Produkte und Softwareapplikationen können nämlich irgendwo eingekauft werden. Der Staat sollte eine beschränkte Anzahl von begabten Experten einstellen und trainieren, die diese Software finden, beurteilen und einführen. Anderweitig gibt es keinen Platz für staatliche Kompetenz. Der digitale Zug ist längst abgefahren, und es nützt wenig, wenn die Industriepolitiker ihm schwer atmend hinterherrennen.
*** Die Konklusion ***
Das ist auch gut so. Der moderne Staat stösst mit seinen bestehenden Aufgaben und dem neuen Megathema des Klimaschutzes ohnehin an seine Grenzen. Es ist nicht notwendig, dass wir ihm eine neue, überbordende Aufgabe zuweisen. Und schliesslich sollen wir das auch nicht wollen. Es gibt nämlich eine einzige Bedingung, unter der der moderne Staat digitale Kompetenz ausspielen kann, und das ist die Tyrannei.
China hat wettbewerbsfähige Alternativen zur amerikanischen Vorherrschaft im technologischen Bereich aufgebaut. Die dortigen Mandarine und Parteibonzen sind Herr über die Cloud und das Internet. Sie wissen alles, hören alles, steuern über raffinierte Algorithmen die Präferenzen des Fussvolkes und sanktionieren abweichendes Verhalten. Solche Macht dürfen demokratisch gewählte Regierungen nie haben, es würde die Substanz bürgerlicher Freiheiten aushöhlen, selbst wenn die digitale Macht nur paternalistisch und milde ausgeübt würde.
Gewiss, auch im Westen haben die grossen digitalen Plattformen zu viel Macht über uns. Aber es fehlt ihnen die Sanktionsmacht des Staates, und dieser kann und sollte sie im Auftrag des Volkes kontrollieren und in Schranken weisen. Dies allein ist Grund genug, die digitale und die staatlichen Sphären getrennt zu halten.
AUTOR Peter Kurer ist Jurist, Anwalt und ehemaliger Manager sowie Autor des Buches «Legal and Compliance Risk. A Strategic Response to a Rising Threat for Global Business» (Oxford 2015).
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/feuilleton/der-staat-er-ist-digital-inkompetent-und-das-ist-auch-gut-so-ld.1630544
Michael Hüther: Haushaltsplan 2022 „Dem Druck auf die Schuldenbremse entkommt man nur durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen“ – Institut der deutschen Wirtschaft, 23.6.2021
Fast 100 Milliarden Euro neue Schulden plant Finanzminister Olaf Scholz im Haushaltsplan für das kommende Jahr ein – um Corona-geschädigten Unternehmen zu helfen, Impfstoffe zu beschaffen und geringere Steuereinnahmen auszugleichen. Das sind längst nicht die einzigen großen Ausgaben, die in den kommenden Jahren nötig werden. Ohne eine Öffnung der Schuldenbremse wird man nicht zurechtkommen.
Die Finanzpolitik der nächsten Dekade steht aus mehreren Gründen unter Druck. Erstens sind die Corona-Schulden zu tilgen: Das kann und sollte so organisiert werden, dass dadurch weder Steuern erhöht noch Ausgaben gekürzt werden. Eine langfristige Tilgung über beispielsweise 40 Jahre würde hier genug Luft verschaffen.
Zweitens konkurrieren mehrere große Posten um jeden eingenommenen Steuer-Euro: Der Anteil der Verteidigungsausgaben dürfte Nato-konform von derzeit 1,5 auf zwei Prozent des BIP steigen. Die zurecht geforderte Übernahme der EEG-Umlage kostet den Haushalt rund 25 Milliarden Euro. Zudem steigen alterungsbedingt die Zuschüsse an die Rentenversicherung – ganz besonders, wenn die CSU im Herbst weitere acht Milliarden Euro für die Mütterrente durchsetzt und ansonsten keine Strukturreformen angegangen werden. Es gibt keine Anzeichen, dass dafür der politische Mut reichen wird.
Schuldenbremse öffnen, Investitionsfonds einrichten
Drittens verlangt ein erfolgreicher Strukturwandel für Klimaneutralität massive staatliche Vorleistungsinvestitionen in alle Infrastrukturnetze.
Viertens ist die sogenannte „goldene Dekade“ am Arbeitsmarkt zu Ende, bis 2030 verlieren wir alterungsbedingt vier Millionen Erwerbspersonen. Ein einfaches Herauswachsen aus den Schulden wird deshalb – anders als nach der Finanzkrise 2009 – nicht gelingen, zumal die Produktivität nicht einfach so nach oben springt; die Zuwächse sind seit drei Jahrzehnten in allen Industrieländern im Sinkflug.
Schon ohne Steuersenkungen – die für Unternehmen und im Mittelschichtsbauch der Einkommensteuer geboten sind und beim Soli kommen werden – geht das alles nicht mit einem sturen Festhalten an der Schuldenbremse. Eine Öffnung für eine kluge Tilgung der Corona-Schulden und für einen Investitionsfonds mit eigener Rechtsperson wird zu den Kompromissen jeder neuen Bundesregierung gehören müssen. Ansonsten wird es nichts mit dem gewünschten Strukturwandel. Es muss auch niemand Angst haben, dass die öffentlichen Finanzen dadurch aus dem Ruder laufen. Im Gegenteil: Ein Bundesinfrastrukturfonds (oder Deutschlandfonds) macht transparent und nachvollziehbar, was aus den politisch längst definierten Zielen für den Strukturwandel zu leisten ist.
QUELLE: https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/beitrag/michael-huether-dem-druck-auf-die-schuldenbremse-entkommt-man-nur-durch-steuererhoehungen-oder-ausgabenkuerzungen.html