Views: 114
Die zurückliegende Woche ging neuerlich mit einer großen Menge an Meldungen einher – Lesestoff für eine ganze Woche – in der Tat: es geht um die Rezeption, die Behirnung, das inhaltliche Verstehen des Berichteten. Schon das Lesen der Schlagzeilen in der ÜBERSICHT hält auf dem Laufenden und die kleinen, grauen Hirnzellen in Schwung.
Mit Hilfe der Suchfunktion lassen sich einzelne Artikel rasch auffinden; dazu dient z.B. auf der MICROSOFT-Arbeitsoberfläche „WINDOWS“ die simultane Tastenkombination CTRL bzw. STRG (Control, Steuerung) und F (Find, Finde) zur Suche.
FÜR DEN EILIGEN LESER wiederholt sich – es ist schon fast langweilig! Wo ist der News-Wert? – das wöchentliche Mantra, denn summa summarum gibt es weiterhin nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball noch – noch! – immer “supertoll” geht.
Ganz so „supertoll“ geht es freilich nicht mehr zu, aber noch „toll“ genug. Doch die steckengebliebenen Containerfrachtschiffe, die fehlenden Lastkraftwagenfahrer, die mangelnden Chips für die Elektronikteile, die die Autoindustrie – und nicht nur diese – so dringend benötigt, fehlen. Meldungen dazu gab es in der zurückliegenden Woche in vielfacher Form. Genug Sand im Getriebe, um Preise steigen zu lassen und gleichzeitig die Wirtschaftsaktivitäten einzubremsen. Stagflationäre Warnleuchten glimmen auf.
Tatsächlich fordern Gewerkschaften kräftige Lohnerhöhungen – zumindest jene in Deutschland. Ein Startschuss für die von Zentralbanken gefürchteten und eine Geldentwertung befestigenden Zweitrundeneffekte?
Geöffnete Geldschleusen tun ein Übriges, wie die Empfehlung des Internationalen Währungsfonds (IWF) sie nahelegt. Doch Zentralbanker und Wirtschaftsforscher sind sich einig: die Inflation bleibt kein Dauergast, 2022 wird sie schon Geschichte sein. Auch der neue WIFO-Chef Felbermayr äußert sich mit Blick auf Österreich im gleichen Sinn. Nur wenige Experten sehen dies anders.
Reihum fielen die Wirtschaftsprognosen gedämpfter aus, vom IWF und der OECD über den New Yorker Konjunkturindex, von den stockenden Autoverkäufen in China und in der Eurozone zu den pessimistischer eingestellten Wirtschaftsprognostikern in Deutschland und Österreich gibt es eines zu hören: leichtes Jammern auf hohem Niveau. Auf Mittelfrist wird wohl der Rebound-getriebene Wirtschaftsboom enden und zu schwachen Wachstumsraten der Vorjahre zurückkehren, so Felbermayr vom österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut. Damit dürfte er nicht nur allein die österreichische Wirtschaftssituation der Jahre nach 2022, 2023 skizziert haben, sondern auch die von Europa. Doch zuvor werden die derzeit fragmentierten Wirtschaftsdynamiken der einzelnen Branchen wieder gekittet sein: Jubel in der produzierenden Industrie, banges Warten auf Umsätze bei den Dienstleistern, allen voran dem Tourismus- und Beherbergungsgewerbe. Tu felix Austria aber bewirte Deine ausländischen Gäste zahlreich – so könnte es, kommt nichts seitens der Pandemie dazwischen, Ende dieses Jahres heißen.
Einer Gratwanderung gleich scheinen die Bemühungen um die Eindämmung des CO2-Ausstoßes, welche wirtschaftlich sowohl dämpfend als auch antreibend, unterm Strich vermutlich positiv wirken. Grundproblem bleibt hier: wie lassen sich Konsumwünsche der seit langem in der westlichen Welt verwöhnten Nachfrager in Einklang mit einer wirkungsvollen Klimapolitik bringen? Kritische Stimmen meinen, dass dies nahezu unmöglich sei: die vorherrschenden sozial treibenden Kräfte stünden dem entgegen. Für die jüngeren und jüngsten Generationen ist das kein gutes Omen.
Wie gerne schaut man da Richtung Innovation: die Weiterentwicklung des Menschen zum technoiden Mensch, die digitale Anthropologie als Hoffnungsgebiet. Aber nicht nur: Digitalisierung und Kriminalität haben schon längst Hochzeit gehalten. Und soziale Medien sowie Digitalisierung erweisen sich nicht nur als segensreich, sondern für viele heimlich, still und leise als digitale Stasi, als digitalisiertes stählernes Gehäuse der Bürokratie und Quelle für Überlastung, als Ursache für Negativstress und Burnout; nicht zuletzt als gesellschaftsspaltender Keil: immer schneller, immer schneller, wer – atemlos geworden – nicht mithalten kann oder will, was dann?
…oooOOOooo…
ÜBERSICHT
- UMWELT – KLIMAWANDEL
- COP26 – Soziale Treiber machen 1,5-Grad-Ziel unplausibel – Dekarbonisierung vs. Konsum – Forscher zeichnen düsteres Bild mit Lichtblicken – Positive Aspekte vorhanden – Medieninteresse künftig garantiert
- COP26 – Vier Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit der Erderwärmung – Schaubilder
- Globale Beweiskarte zu Signalen des menschengemachten Klimawandels – Beweislücke aufgedeckt
- WHO: Ohne Klimaschutz droht medizinische Katastrophe
- Staudämme gefährden Süßwasser-Megafauna – Große Süßwassertiere vom Aussterben bedroht
- Corona – „Grüner“ Neustart würde CO2-Emissionen zumindest einbremsen – Neustart günstigstes Szenario
DIGITALE ANTHROPOLOGIE – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Forscher lassen neuronale Netze beim Deep Learning effizient arbeiten – Komplexität reduzieren – Pionierarbeit – Mensch nicht komplett ersetzbar
- Künstliche Intelligenz vollendete Beethovens 10. Sinfonie – Kollaboration zwischen Mensch und Maschine
- Künstliche Intelligenz sorgt für Behaglichkeit im Büro – Gleichzeitig auch Klima und Geldbörse schonen – Virtueller Sensor berechnet Behaglichkeit – Kombination aus KI- und Simulationsmodellen
- Exoskelett lässt Amputierte mühelos gehen – Neuentwicklung von Forschern der University of Utah gibt Betroffenen fehlende Kraft zurück – Halbes Dutzend testet – 2,5 Kilogramm schwer
CYBERCRIME – DATENÜBERGRIFFE - Umfrage: Viele Unternehmen ohne Notfallmanagement bei Cyberangriffen
- Deutschlands neuer Rekord: 6,2 Mrd. Euro für IT-Sicherheit – Allzeithoch liegt laut neuer IDC-Erhebung 2021 nochmals 9,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres – „Existenzielle Bedrohung“ – Löwenanteil Dienstleistungen
- Android: Heimliches Datensammeln belegt – Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme untersucht – Nutzer können nicht widersprechen – Datengier größer als erwartet – Gesetzgeber oftmals machtlos
MEDIEN - Auch Online-Medien informieren gut über Politik, Social Media weniger – Traditionelle Medien spielen weiterhin eine große Rolle – ORF beeinflusst Qualität der Konkurrenz
- Microsoft stellt Social-Media-Dienst LinkedIn in China ein – Ersatz durch einen Job-Board-Dienst ohne Social-Media-Funktionen – Sperrungen: Google seit 2010, Signal und Clubhouse ab 2021 – Nutzbar, aber weitgehend unbekannt sind für chinesische Nutzer*innen Umgehungen mittels VPN zu westlichen Diensten
- Facebook: Geheime Blacklist veröffentlicht – US-News-Seite „The Intercept“ zeigt Dokument zu gefährlichen Personen und Organisationen – „Unberechenbares System“ – 4.000 Personen und Gruppen
- Irische Datenschützer fordern von Facebook klarere Nutzungsbedingungen – Beschwerde gegen Verstecken der Datenpraktiken in Geschäftsbedingungen – Facebook will mehr Zeit, um Bedingungen zu ändern
SOZIOLOGIE - Ältere Menschen spenden mehr, aber an inländische Empfänger – Frauen und Ältere prosozialer – Spenden für Zwecke im eigenen Land – Warum das prosoziale Verhalten im Alter zunimmt
INTERNATIONAL - SCHULDENBREMSE (Pressepiegel / DJN, 14.10.2021) – Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen flexiblen Umgang mit den Schuldenregeln in Deutschland und Europa angemahnt. Eine verfrühte Sparpolitik würde „die wirtschaftliche Erholung beschädigen“ …
- IWF weist auf Warnsignale für Finanzstabilität hin
- IWF sieht weltweites Stabilitätsrisiko durch Evergrande
- Kraftwerke stellen wegen Gasknappheit auf Öl um – Nachfrage steigt
- Opec: Partner aus Opec+ werden 2021 weniger Öl als angenommen liefern
- Banger Blick Richtung Weihnachten: Lieferkettenchaos als doppelte Gefahr – Vor Containerumschlagplätzen bilden sich derzeit enorme Staus. Auch die Überlandlogistik ist teils in Turbulenzen
- Lieferengpässe bremsen PC-Absatz im 3. Quartal
- Getreidepreis steigt so stark wie zuletzt 2013
- IWF passt Wachstumsprognosen an und warnt vor US-Inflation – Weltwirtschaft dürfte 2021 und 2022 um 5,9 und 4,9 Prozent wachsen – IWF sieht Weltwirtschaftswachstum mittelfristig bei 3,3 Prozent – Wachsende pandemiebedingte Unterschiede zwischen Industrie- und Schwellenländern – Wachstumsprognose Deutschland jetzt 3,1 (3,6) bzw 4,6 (4,1) Prozent – Haltung der Fed gegenüber erhöhter Inflation unklar – IWF sieht Gefahr einer Entankerung der US-Inflationserwartungen
- OECD-Frühindikator September deutet auf schwächeren Aufschwung
- CLIs continue to point to a moderating pace of expansion in economic activity – Schaubild
- IEA: Regierungszusagen reichen nicht für Erreichen der Pariser Klimaziele
- With clock ticking, sustainable transport key to Global Goals
- Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Arbeitsmarktökonomen – Haben „empirische Forschung revolutioniert“ – Forschung hat „großen praktischen Nutzen“ – Erst ein österreichischer Preisträger – Die diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger
- IWF hält an Kristalina Georgiewa fest – Der Vorstand des Internationalen Währungsfonds spricht der geschäftsführenden Direktorin trotz Vorwürfen der Datenmanipulation sein Vertrauen aus
BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Ergebnisse des sentix Global Investor Survey 42-2021 – Sentimentimpuls
- Frank Heiniger: Small Caps versus Large Caps – Die Kleinen schwächeln – Chart des Tages
- Emission für Wiederaufbau: EU legt größte grüne Anleihe auf – Günstigere Finanzierungskonditionen – Deutscher Staat setzte bereits auf grüne Anleihen: 3-Milliarden-Aufstockung der 10-jährigen Anleihe noch im Oktober – Unterschiedliche Minusrenditen für unterschiedliche Laufzeiten
ZENTRALBANKEN und UMFELD
– INTERNATIONAL / FSB, BASEL IV - BASEL IV – Es braucht einen zweiten Backstop in Form des Output Floors. Nur so würde Basel IV die Kreditvergabe nicht übermäßig belasten, …
- FSB macht Vorschläge für Regulierung von Geldmarktfonds
– USA / FED - Fed-Protokoll: Anleihekäufe könnten bis Mitte 2022 enden
- FED: Clarida: Anleihekäufe könnten Mitte 2022 enden – FED Atlanta: Bostic warnt vor längerem Andauern der Inflation
- Larry Summers: Fed hinkt bei Inflationsrisiken-Bekämpfung hinterher
– CHINA / PBoC - Immobilienfirma vor dem Kollaps: Zentralbank: Evergrande-Gefahr „beherrschbar“
– SÜDKOREA - Bank of Korea bestätigt Zinsniveau
– SINGAPUR - Singapurs Zentralbank strafft unerwartet Geldpolitik
– TÜRKEI - Türkische Lira erreicht nach Entlassung von Notenbankern neues Rekordtief
– EUROPÄISCHE UNION / EZB - EZB: Deutlich höhere PEPP-Nettokäufe in der Vorwoche – Tabelle
- Deutsche Wirtschaftsinstitute erwarten bis 2023 keine EZB-Zinserhöhung – Nach Abklingen der Basiseffekte Einpendeln der Inflation um 2 Prozent – Volumen des entfallenden PEPP-Programms wird durch Aufstockung des APP-Programms aufgefangen werden – Neubelebung der TLTRO-Geschäfte – Geldpolitisch wird weder eine Expansion noch eine Restriktion erwartet – Skepsis bezüglich Inflationseinschätzung
- Villeroy de Galhau: Inflation sinkt bis Ende 2022 unter 2%
- Lane: EZB handelt bei „dauerhaft weit über 2% Inflation“
- EZB/Lane: Einmalige Lohnsteigerungen noch keine Spirale
- EZB-Ratsmitglied warnt vor Inflationsrisiken
- EZB/Enria sieht Anzeichen für schlechtere Asset-Qualität bei Banken
- EZB-Ratsmitglied Kazimir wehrt sich gegen Bestechungsvorwürfe
– DEUTSCHLAND / DBB, BdB, BAFIN - Abwicklung gefallener Banken: Bundesbank/Vizepräsidentin Buch verteidigt Ring-fencing bei Bankenregulierung – Finanzstabilitätsrisiko: Ohne Ring-fencing Filialisierung schwacher Banken im Gastgeberland leichter möglich – BAFIN-Buch kontra EZB: Ressourcen-Risiko-Balance halten, Abwicklungsregime stärken und glaubwürdiger gestalten
- BdB/Sewing: EZB sollte wegen Inflationsdruck Geldpolitik überdenken – Negativfolgen der Minuszinsen mildern – Günstiges Ausstiegsszenario aus NIRP-Politik: höhere Inflation wird länger bestehen bleiben
- Bafin-Chef Branson: Ungewollte Nebenwirkungen von Basel 3 verhindern
- BdB/Sewing: EU-Kommission hat bei gesetzlicher Umsetzung des Basel-Abkommens klare Haltung zu Output Floors – „Parallel Stack Approach“ lehnt EU-Kommission ab: Eigenkapitalanforderung und „Kleinrechnungs-Option“ für Banken in Diskussion
- BdB/Sewing will Investitionsoffensive und fairen Wettbewerb für Banken – Stärkere Abhängigkeit von globalen Banken wäre falsch – Globale Abhängigkeiten reduzieren
USA - USA droht Zahlungsunfähigkeit an Weihnachten – Chart des Tages
- Biden unterzeichnet Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze
- US-Repräsentantenhaus stimmt für Anhebung von Schuldenobergrenze
- USA drohen Iran in Atomstreit Konsequenzen an
- Hafen von Los Angeles soll wegen Lieferengpässen 24 Stunden am Tag laufen
- EIA: US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gestiegen
- API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände
- US-Importpreise ziehen spürbar an
- US-Erzeugerpreise steigen im September gegenüber dem Vormonat etwas weniger als erwartet, aber mit stärkstem Zuwachs seit 2010 auf Jahressicht
- US-Inflation steigt unerwartet auf 5,4 Prozent
- New Yorker Konjunkturindex fällt deutlicher als erwartet
- US-Konsumentenpreise steigen schneller – Vor allem stark gestiegene Energiepreise treiben – FED-Chef: inflationsbefeuernde Lieferketten-Engpässe nicht absehbar
- US-Realeinkommen steigen im September um 0,8 Prozent
- USA: Einzelhandel überrascht im September mit Umsatzanstieg
- Michigan-Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt
- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet
CHINA - Chinas Präsident pocht nach jüngsten Spannungen auf Wiedervereinigung mit Taiwan
- Erzeugerpreise in China mit stärkstem Anstieg seit über 20 Jahren
- Chinas Exporte ziehen im September stärker als erwartet an
- Chinas Autoverkäufe mit kräftigem Rückgang im September
- Immobilienfirma vor dem Kollaps: Zentralbank: Evergrande-Gefahr „beherrschbar“
JAPAN - JAPAN – Japans neuer Premierminister hat versprochen, das Land vom neoliberalen Fundamentalismus wegzubringen, während er das Versagen seiner eigenen Partei anprangerte, im Rahmen des Abenomics-Programms, das die Wirtschaft fast ein Jahrzehnt lang geprägt hat, ein breit angelegtes Wachstum zu erzielen.
IRAN - Iran will Gespräche mit EU über Atomverhandlungen in Brüssel fortsetzen
RUSSLAND - Putin: Russland bereit zu höheren Gasexporten
- Russland strebt CO2-Neutralität bis zum Jahr 2060 an
- Putin: Kämpfer aus Syrien und dem Irak kommen nach Afghanistan
- Putin nennt Diskussionen über seine Nachfolge „destabilisierend“
TÜRKEI - Türkei erstmals seit zwei Jahren mit Leistungsbilanzüberschuss
GROSSBRITANNIEN - Britisches BIP steigt im August weniger stark als erwartet
- London zeigt sich in Nordirland-Streit mit Brüssel unnachgiebig: britische Vorlage kommt Abschaffung bisheriger Regelungen gleich
SCHWEIZ - Hypozinsen steigen auf höchsten Stand seit Anfang 2019
EUROPÄISCHE UNION - Übertragungsnetzbetreiber: EEG-Umlage sinkt 2022 auf 3,723 Cent
- EEG-UMLAGE – Vor Bekanntgabe der geplanten EEG-Umlage für 2022 erwarten Experten wegen der Gegenfinanzierung mit CO2-Preiseinnahmen eine deutliche Absenkung.
- Euroraum-Industrieproduktion sinkt im August um 1,6 Prozent
- Autoabsatz in Europa bricht im September ein
- EU schlägt in Streit um Nordirland-Protokoll gelockerte Warenkontrollen vor
- EU-Kommission legt Vorschläge gegen hohe Energiepreise vor
- EU-Kommission fordert Mitgliedsstaaten wegen hohen Energiepreisen zu Steuersenkungen auf
- Europaparlament: Ja zu EuGH-Klage gegen Kommission
POLEN - POLEN – Der frühere polnische Außenminister Witold Waszczykowski warnt vor einer weiteren Eskalation im Streit seines Landes mit der Europäischen Union. Falls die EU-Kommission Gelder aus dem neu geschaffenen Wiederaufbaufonds zurückhalte, könnte die polnische Regierung ihrerseits Zahlungen an die EU einstellen.
- Polens Regierungschef will nach umstrittenem Urteil vor EU-Parlament sprechen
ITALIEN - Italien: Inflation zieht weiter an
- Italiens Industrieproduktion sinkt im August
FRANKREICH - Frankreich: Inflation zieht weiter an
- Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister fordert Ausbau der Atomkraft in Europa
- Paris droht im Fischereistreit mit London mit „Vergeltungsmaßnahmen“
DEUTSCHLAND - KREDITKOSTEN – Verbraucher können nach Angaben des Vergleichsportals Verivox derzeit Kredite deutlich unter der Inflationsrate aufnehmen. „Dass eine Mehrheit ihren Ratenkredit zu Zinsen unterhalb der laufenden Teuerung abschließen kann, ist eine historische Ausnahmeerscheinung“, …
- Deutsche HVPI-Teuerung steigt im September wie erwartet auf 4,1%
- Deutschland: Energiepreise steigen stark – Inflationsrate über 4 Prozent
- HWWI: Starke Preisanstiege bei Rohöl, Kohle und Erdgas – Preise für Rohöl schießen in die Höhe – Industrierohstoffe billiger
- Bundesregierung sieht keine Engpässe bei Gasversorgung
- Mieterbund und Verbraucherschützer warnen vor „Nebenkostenexplosion“
- Deutsche Großhandelspreise mit stärkstem Anstieg seit 1974
- INFLATION – Angesichts immer höherer Energiepreise rechnet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer mit einem weiteren Anstieg der allgemeinen Inflation in den nächsten Monaten.
- ROHSTOFFKOSTEN – Preissteigerungen bei wichtigen Rohmaterialien und Vorprodukten werden sich bis weit in das Jahr 2022 hinein fortsetzen. Darauf stellen sich zumindest zahlreiche deutsche Industrieunternehmen ein.
- AUTOZULIEFERER – Die Chipkrise in der Autoindustrie zieht die ganze Zuliefererindustrie in Mitleidenschaft.
- BAUSTOFFE – Hausbauer müssen sich noch länger auf eine angespannte Lage bei der Verfügbarkeit von Baustoffen einstellen. „Baumaterialien wie Isolation sind in Europa und Nordamerika ausverkauft“, …
- Ifo: Einzelhandel klagt über Lieferprobleme
- MAKRO TALK/VP Bank: Deutsche Industrie hat bessere Zeiten vor sich
- Institute erwarten für 2021 geringeres und für 2022 höheres Wachstum – Straffung der Geldpolitik könnte notwendig werden – Gebremste Erholung im Winterhalbjahr – Haushaltsdefizit verringert sich bis 2023 spürbar – Weltproduktion wächst langsamer, lebhafter Warenhandel – Arbeitslosenquote sinkt schrittweise und kontinuierlich
- Institute senken deutsche Wachstumsprognose für 2021
- ZEW-Konjunkturerwartungen sinken bereits zum fünften Mal – deutlich schlechtere Lagebeurteilung
- Autoproduktion: 40 Regionen laut IW besonders vom Aus für Verbrenner betroffen – Politik soll Standortfaktoren verbessern und Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen fördern – 53% der in der Automobilwirtschaft Beschäftigten betroffen – Ökonomen sind zuversichtlich: Wandel in Richtung Nachhaltigkeit ist möglich – Unternehmen investieren bereits jetzt viel in Weiterbildung – Unternehmenskooperation angemahnt
- Bundesländer mit Opel-Standorten fordern Zukunftsperspektive
- Deutsche Reifenproduktion erreicht Tiefststand – Rückgang um 40,6 Prozent gegenüber 2015 – Corona-Pandemie und Chip-Lieferprobleme schuld – Trend setzt sich fort – Rohstoffpreise ziehen an
- Bitkom: Markt für IT-Sicherheit stellt neue Umsatzrekorde auf
- EINZELHANDEL – Trotz der gedämpften Konjunkturerwartungen für die Wirtschaft insgesamt hält der Einzelhandelsverband (HDE) an seiner Prognose fest, wonach der deutsche Einzelhandel in diesem Jahr insgesamt ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent verzeichnen wird.
- Bitkom: Deutscher Handel wegen Corona-Effekt so digital wie nie
- Umfrage: 50 Prozent mehr Leerstand in deutschen Innenstädten erwartet
- Große Unterschiede bei Unternehmensplänen zur Zukunft des Homeoffice
- Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt um 6 Prozent
- IW: Privater Konsum bleibt weiter auf Erholungskurs – Ungemach droht von der Inflation
- Studie: Deutschland bei Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung deutlich über EU-Schnitt
- MINIJOBS – Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, wonach Arbeitgeber geringfügig Beschäftigte nicht entschädigen müssen, wenn sie ihr Unternehmen aufgrund einer Corona-Verordnung zur Eindämmung der Pandemie schließen müssen, dringt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf eine Minijob-Reform.
- LOHNFORDERUNGEN – Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat angesichts der hohen Inflationsrate „deutlich spürbare Reallohnsteigerungen“ gefordert.
- IG BAU: Einigung im Tarifstreit im deutschen Baugewerbe erzielt – Kompromiss: gestaffelte Inflationsabgeltung bis April 2023
- IG BAU erhöht vor zweiter Schlichtungsrunde im Tarifstreit Druck auf Arbeitgeber
- Verdi sagt Tarifrunde mit privaten Banken ab
- Tarifverhandlungen für Ärzte in kommunalen Kliniken begonnen – Marburger Bund fordert 5,5 Prozent mehr Gehalt
- SCHULDENBREMSE – Die Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Münchner Ifo-Instituts, Marcel Fratzscher und Clemens Fuest, haben eine einmalige hohe Kreditaufnahme im Jahr 2022 gefordert, aus der eine Rücklage für Zukunftsinvestitionen gebildet werden soll.
- EINKOMMENSTEUER – Der Bund der Steuerzahler fordert wegen der hohen Inflationsrate eine zusätzliche Anpassung des Einkommensteuertarifs 2022 um mindestens drei Prozent.
- Kommunen erwarten für 2021 Defizit von 7 Milliarden Euro
- Merkel wirbt bei Wirtschaft um EU-China Abkommen – Boom bei Handelsabkommen
- LITHIUM – Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech will schon im nächsten Jahr mit dem Bau der bislang größten Lithium-Fabrik Europas beginnen.
- Flughafen Frankfurt mit deutlichem Passagierplus auch im September
ÖSTERREICH
– STATISTIK - Baukosten im September 2021 weiter gestiegen
- Transportaufkommen auf Österreichs Straßen 2020 um 7,7% gesunken
- Ein Fünftel weniger Pkw-Neuzulassungen im September 2021
- Erheblich weniger Abschüsse und Wildverluste in der Jagdsaison 2020/2021
– PARLAMENTSKORRESPONDENZ - Die Parlamentswoche vom 17. bis 22. Oktober 2021 – Bundesrat, Ausschüsse, internationale Termine, Politik am Ring, Bundesrats-Enquete, Pressekonferenz zum neuen BesucherInnen-Zentrum
……………… - Bundeskanzler Schallenberg ruft zum gemeinsamen Arbeiten auf – Sondersitzung des Nationalrats: Opposition hält ÖVP-Obmann Kurz schwere Vergehen vor – Schallenberg: Politisches Taktieren muss enden – Kogler: Österreich braucht Stabilität – SPÖ: Regierungsumbildung ist eine Farce – ÖVP: Vorwürfe gegen Kurz werden sich als falsch erweisen – FPÖ spricht gesamter Regierung Misstrauen aus – Regierungskrise für Grüne überwunden – NEOS für Abgrenzung und Neustart – 12.10.2021
- Blümel: Budget 2022 bringt Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit – Finanzminister Blümel hält Budgetrede im Parlament – Corona-Krise: Budgetäre Verantwortung für nächste Generationen tragen – 2022 – 2025: Schuldenquote Richtung 70% senken – Steuerreform als Beitrag zum Schuldenabbau – Mehr Geld für Bundesheer und Außenministerium – Schuljahr 2023/24: Elektronische Geräte für Unterstufe – Generalsanierung der Festspielhäuser Salzburg und Bregenz budgetiert – 13.10.2021
u.v.a.m.
– MELDUNGEN - Schallenberg als neuer österreichischer Bundeskanzler vereidigt
- Schallenberg tritt Nachfolge von Kurz als Regierungschef in Wien an
- Nationalbank veröffentlicht aktuelle Inflationsprognose für 2021 und 2022: Steigende Rohstoffpreise sorgen für höhere Inflation – OeNB erwartet schrittweise Entspannung bereits im Jahr 2022 – Rohstoffpreisbedingter Inflationsanstieg setzte sich weiter fort – OeNB hebt Inflationsprognose für 2021 auf 2,4 % und für 2022 auf 2,2 % an – Teilweise beträchtliche Preisunterschiede bei identischen Produkten im grenznahen Raum – OeNB, 6.10.2021
- Vierte COVID-19-Welle bremst kräftigen Aufschwung – Sektorale Unterschiede – Winterhalbjahr: Unsicherheit durch Pandemie – 2022e-BIP-Wachstum plus 4,8 Prozent – Deutschland (Autoindustrie) leidet stärker unter Lieferkettenproblemen als Österreich (Tourismus, Beherbung) – Arbeitsmakrt im Wandel: aus Arbeitskräfteüberschuss wird Nachfragenot
- Die österreichische Wirtschaft schaltet bei hohem Erholungstempo einen Gang zurück – Unterschiedliche Sektortrends halten an – BIP-Anstieg verlangsamt sich zum Jahresende 2021 hin – UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator sinkt im September auf 4,6 Punkte, liegt jedoch weiter klar über langjährigem Durchschnitt – Unterschiedliche Sektortrends halten an – BIP-Anstieg verlangsamt sich zum Jahresende 2021 hin – Konsum wird 2022 die treibende Kraft – Geldpolitik bleibt locker trotz höherer Inflation – Verbesserung am Arbeitsmarkt wird zäher mit Risiken über den Winter im Dienstleistungssektor – Schaubilder
- Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex – WWWI: 38. und 39. Kalenderwoche 2021 – Schaubilder
- Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB KW 36 bis 40 – Wirtschaftsleistung im September knapp über Vorkrisenniveau – Schaubild
- OeNB-Exportindikator: Exporte im August und September weiterhin deutlich über Vorkrisenniveau
Ergebnisse des OeNB-Exportindikators vom Oktober 2021 - Steuerreform für 2022 bis 2024 – Ersteinschätzung des WIFO
- Bargeld bleibt weiterhin beliebtestes Zahlungsmittel im Handel – Kontaktlose Kartenzahlungen in der Pandemie signifikant gestiegen – Trend bei Kartenzahlungen beschleunigt – Kleinbeträge werden in bar bezahlt – Allgemeines zur Zahlungsmittelumfrage 2020
- Bargeld immer noch gefragt, kontaktlose Kartenzahlungen auf dem Vormarsch – OeNB-Studie liefert neue Erkenntnisse über Zahlungsverhalten während COVID-19-Pandemie
- Forschungsdaten: Neues „Mikrodatenzentrum“ im Ministerrat beschlossen – Statistik Austria stellt Daten zur Verfügung – Forschungseinrichtungen dürfen Daten nicht speichern
KOMMENTARE AUS FREMDEN FEDERN - Paola Subacchi: Finanzkrise «Made in China» – Kann China die Evergrande-Krise eindämmen und verhindern, dass ihre Folgen die globalen Finanzmärkte belasten? – Wie das Fed 2008 – Regierung interveniert regelmässig – Schaden für den Renminbi – Wird das Rettungsnetz halten?
DOSSIER – ÖSTERREICHISCHE REGIERUNGKRISE UND KANZLERROCHADE, TEIL 2
Inhaltsverzeichnis siehe dort
…oooOOOooo…
UMWELT – KLIMAWANDEL
COP26 – Soziale Treiber machen 1,5-Grad-Ziel unplausibel – Dekarbonisierung vs. Konsum – Forscher zeichnen düsteres Bild mit Lichtblicken – Positive Aspekte vorhanden – Medieninteresse künftig garantiert – Science-APA, 15.10.2021
Ab 31. Oktober soll bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow all das realisiert werden, worauf sich die Staatengemeinschaft vor zwei Jahren in Madrid bei der COP25 nicht einigen konnte. Es herrscht Aufholbedarf, denn in Spanien gelang Einiges nicht: Weder der Wunsch der Entwicklungsländer und Inselstaaten auf einen internationalen Fonds zur Bewältigung realisierter Klimaschäden erfüllte sich, wie auch die Ausgestaltung von Artikel 6 des Pariser Klimavertrags erneut scheiterte.
Selbst wenn das Ziel der Vereinten Nationen, die Erderhitzung bei 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, technisch und ökonomisch noch möglich erscheint, so ist das Ziel dennoch gesellschaftlich unplausibel. Zu diesem Ergebnis ist heuer im Juni eine Studie des Forschungsclusters Climate, Climatic Change and Society (CLICCS) der Universität Hamburg gekommen. Die Forscherinnen und Forscher haben untersucht, ob die sozialen Treiber ausreichen, bis 2050 die Dekarbonisierung zu schaffen.
*** Dekarbonisierung vs. Konsum ***
Einige der Triebkräfte – nämlich etwa die Klimapolitik der Vereinten Nationen oder transnationale Initiativen – würden die Dekarbonisierung zwar unterstützen, „aber ohne ausreichende Dynamik, um eine tiefe Dekarbonisierung bis 2050 voranzutreiben“. Darüber hinaus stünden zwei weitere Triebkräfte – Konsummuster und Unternehmensreaktionen – der Dekarbonisierung derzeit noch entgegen.
„Daher stellen wir fest, dass eine weltweite tiefe Dekarbonisierung bis 2050 nicht plausibel ist, wenn die Rahmenbedingungen diese Treiber in den kommenden Jahren nicht radikal ankurbeln“, heißt es in der Zusammenfassung der Studie. „Das Ergebnis impliziert, dass, selbst wenn technisch-ökonomische Optionen für die Dekarbonisierung theoretisch verfügbar sind, das Erreichen einer tiefen Dekarbonisierung bis 2050 eine gesellschaftliche Herausforderung darstellt, die möglicherweise viel größer ist als von vielen angenommen.“ Mit tiefer Dekarbonisierung meinen die Wissenschafter eine Netto-Null-Bilanz der Kohlendioxidemissionen, bei der sich die Mengen an emittiertem und absorbiertem Kohlendioxid aufheben.
*** Forscher zeichnen düsteres Bild mit Lichtblicken ***
Da das Klima zudem stärker auf die Treibhausgase reagiert als bisher angenommen und es Stand heute unwahrscheinlich ist, dass die Menschheit den CO2-Ausstoß in diesem Jahrhundert auf niedrigem Niveau hält, kommen die Autoren in ihrem Ausblick zu folgendem Schluss: „In Kombination mit dem kürzlich identifizierten, engeren Bereich der Klimasensitivität deutet dies darauf hin, dass eine Begrenzung der globalen Oberflächenerwärmung unter etwa 1,7 Grad bis 2100 derzeit nicht plausibel ist.“ Andererseits sei es auch unplausibel, dass sich die Erde bis Ende Jahrhunderts um mehr als 4,9 Grad erwärmt.
*** Positive Aspekte vorhanden ***
Die Forscher zeichnen jedoch nicht nur ein düsteres Bild. Denn sechs der insgesamt zehn bewerteten sozialen Treiber würden zumindest in die richtige Richtung zeigen und hätten damit Potenzial, die gesellschaftlichen Normen zu verändern. Zumindest eine teilweise Dekarbonisierung bis Mitte der Jahrhunderts sei deshalb plausibel.
Als einen der zehn sozialen Treiber identifizierte das Forscherteam um den Ozeanografen und Klimawissenschafter Detlef Stammer übrigens auch den professionellen Journalismus. Soziale Medien wurden bewusst beiseitegelassen, da Zeitungen, Radio, Fernsehen und deren Online-Auftritte für viele Menschen nach wie vor die Hauptquelle für Informationen über den Klimawandel seien. Zwar sei der Effekt einzelner Artikel begrenzt, die kumulative Wirkung von Nachrichten über längere Zeit habe aber großes Potenzial bei der Dekarbonisierung. Der Klimawandel habe zwischen 2006 und 2009 viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, diese sei dann jedoch wieder gesunken – bis es 2018 und 2019 zu extrem heißen und trockenen Sommern kam und weltweit junge Menschen angeführt von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg auf die Straße gingen.
*** Medieninteresse künftig garantiert ***
Da das zukünftige Auftreten von Dürren und anderer klimabedingter Katastrophen fast sicher sei, sei auch eine anhaltende Medienaufmerksamkeit für den Klimawandel garantiert. Abseits der von Klimaschäden, Protesten oder Klimakonferenzen getriebenen Berichterstattung sei das Level der Medienberichterstattung bei nur einem Prozent aller publizierten Artikel über die Jahre unverändert geblieben. Außerdem habe die Ausgewogenheitsnorm im Journalismus lange Zeit als Eintrittspforte für die Leugnung des Klimawandeln gedient.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/16968138310063570103
COP26 – Vier Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit der Erderwärmung – Science-APA, 15.10.2021
Erste wissenschaftliche Erkenntnissen zum Klimawandel gab bereits im Jahr 1896, als der schwedische Chemiker Svante Arrhenius einen Zusammenhang zwischen der Verbrennung fossiler Brennstoffe und Kohlendioxid registrierte. Eine Art Vorgänger zum Klimagipfel fand dann 1979 unter der UNO in Genf statt, bereits damals wurde der Klimawandel als ein vordringlich zu lösendes Problem gesehen.
GRAPHIK: https://secure-psas.apa.at/apascience/?RZqtB97RbD7vYHzIr2cghLRl_gLa7_OF8S31I5MZyMfnrG5U984atK4R0pjBHvPkUXggN8LvH6J9rm8nTzvZFUoQArQ7cATzhUAJMYxX7dbIrXBMp9mb-Si8
1979 – Ein Bericht der Nationalen Akademie der Wissenschaften in den USA beschreibt den Zusammenhang zwischen Treibhauseffekt und Erderwärmung und warnt vor einer „Politik des Abwartens“.
1988 – Die UNO gründet den Klimabeirat IPCC. Er soll wissenschaftliche Fakten zum Klimawandel sammeln.
1990 – Der erste IPCC-Expertenbericht stellt eine vom Menschen verursachte Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre fest und sagt eine Erderwärmung voraus.
1992 – Auf dem UN-Gipfel in Rio de Janeiro gründen die Vereinten Nationen ihr Klimarahmensekretariat (UNFCCC) und rufen zu einer freiwilligen Drosselung der Treibhausgas-Emissionen auf.
1997 – Bei einem Klimagipfel in Japan wird das Kyoto-Protokoll ausgehandelt. Die Teilnehmerländer verpflichten sich, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2012 unter den Stand von 1990 zu drosseln.
2000 – Wissenschafter halten fest, die 1990er-Jahre seien das heißeste Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen.
2001 – Der dritte IPCC-Bericht bezeichnet es als wissenschaftlich unbestreitbar, dass die Erderwärmung vom Menschen verursacht wird.
2005 – Das Kyoto-Protokoll tritt am 16. Februar in Kraft, nachdem es von Russland als 55. Staat ratifiziert wurde. Die USA waren 2001 ausgestiegen.
2007 – Der IPCC kommt in seinem vierten Bericht zu alarmierenden Befunden: Gletscherschmelze, steigende Meeresspiegel und Naturkatastrophen sind Folge des Klimawandels. Die Temperatur werde bis 2100 um 1,8 bis 4,0 Grad steigen.
2009 – Die Klimakonferenz von Kopenhagen scheitert mit dem Versuch, eine weltweite Fortschreibung des Kyoto-Protokolls für die Jahre ab 2012 zu vereinbaren. Beschlossen werden jährliche Transferleistungen für den Klimaschutz in den Entwicklungsländern in einer Größenordnung von 100 Milliarden Dollar pro Jahr.
2014 – Der IPCC warnt vor einer Erderwärmung zwischen 3,7 und 4,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts.
2015 – Die UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris beschließt das erste Klimaschutzabkommen, in dem alle Staaten eigene Beiträge im Kampf gegen die Erderwärmung zusagen. Diese soll auf „deutlich unter zwei Grad“ begrenzt werden, möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.
2018 – Die UN-Klimakonferenz in Katowice (Kattowitz) zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens einigt sich auf das „Rulebook“, also auf die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. In Polen entsteht eine Kompromisslösung mit Lücken, vor allem der Artikel 6 bleibt ungelöst.
2019 – Die UN-Klimakonferenz in Madrid droht fast zu scheitern, ungelöst bleibt erneut der Artikel 6 des Pariser Abkommens zum Emissionshandel. Dieser Artikel sieht vor, dass die Länder auch Marktmechanismen zur Steigerung und Umsetzung ihrer nationalen Klimaschutzbeiträge, der sogenannten NDCs, nutzen können. Erneut wird die Entscheidung darüber vertagt.
2020 – Die Corona-Pandemie führt zur Verschiebung der UN-Klimakonferenz von Glasgow in Schottland.
2021 – Anfang August legt die IPCC den ersten Teil ihres aktuellen Sachstandsberichts vor: Selbst bei unmittelbarer Umsetzung rigider Maßnahmen zum Klimaschutz werde der Temperaturanstieg vorerst weitergehen: Sogar im günstigsten Szenario rechnen die Forscher bis Ende des Jahrhunderts mit einer mittleren Temperatur von 1,0 bis 1,8 Grad Celsius über dem vorindustriellem Niveau.
GRAPHIK: https://secure-psas.apa.at/apascience/?_XPtcb4deOzoQtDg6Q_tTi133aUnAOwwZ3o8JD05PT8Qo4ttk9egPXbM-l2gOe21AUbuupf2dAb0Gms6uaaIkCFFpQ2drmcMd7Yqf3zJerowHAmmQGyBJ7UfRVJabw==
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/16895184211235409892
Globale Beweiskarte zu Signalen des menschengemachten Klimawandels – Beweislücke aufgedeckt – Science-APA, 11.10.2021
85 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Gebieten, wo die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels bereits spürbar sind. Das betrifft achtzig Prozent der globalen Landfläche, ausschließlich der Antarktis, wie aus einer groß angelegten Literaturrecherche hervorgeht.
Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Auswirkungen des Klimawandels bereits auf der ganzen Welt zu beobachten sind. Seit dem ersten Sachstandbericht des Weltklimarats (IPCC) im Jahr 1990 stieg die Zahl der veröffentlichten Studien, die sich mit damit befassen, um mehr als zwei Größenordnungen jährlich.
Um diesem Wust an Fachartikeln beizukommen und die Evidenz herauszukristallisieren, führte das Team um Max Callaghan vom Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) mit Beteiligung der ETH Zürich eine systematische Literaturrecherche mithilfe des maschinellen Lernens durch. So werteten die Forschenden 102.160 Studien aus, die die Auswirkungen des Klimawandels weltweit dokumentieren. Von den Ergebnissen und der erstellten Beweiskarte berichten sie im Fachmagazin „Nature Climate Change“.
*** Beweislücke aufgedeckt ***
Die Autorinnen und Autoren deckten auch eine Beweislücke auf. Demnach gebe es in Ländern mit hohem Einkommen fast doppelt so viele belastbare Beweise für die vom Menschen verursachten Auswirkungen des Klimawandels wie in Ländern mit niedrigem Einkommen. Dies sei nicht darauf zurückzuführen, dass in diesen Gebieten der anthropogenen Klimawandel keine Spuren hinterlasse, sondern darauf, dass diese Orte weniger intensiv untersucht würden, schreiben die Forschenden.
Der neu gewählte, auf maschinellem Lernen beruhende Ansatz ersetze zwar keine sorgfältige Überprüfung der wissenschaftlichen Literatur durch Expertinnen und Experten, wie sie etwa der Weltklimarat (IPCC) durchführe. Im Zeitalter der „Big Literature“ stelle er jedoch eine unschätzbare Ergänzung dar, schließen die Autoren in ihrer Studie.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/11333581096288530642
SIEHE DAZU:
=> Studie
QUELLE: https://www.nature.com/articles/s41558-021-01168-6
WHO: Ohne Klimaschutz droht medizinische Katastrophe – Deutsches Ärzteblatt, 11.10.2021
Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer medizinischen Katastrophe gewarnt. Der Klimawandel stelle die größte Gesundheitsbedrohung der Menschheit dar, heißt es in einem heute in Genf veröffentlichten Sonderbericht.
Die Folgen bekämen vor allem die am meisten verletzlichen und benachteiligten Menschen zu spüren. Flankierend forderten in einem Schreiben 300 Organisationen, die 45 Millionen Ärzte und medizinische Fachkräfte repräsentieren, Regierungen und die Delegationen der Klimakonferenz zu entschlossenerem Handeln auf.
Dieselben nicht nachhaltigen Entscheidungen, die den Planeten töteten, töteten auch Menschen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus. Eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad sei „in unserem eigenen Interesse“.
Die WHO betonte, immer häufigere Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen beträfen Millionen von Menschen direkt, gefährdeten Gesundheitssysteme, bedrohten die Ernährungssicherheit und gäben zahlreichen Krankheiten Auftrieb; zudem wirke sich der Klimawandel auch auf die psychische Gesundheit aus.
Nachdrücklich verlangte die WHO eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. Über die Emission von Treibhausgasen hinaus sei die damit zusammenhängende Luftverschmutzung statistisch für den Tod von 13 Menschen pro Minute verantwortlich. Eine Absenkung der Luftschadstoffe auf WHO-Grenzwerte könne die Zahl dieser Todesfälle um 80 Prozent mindern.
Konkret rief die Weltgesundheitsorganisation in zehn Punkten zu einem Klimaschutz auf, der Gesundheit und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen müsse. Dies betrifft laut WHO auch die Stadt- und Verkehrsplanung, den Schutz von Naturräumen sowie gesunde und nachhaltige Ernährungssysteme. © kna/dpa/aerzteblatt.de
QUELLE: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128073/WHO-Ohne-Klimaschutz-droht-medizinische-Katastrophe
Staudämme gefährden Süßwasser-Megafauna – Große Süßwassertiere vom Aussterben bedroht – Science-APA, 14.10.2021
Der Bau von Dämmen, Straßen und Häusern entlang von Fließgewässern führt zum Verlust von frei fließenden Flüssen und den damit verbundenen aquatischen Lebensräumen. Dadurch sind große Wassertiere mit 30 Kilo und mehr, die sogenannte Süßwasser-Megafauna, gefährdet, warnen Wissenschafter, darunter der österreichische Gewässerökologe und Generaldirektor der deutschen Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Klement Tockner, im Fachjournal „Biological Conservation“.
Süßwasser-Ökosysteme bedecken weniger als ein Prozent der Erdoberfläche, beherbergen aber mehr als zehn Prozent aller Arten und ein Drittel aller Wirbeltierarten. Doch die biologische Vielfalt in diesen Lebensräumen ist massiv bedroht, ihr Rückgang sei doppelt so stark in den Gewässern wie am Land oder im Meer, warnten Wissenschafter im Vorjahr bei der Vorlage eines Notfallplans zum Schutz und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in den Gewässern.
Nun verweist ein Forscherteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin auf die andauernde Fragmentierung von Flüssen: Mehr als 3.400 große Wasserkraftwerke mit über einem Megawatt Leistung sind entweder geplant oder im Bau. Sollten sie alle realisiert werden, würden sie über 600 heute noch frei fließende Flüsse, die länger als 100 Kilometer sind, zerschneiden.
*** Große Süßwassertiere vom Aussterben bedroht ***
Besonders betroffen wären frei fließende Flüsse mit über 500 Kilometern Länge, die große Süßwassertiere beherbergen: 19 Prozent würden ihren frei fließenden Status verlieren. Über 260 neue Staudämme würden dann 75 große Flüsse wie den Amazonas, Kongo, Salween und Irrawaddy zerschneiden. Dadurch würden Wanderrouten der Süßwasser-Megafauna blockiert, was zu einer verminderten Fortpflanzung und genetischer Isolation führt.
„Megafauna-Arten, in deren Verbreitungsgebiet die frei fließenden Flüsse nur eine geringe Länge haben, sind mit größerer Wahrscheinlichkeit vom Aussterben bedroht“, erklärte der Erstautor der Studie, Fengzhi He, vom IGB. Er verweist auf die komplexen Anforderungen, die große Süßwassertiere an ihren Lebensraum haben. „Sie sind an das natürliche Fließverhalten angepasst, und viele müssen zwischen verschiedenen Lebensräumen wandern, um ihren Lebenszyklus zu vollenden“, so der Wissenschafter.
Als Beispiel nennt er die Laich-Wanderung der meisten Störarten vom Meer in die Flüsse. Die Verbindung zwischen Meer- und Süßwasser sei für ihr Überleben unerlässlich. Auch andere große Fischarten wie der Mekong-Riesenwels und der Platin-Spatelwels würden über weite Strecken wandern, um sich fortzupflanzen. „Daher sind sie besonders anfällig für eine verminderte Durchgängigkeit“, so Fengzhi He.
Neben den wandernden Fischen seien auch andere große Tierarten wie Flussdelfine, Krokodile, Schildkröten und Riesensalamander gefährdet. So haben Staudämme beispielsweise zu einer starken Fragmentierung und Verschlechterung des Lebensraums des Gangesgavials geführt. Und durch Straßen, Gebäude und andere Infrastrukturen unterbrochene Verbindungen zwischen Flüssen und Ufergebieten führen zum Verlust von Lebensraum und erhöhter Sterblichkeit bei Krokodilen und Schildkröten.
Die Wissenschafter plädieren daher dafür, bei der Planung von Staudämmen zwischen der Integrität der Ökosysteme und der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen abzuwägen. Potenzielle Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, insbesondere auf bedrohte und empfindliche Arten, müssten dabei berücksichtigt werden.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/6324812470628652057
SIEHE DAZU:
=> Studie
QUELLE: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109335
Corona – „Grüner“ Neustart würde CO2-Emissionen zumindest einbremsen – Neustart günstigstes Szenario – Science-APA, 11.10.2021
Was vom coronabedingten zeitweisen Minus beim Energieverbrauch und des CO2-Ausstoßes übrig bleiben könnte, haben Forscher analysiert. Würde man positive Effekte, wie weniger Treibhausgasemissionen durch reduziertes Verkehrsaufkommen, längerfristig mitnehmen, könnte man die steigenden Emissionen zumindest bremsen. Vom Weg in Richtung der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf rund 1,5 Grad Celsius wäre man aber trotzdem weit entfernt, heißt es im Fachblatt „Nature Energy“.
Klar ist, dass der Einbruch der Treibhausgasemissionen vor allem während der pandemiebedingten Lockdowns im Jahr 2020 der bisher stärkste in einem Jahr war. Ob diese Entwicklung auf dem Weg aus der Krise aufrechterhalten werden kann, sei unklar, heißt es in einer Aussendung des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien. Allzu viel Hoffnung auf einen Beitrag zum Umschwung gibt es momentan jedoch nicht: Für Österreich rechneten Forscher kürzlich mit einer Rückkehr auf das hohe CO2-Ausstoßniveau von 2019 bereits für heuer.
Wenn die Gesellschaft einfach zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehrt, werde der Treibhausgas-Knick durch die Krise „nahezu keinen Effekt“ auf das Klima haben, so Studienleiter Jarmo Kikstra vom IIASA: „Allerdings hat es einen Einfluss auf die Herausforderungen, die das Begrenzen des Klimawandels mit sich bringt, wenn manche günstige Energienutzungsmuster weiter bestehen blieben.“ Gelingt es der Weltgemeinschaft umgekehrt nicht, ein paar für die Klimaentwicklung positive Kriseneffekte längerfristig mitzunehmen, wird es der Analyse nach nochmals schwerer, die Klimaziele zu erreichen.
*** Neustart günstigstes Szenario ***
Die Wissenschafter haben vier Szenarien zum Post-Corona-Neustart durchgerechnet. Diese reichten von einem Business-as-usual-Szenario, mit weiter hoher Nutzung von Privatautos, hohem Flugverkehrsaufkommen, keinen Veränderungen in der Industrieproduktion und der Lieferketten und keinen Auswirkungen auf unser Alltags- und Berufsleben, bis zu einem „grünen“ Neustart. Bei letzterem würde der Energiebedarf – vulgo CO2-Ausstoß – am meisten absinken, wenn etwa durch vermehrte Telearbeit das Verkehrsaufkommen reduziert, Menschen beispielsweise mehr Online-Konferenzen abhalten und deshalb weniger fliegen, der öffentliche Verkehr deutlich zunimmt oder die Industrieproduktion effizienter sowie Lieferketten kürzer werden.
Tritt jedoch ersteres Szenario ein, bräuchte es bis 2030 Investitionen in den Energiesektor die rund 1,8 Billionen Dollar (1,5 Billionen Euro) höher sind, als beim „grünen“ Neustart, wenn es in Richtung 1,5 Grad-Ziel gehen soll. Mit dem Geld müsste etwa der Verkehrssektor mit deutlich größerem Aufwand elektrifiziert und Stromproduktion aus Solar- und Windkraft drastisch erhöht werden.
Insgesamt weist aber auch die „grünste“ Post-Covid-Projektion der Wissenschafter nicht in die Richtung, die es zum deutlichen Eindämmen der Erderwärmung bräuchte. Denn selbst in dieser Rechenvariante steigen die CO2-Emissionen nach dem Knick bis 2035 wieder an.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/8384487246779669005
SIEHE DAZU:
=> Studie
QUELLE: https://doi.org/10.1038/s41560-021-00904-8
DIGITALE ANTHROPOLOGIE – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Forscher lassen neuronale Netze beim Deep Learning effizient arbeiten – Komplexität reduzieren – Pionierarbeit – Mensch nicht komplett ersetzbar – Science-APA, 11.10.2021
Wenn es darum geht, dem Computer komplexes Denken beizubringen, spielen künstliche neuronale Netze eine wichtige Rolle. Sie sind besonders gut in der Lage, große Mengen unstrukturierter Daten wie Bilder, Videos oder Töne auszuwerten und Muster in ihnen zu finden. Doch der Prozess ist rechenaufwendig. Eine Grazer Gruppe von KI-Experten hat erfolgreich nach Wegen gesucht, die Komplexität der Rechnungen zu reduzieren.
Künstliche neuronale Netzwerke sind eine mathematische Nachbildung der biologischen Reizverarbeitung und -weiterleitung im Nervensystem zum Zweck des maschinellen Lernens. Sie lösen heute bereits eine Vielzahl komplexer Aufgaben, in dem sie primär durch die Analyse großer Datenmengen lernen: Etwa neuartige Vorhersagemodelle für komplizierte physikalische, biologische und chemische Zusammenhänge oder bei der Bilderkennung und Textanalyse. Der Einsatz von entsprechender KI-Hardware wie etwa Chips für Fahrassistenzsysteme oder auch auf Smartphones und anderen batteriebetriebenen mobilen Devices klingt verlockend. In diesen Bereichen ist der Rechenaufwand bisher jedoch ein Hindernis, wie der Wissenschaftsfonds FWF am Montag in einer Mitteilung darlegte.
*** Komplexität reduzieren ***
Das Team rund um Franz Pernkopf am Institut für Signalverarbeitung und Sprachkommunikation der TU Graz suchte daher in dem vom FWF finanzierten Projekt „Effiziente tiefe neuronale Netze für eingebettete Systeme“ vier Jahre lang nach Möglichkeiten, die Komplexität von künstlichen neuronalen Netzwerken zu reduzieren, ohne die Erkennungsraten zu beeinträchtigen. „Wir versuchten, automatische Methoden zu entwickeln, um das effizienteste Netz zu finden“, so der Elektrotechnikingenieur und Experte für maschinelles Lernen und Mustererkennung.
Ein Ansatzpunkt war die Ebene der Computerhardware. Gängige PC nutzen für Additionen und Multiplikationen 32 oder 64 Bit. Mit 32 Bit lassen sich immerhin über vier Milliarden Zahlen darstellen. Das Problem: Der Computer behandelt jede Zahl, als wäre sie in der Größenordnung von vier Milliarden. So große Zahlen sind für viele Anwendungen allerdings überhaupt nicht nötig. „Wir haben herausgefunden, dass wir diese Bitbreiten reduzieren können, ohne an Performance zu verlieren“, berichtete der bereits vielfach ausgezeichnete Grazer Wissenschafter rückblickend. „Wer mit acht Bit statt mit 32 Bit rechnet, hat sofort nur noch ein Viertel der Rechenoperationen.“ Man sei sogar so weit gegangen, statt mit acht Bit nur noch mit einem Bit zu rechnen, mit wie es hieß „verblüffend guter Performance“ in gewissen Bereichen.
*** Pionierarbeit ***
In der Regel verwenden neuronale Netze wesentlich mehr Parameter, als tatsächlich benötigt werden. Ein weiterer Erfolg gelang Pernkopfs Team, indem es die Parameter als Wahrscheinlichkeitsverteilung statt als exakte Zahlen darstellte. „Wir waren die Ersten, die das gemacht haben“, hob Pernkopf hervor. Er strich zugleich die Eleganz des neuen Ansatzes heraus, der die Suche nach den richtigen Parametern erleichtert.
Das Projekt habe Pionierarbeit geleistet. „Als wir den Förderantrag eingereicht haben, hat man in der Literatur dazu wenig gefunden“, erzählte Pernkopf. Unmittelbar darauf seien nach und nach Publikationen zu dem Thema aufgetaucht. Man kooperierte dafür mit der Universität Heidelberg, deren Fokus stärker auf der Computerhardware lag, während man sich in Graz auf die Aspekte des Machine Learning konzentrierte.
*** Mensch nicht komplett ersetzbar ***
Pernkopf zeigte sich überzeugt, dass neuronale Netze – nicht zuletzt ressourceneffiziente Systeme in batteriebetriebenen Geräten – den Alltag noch stärker durchdringen werden. In Folgeprojekten mit Unterstützung der FFG und der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG will man nun die erarbeiteten theoretischen Ergebnisse in die Anwendung bringen.
Eine Anwendbarkeit wurde bereits im Grundlagenprojekt untersucht. Dabei ging es um die Erkennung von Schlüsselwörtern, um Spracherkennungssysteme aus dem Standby zu holen. „Wenn ich auf einem Smartphone eine Spracherkennungssoftware permanent laufen lasse, dann ist spätestens nach einer Stunde der Akku leer, weil das so rechenintensiv ist“, schilderte Pernkopf die Herausforderung. Die Forscher suchten nach einem ressourceneffizienteren System, das nur ein paar Reizwörter erkennen muss – wie ein schlafender Mensch, der bei gewissen Geräuschen oder Worten dann aber doch aufwacht. So lasse sich viel Energie sparen. An eine starke künstliche Intelligenz glaubt er hingegen nicht: „Der Mensch wird sich nicht komplett ersetzen lassen.“
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/6727667065149242303
Künstliche Intelligenz vollendete Beethovens 10. Sinfonie – Kollaboration zwischen Mensch und Maschine – Science-APA, 11.10.2021
Fast 195 Jahre nach dem Tod von Ludwig van Beethoven ist eine Version seiner nicht mehr vollendeten 10. Sinfonie uraufgeführt worden – komponiert von Künstlicher Intelligenz. Das renommierte Beethoven Orchester spielte das Stück am Samstagabend unter der Leitung ihres Chefdirigenten Dirk Kaftan im Telekom Forum in Bonn. Das Telekommunikationsunternehmen hatte das Projekt initiiert.
Beethoven hatte die 10. Sinfonie vor seinem Tod nicht mehr vollenden können und nur einige Skizzen und Notizen hinterlassen. Auf deren Grundlage versuchte ein Experten-Team, zu dem Musikwissenschafter und Programmierer gehörten, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, um die Leerstellen zu füllen. Der Computer wurde dafür unter anderem mit vielen weiteren Beethoven-Stücken gefüttert, aber auch mit Musik seiner Zeitgenossen. Das Ziel: Die Maschine zu befähigen, wie Beethoven zu komponieren.
*** Kollaboration zwischen Mensch und Maschine ***
Am Ende machte die KI Vorschläge, wie bestimmte Stellen weitergeführt werden könnten. Die Experten schauten sich die Varianten an, wählten aus und spielten die Entscheidung zurück ins System.
Die Beteiligten betonten, dass es sich um ein Experiment handle und es nicht darum gehe, Beethovens Einzigartigkeit anzuzweifeln. Man wolle vielmehr aufzeigen, wie kreative Zusammenarbeit von menschlicher und Künstlicher Intelligenz funktionieren könne.
„Das Projekt ist eine Kollaboration zwischen Mensch und Maschine“, sagte Matthias Röder, Direktor des Karajan Instituts (Salzburg), der das KI-Team geleitet hatte, vor der Uraufführung. Das Potenzial der Technologie sei für Komponisten faszinierend. „Man könnte auch eine Beatles-KI mit der melodischen KI von Mozart kombinieren – und die Harmonien dann selbst schreiben. Das Spektrum von Möglichkeiten ist exponentiell erweiterbar.“
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/7740903171467111414
SIEHE DAZU:
=> Videos und Live-Stream zur Uraufführung
QUELLE: https://www.magenta-musik-360.de/
Künstliche Intelligenz sorgt für Behaglichkeit im Büro – Gleichzeitig auch Klima und Geldbörse schonen – Virtueller Sensor berechnet Behaglichkeit – Kombination aus KI- und Simulationsmodellen – 14.10.2021
Zu heiß, zu kühl, zu zugig: Die Behaglichkeit in Räumen ist wichtig für die Menschen, die sich darin befinden. Wegen des individuellen Empfindens lässt sich Behaglichkeit bisher jedoch weder einfach messen, noch für alle optimal herstellen. Ein österreichisches Expertenteam unter der Leitung des Grazer Know-Center arbeitet daran, die thermische Behaglichkeit in Bürogebäuden für möglichst viele zu optimieren und zugleich die Energieeffizienz zu steigern.
Ob ein Raum als behaglich empfunden wird, hängt von vielen Faktoren ab. Wer mit dem Verhältnis von Temperatur, der Feuchte und Luftbewegung im Raum zufrieden ist, fühlt sich zumindest thermisch behaglich. In Bürogebäuden haben Angestellte jedoch ganz subjektive Vorstellungen von thermischer Behaglichkeit. Und was für Büroräume gilt, kann in den Konferenz- oder öffentlichen Bereichen schon wieder ganz anders empfunden werden. Hier wird deutlich, wie anspruchsvoll die Aufgabe ist, ein Verhältnis von Raumlufttemperatur und relativer Raumluftfeuchte herzustellen, in dem sich die große Mehrheit der Raumnutzer zu jeder Tages- und Jahreszeit wohlfühlt.
*** Gleichzeitig auch Klima und Geldbörse schonen ***
Zugleich gibt es den Wunsch, das Klima und die Geldbörse zu schonen. Laut dem in Graz ansässigen österreichischen Kompetenz-Zentrum für Big Data Analytics, Data-driven Business und KI bringt eine neuartige Kombination von KI und Simulationsmodellen das durchaus unter einen Hut. Damit eröffnen sich neue Perspektiven hinsichtlich der Betreuung, Beurteilung und Optimierung von Gebäuden, wie Projektleiter Heimo Gursch vom Know-Center gegenüber der APA sagte.
Im Gebäudemanagement wird bisher traditionell das Schwergewicht auf Energieeffizienz gelegt – was manchmal zu nicht befriedigenden Raumkomfortbedingungen für Benutzer führt. Direkte Nutzerbefragungen seien wiederum zeitaufwendig und scheitern oft am geringen Feedback, erklärte Gursch. Andererseits werden selbst die Raum- und Betriebsbedingungen nicht ausreichend erfasst, da die Anzahl der verwendeten Sensoren und dadurch die messbaren physikalischen Größen begrenzt sind.
*** Virtueller Sensor berechnet Behaglichkeit ***
Hier könnten sogenannte virtuelle Sensoren für wesentliche Verbesserungen sorgen, sind die Datenwissenschafter am Grazer Know-Center überzeugt. In dem von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projekt „COMFORT – Comfort Orientated and Management Focused Operation of Room Conditions“ hat ein Expertenteam aus Gebäudetechnikern, Bauingenieuren, Simulationsexperten und Datenwissenschaftlern u. a. einen virtuellen Sensor entwickelt, der Behaglichkeit mithilfe von datengetriebenen KI-Modellen und Simulationsmodellen berechnet.
Die Experten lösten das Problem mit einer geschickten Kombination aus Hard- und Software: Einflussgrößen, wie Temperatur oder Massenströme, werden aus der bestehenden Gebäudeleittechnik bezogen und gezielt mit zusätzlichen Messwerten eines neu entwickelten, drahtlosen Sensornetzwerkes kombiniert. Dieses besteht aus rund 40 Knoten mit jeweils mehreren Sensoren und misst ähnliche Größen, aber statt einem Messpunkt pro Raum gibt es nunmehr zehn oder noch mehr. Zusätzlich werden noch Wetterdaten in die Datenbasis aufgenommen.
Im Bereich der Simulationen werden der gesamte Energieverbrauch eines Gebäudes, der durch Heizung bzw. Kühlung entsteht, nachgebildet. Ebenso werden die Temperatur und die Luftströmung an jedem beliebigen Punkt im Gebäude simuliert. Bei der Vereinigung der vielen unterschiedlichen Datenquellen zu einer homogenen Datenbasis kommt das Big Data-Prinzip zur Anwendung.
*** Kombination aus KI- und Simulationsmodellen ***
Die Besonderheit liege laut Gursch in der Kombination von datengetriebenen KI-Modellen und Simulationsmodellen: „Im Projekt haben wir beispielsweise KI-Modelle genutzt, um die Sonneneinstrahlung in Simulationen genauer bestimmen zu können. Die Ergebnisse der Simulationen wurden wiederum dazu verwendet, die Eignung von KI-Modellen zur Vorhersage von Luftströmungen zu bestimmen.“
Die Ergebnisse der KI-Methoden und Simulation speisen nunmehr den sogenannten virtuellen Sensor. Er kann messen, was eigentlich nicht direkt messbar ist: den Behaglichkeitswert. Der virtuelle Sensor wurde bereits in Test-Boxen der TU Graz und im Bürocampus einer Deutschlandsberger Firma auf seine Praxistauglichkeit überprüft. Es zeigte sich, dass die genauere Bestimmung des Behaglichkeitsniveaus auch dabei hilft, die energetische Effizienz zu steigern: So ergab etwa eine Energiefluss-Analyse einen zu hohen Luftwechsel in einem der Testräume. Durch geringeren Luftwechsel wurde in diesem Fall der Energieverbrauch der Belüftung reduziert, ohne die Behaglichkeit zu vermindern.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/8493708213238310017
Wolfgang Kempkens: Exoskelett lässt Amputierte mühelos gehen – Neuentwicklung von Forschern der University of Utah gibt Betroffenen fehlende Kraft zurück – Halbes Dutzend testet – 2,5 Kilogramm schwer – Pressetext, 13.10.2021
Forscher um Tommaso Lenzi vom Bionic Engineering Lab http://belab.mech.utah.edu der University of Utah http://utah.edu haben ein neues experimentelles Exoskelett für Amputierte entwickelt. Es wird an der Taille und am Beinstumpf befestigt und ist mit Motoren ausgestattet, die von einer Batterie angetrieben werden. Ein Mikroprozessor koordiniert die Bewegungen, sodass der Behinderte keine Mühe hat, wie ein Gesunder zu gehen.
*** Halbes Dutzend testet ***
Eine Standard-Beinprothese für Amputierte kann die biomechanischen Funktionen eines menschlichen Beines nicht vollständig übernehmen. Deshalb strengt das Gehen Amputierte stark an, weil sie die verbliebenen Muskeln überanstrengen müssen, um voranzukommen. Lenzis Exoskelett gleicht den Mangel an Kraft vollständig aus. Ein halbes Dutzend Behinderte testet das Gerät derzeit.
Das Gerät verfügt über einen leichten, effizienten elektromechanischen Aktuator. Ein Gurt um die Taille enthält benutzerdefinierte elektronische Systeme, Mikrocontroller und Sensoren, die fortschrittliche Steuerungsalgorithmen ausführen. „Die Künstliche Intelligenz des Exoskeletts kann nachvollziehen, wie sich eine Person bewegt und unterstützt sie dabei“, sagt Lenzis Doktorand Dante A. Archangeli.
*** 2,5 Kilogramm schwer ***
Im Gegensatz zu anderen Exoskeletten, die ein relativ hohes Gewicht haben und daher viel Energie verbrauchen, ist Lenzis Modell mit etwa 2,5 Kilogramm sehr leicht. Es beschränkte sich darauf, gerade so viel Kraft zur Verfügung zu stellen, wie der Behinderte tatsächlich benötigt. Er vergleicht es mit einem E-Fahrrad, dessen Motor den Fahrer beim Treten unterstützt, nicht jedoch die ganze Arbeit übernimmt.
Eine Amputation oberhalb des Knies reduziert die Mobilität und Lebensqualität von Millionen von Menschen, weil ein Großteil der Beinmuskeln während der OP entfernt wird. „Die Folge davon ist, dass das Gehen schwerfällt, obwohl sich der Betroffene in den Hüften noch bewegen kann“, erklärt Lenzi. Es fehle vor allem an Kraft.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211013003
CYBERCRIME – DATENÜBERGRIFFE
Umfrage: Viele Unternehmen ohne Notfallmanagement bei Cyberangriffen – Überblick am Mittag / DJN, 14.10.2021
Diebstahl, Spionage und Sabotage: Die Gefahr durch Cyberangriffe für Unternehmen in Deutschland nimmt beständig zu. Lediglich 51 Prozent der Unternehmen verfügen jedoch über ein entsprechendes Notfallmanagement, wie der Digitalverband Bitkom am Donnerstag mit Bezug auf eine aktuelle Umfrage mitteilte. In 44 Prozent der Unternehmen gibt es hingegen keine Konzepte zum Umgang mit Cyberattacken. Insgesamt steigt jedoch das Risikobewusstsein deutscher Unternehmen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54201343-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Florian Fügemann: Deutschlands neuer Rekord: 6,2 Mrd. Euro für IT-Sicherheit – Allzeithoch liegt laut neuer IDC-Erhebung 2021 nochmals 9,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres – „Existenzielle Bedrohung“ – Löwenanteil Dienstleistungen – Pressetext, 12.10.2021
In Deutschland werden bis Jahresende voraussichtlich 6,2 Mrd. Euro für Hardware, Software und Services im Bereich IT-Sicherheit ausgegeben. Dieses neue Allzeithoch liegt nochmals 9,7 Prozent über dem bisherigen Rekordjahr 2020 mit 5,6 Mrd. Euro Umsatz, wie neue Berechnungen des Marktforschungsunternehmens IDC http://idc.com für den Digitalverband BITKOM http://bitkom.org zeigen.
*** „Existenzielle Bedrohung“ ***
„Cyber-Angriffe sind für die Wirtschaft zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Für Unternehmen und Verwaltungen ist eine hohe IT-Sicherheit überlebensnotwendig und muss fester Bestandteil guten Managements sein. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie verwundbar viele Firmen sind. Die Ausgaben für IT-Sicherheit werden künftig weiter steigen“, erwartet Susanne Dehmel, Mitglied der BITKOM-Geschäftsleitung.
Auch künftig wird der Markt weiterhin rasant anwachsen: Für das Jahr 2022 ist ein neuerliches Umsatzplus von 9,9 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro prognostiziert. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 9,5 Prozent pro Jahr sollen im Jahr 2025 rund 8,9 Mrd. Euro Umsatz mit Lösungen für ein Mehr an IT-Sicherheit erzielt werden, geht aus den Berechnungen hervor.
*** Löwenanteil Dienstleistungen ***
Mit 50 Prozent machen Dienstleistungen den mit Abstand größten Anteil aus. Die Ausgaben belaufen sich im Jahr 2021 auf voraussichtlich 3,1 Mrd. Euro – ein Plus von 9,8 Prozent. Für IT-Sicherheits-Software werden im laufenden Jahr 2,3 Mrd. Euro ausgegeben; 11,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Weitere 815 Mio. Euro entfallen auf spezielle Geräte und Hardware (plus 4,9 Prozent).
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211012028
Wolfgang Kempkens: Android: Heimliches Datensammeln belegt – Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme untersucht – Nutzer können nicht widersprechen – Datengier größer als erwartet – Gesetzgeber oftmals machtlos – Pressetext, 15.10.2021
Googles mobiles Betriebssystem Android sammelt eifrig Daten seiner Besitzer und teilt diese sogar mit anderen Unternehmen wie Microsoft, LinkedIn und Facebook – insbesondere bei den europäischen Geräten von Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme ist dies der Fall. Zu dem Fazit kommen Forscher des Trinity College Dublin http://tcd.ie und der University of Edinburgh http://www.ed.ac.uk.
*** Datengier größer als erwartet ***
Haoyu Liu, Paul Patras und Douglas J. Leith hatten durchaus damit gerechnet, dass die Betriebssysteme hin und wieder Daten an deren Server schicken. Jedoch ging die Menge an Daten, die den Besitzer wechselten, weit über das hinaus, was die Forscher erwartet hatten. Auch brachte es keine Abhilfe, die Betriebssysteme datensparsam zu konfigurieren. Eine Möglichkeit, der Datenweitergabe zu widersprechen, gibt es nicht.
Die Datensammelleidenschaft von Apps auf Smartphones wurde schon oft untersucht. Dabei geht es um Identifizierbarkeit, Bewegungsverfolgung, Verhaltensprofile und Verknüpfen verschiedener Daten durch App-Entwickler und andere Anbieter. Erst kürzlich wurde das Google-Apple Exposure Notification System untersucht, die Grundlage für COVID-19-Apps. Auch die Massenüberwachung von Journalisten, Politikern und Menschenrechtsaktivisten durch Spyware wie Pegasus ist bekannt. Die Sammelleidenschaft der darunter liegenden Betriebssysteme beachteten die meisten Forscher jedoch nicht.
*** Gesetzgeber oftmals machtlos ***
„Die massive und fortlaufende Datensammlung unserer Smartphones, der man nicht widerspreche kann, ist komplett an uns vorübergegangen“, sagt Doug Leith vom Lehrstuhl für Informatik und Statistik am Trinity College. „Wir haben uns zu sehr auf Cookies und bösartige Apps konzentriert. Ich hoffe, dass unsere Erkenntnisse ein Weckruf für die Öffentlichkeit, Politiker und Behörden ist.“
Paul Patras von der University of Edinburgh: „Auch wenn in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern wie den EU-Mitgliedsstaaten, Kanada und Südkorea viele Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten in Kraft traten, sind die gängigen Datensammelpraktiken immer noch weitverbreitet. Fast alle Android-Betriebssysteme erstellen Listen aller installierten Apps. Problematisch daran ist, dass so auf spezifische User-Eigenschaften zu schließen ist, etwa auf deren geistige Gesundheit, die Religionszugehörigkeit oder die sexuelle Orientierung.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211015031
SIEHE DAZU:
=> „Android Mobile OS Snooping By Samsung, Xiaomi, Huawei and Realme Handsets“
QUELLE: http://bit.ly/2YQ4X7f
MEDIEN
Auch Online-Medien informieren gut über Politik, Social Media weniger – Traditionelle Medien spielen weiterhin eine große Rolle – ORF beeinflusst Qualität der Konkurrenz – Science-APA, 15.10.2021
Wer traditionelle Medien nutzt oder online gezielt nach Nachrichten Ausschau hält, wird meist auch gut über Politik informiert – das stellten Forscher in einer Studie über Mediennutzung fest. Anders sieht dies im Social-Media-Bereich aus, wo es um die Informiertheit deutlich schlechter bestellt ist. Wählen die Österreicher auch heute noch relativ oft traditionelle Medien, bewegt sich der Trend laut Mitautor Jörg Matthes aber weiter in Richtung soziale Netzwerke.
In Österreich und 16 anderen europäischen Ländern ermittelten die Forscher um Laia Castro von der Uni Zürich und der Universitat Internacional de Catalunya in Barcelona (Spanien) fünf Typen von Mediennutzern und deren politische Informiertheit. Minimalisten, die selten Nachrichten lesen, sehen oder hören, machen in Österreich 20 Prozent der Nutzer aus; Traditionalisten, die auf Zeitungen, Radio und Fernsehen zurückgreifen, 27 Prozent. Beide Gruppen sind im Europavergleich eher häufig vertreten.
*** Traditionelle Medien spielen weiterhin eine große Rolle ***
„Dass viele Menschen in Österreich traditionelle Medien nutzen, ist nicht überraschend“, kommentierte Matthes, Vorstand des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien, gegenüber der APA mit Verweis auf die Dominanz des ORF. Aber auch in anderen deutschsprachigen Ländern spielen traditionelle Medien eine große Rolle.
Ebenso stark sind allerdings Medien-Minimalisten vertreten. Letztere finden sich vermehrt in globalisierten, heterogenen Gesellschaften, aber: „Es ist schwer zu sagen, was der eine Grund dafür ist, dass es einen großen Anteil an Minimalisten in Österreich gibt.“
*** ORF beeinflusst Qualität der Konkurrenz ***
Traditionelle Massenmedien haben laut der im Fachblatt „The International Journal of Press/Politics“ veröffentlichten Studie immer noch eine große Funktion, wenn es um das Politik-Wissen der Menschen geht – ihre Nutzer waren in der Studie am besten informiert. Außer ihnen konnten sich nur die Online-Nachrichtensucher, die in Österreich 27 Prozent ausmachen, durch ihren Medienkonsum gut über Politik informieren – so ist es beispielsweise in Österreich und der Schweiz, aber nicht in ganz Europa. Auch hier zeige sich der Einfluss des ORF: „Gibt es ein starkes öffentlich-rechtliches Mediensystem, das gefördert wird, müssen sich die Konkurrenzmedien an dessen Qualität orientieren“, erklärte Matthes. Auch Online-Medien müssten deshalb versuchen, mit der Qualität des ORF und anderer traditioneller Medien mitzuhalten, das Informationsbedürfnis der Menschen würde dadurch gut gedeckt.
Sogenannte „Hyperkonsumenten“ machen sechs Prozent der Österreicher aus. „Das überraschendste Ergebnis der Studie war, dass Hyperkonsumenten, die ein sehr breites Newsrepertoire haben, nicht unbedingt mehr über Politik wissen“, so Matthes. Die Forscher erklären sich das unter anderem mit einer Überlastung an Informationen.
Auch Menschen, die sich primär über Social Media informieren – in Österreich 19 Prozent -, haben dadurch keinen Wissensvorsprung in Sachen Politik. Laut Matthes erhalten sie einerseits verkürzte Nachrichten und andererseits Nachrichten, die individuell zugeschnitten sind: „Die objektive Informiertheit über verschiedene Themen ist deutlich schlechter.“ Vor allem Jüngere verlassen sich allerdings auf die sozialen Netzwerke. „Jüngere Menschen nutzen traditionelle Medien nicht mehr“, zeigte sich Matthes überzeugt. Damit, wie man junges Publikum für Fernsehen und Qualitätsinhalte begeistern könne, würden sich Medienhäuser in Zukunft stark beschäftigen müssen.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/4870769197005288436
SIEHE DAZU:
Studie
QUELLE: https://doi.org/10.1177/19401612211012572
Stu Woo, Liza Lin: Microsoft stellt Social-Media-Dienst LinkedIn in China ein – Ersatz durch einen Job-Board-Dienst ohne Social-Media-Funktionen – Sperrungen: Google seit 2010, Signal und Clubhouse ab 2021 – Nutzbar, aber weitgehend unbekannt sind für chinesische Nutzer*innen Umgehungen mittels VPN zu westlichen Diensten – DJN, 14.10.2021
Microsoft wird die in China betriebene Version ihrer Professional-Networking-Website LinkedIn schließen. Dieser Schritt markiert das Ende des letzten großen US-amerikanischen Social-Media-Netzwerks, das in dem Land offen operiert. In einer Erklärung vom Donnerstag teilte LinkedIn mit, dass es diese Entscheidung getroffen hat, nachdem es mit einem deutlich schwierigeren Betriebsumfeld und höheren Compliance-Anforderungen in China konfrontiert worden sei.
Im März hatte die chinesische Internet-Regulierungsbehörde LinkedIn aufgefordert, ihre Inhalte besser zu regulieren, und dem Unternehmen eine Frist von 30 Tagen gesetzt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. LinkedIn ist seit sieben Jahren in China aktiv.
In den vergangenen Monaten hatte LinkedIn mehrere chinesische Menschenrechtsaktivisten, Akademiker und Journalisten benachrichtigt, dass ihre Profile in China gesperrt wurden, weil sie angeblich verbotene Inhalte enthielten. LinkedIn erklärte, dass es ihren chinesischen Dienst, der einige Inhalte einschränkt, um den Anforderungen der lokalen Regierung zu entsprechen, durch einen Job-Board-Dienst ohne Social-Media-Funktionen wie die Möglichkeit, Meinungen und Nachrichten zu teilen, ersetzen würde.
Die Plattformen von Twitter und Facebook sind in China seit 2009 blockiert. Google kehrte dem Land 2010 den Rücken, nachdem die Alphabet-Tochter sich geweigert hatte, die Ergebnisse ihrer Suchmaschine zu zensieren. Die Chat-Messenger-App Signal und die Audio-Diskussions-App Clubhouse wurden dieses Jahr ebenfalls gesperrt. Versierte Internetnutzer in China können zwar immer noch auf diese westlichen Dienste zugreifen, indem sie Umgehungslösungen wie virtuelle private Netzwerke (VPN) nutzen, aber viele Menschen verwenden sie nicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54204505-microsoft-stellt-social-media-dienst-linkedin-in-china-ein-015.htm
Markus Steiner: Facebook: Geheime Blacklist veröffentlicht – US-News-Seite „The Intercept“ zeigt Dokument zu gefährlichen Personen und Organisationen – „Unberechenbares System“ – 4.000 Personen und Gruppen – Pressetext, 13.10.2021
Facebook hat 968 Gruppen identifiziert, die sich als „militante soziale Bewegungen“ klassifizieren lassen. Sie sind Teil einer größeren schwarzen Liste des Konzerns, auf der gefährliche Individuen und Organisationen stehen. Wer genau darauf zu finden ist, war bislang streng geheim. Doch die US-Non-Profit-Nachrichtenseite „The Intercept“ http://theintercept.com hat nun die komplette interne Liste veröffentlicht und fordert vom Social-Media-Primus mehr Transparenz ein.
*** „Unberechenbares System“ ***
„Facebook hat seinen Usern viele Jahre lang verboten, sich frei zu Menschen und Gruppen zu äußern, die Gewalt verherrlichen, um den Vorwurf zu entkräften, dass man Terroristen dabei hilft, ihre Propaganda zu verbreiten“, heißt es „The Intercept“-Bericht. Die Einschränkungen würden bereits auf das Jahr 2012 zurückreichen, als im US-Kongress und bei den Vereinten Nationen eine breitere Diskussion über die Online-Rekrutierungspraktiken von Terrororganisationen entfacht wurde.
Seit damals hätten sich die Kontrollen, die Facebook einsetzt, um ungeeignete Inhalte von seinen Seiten fernzuhalten, zu einem „unberechenbaren System“ entwickelt, dessen genaue Funktionsweise der Außenwelt bewusst nicht mitgeteilt wird. Diese Intransparenz berge die große Gefahr, dass bestimmte Gruppen und Communitys zensiert, bestraft und persönliche Freiheitsrechte eingeschränkt werden. „Viele Rechtsexperten haben deshalb schon früher gefordert, dass der Konzern seine interne Blacklist veröffentlicht“, so der Bericht.
*** 4.000 Personen und Gruppen ***
Bei Facebook hat man entsprechende Aufforderungen bislang stets vehement abgelehnt. Als Grund hierfür gibt das Unternehmen an, sich Sorgen um das Wohlergehen der eigenen Mitarbeiter zu machen, falls alle Namen auf der Liste an die Öffentlichkeit gelangen würden. „Genauere Informationen über mögliche Bedrohungsszenarien wollte man uns aber nicht geben“, betonen die Autoren bei „The Intercept“.
In dem von der US-News-Seite veröffentlichten internen Dokument werden mehr als 4.000 Einzelpersonen und Gruppen gelistet. Darunter finden sich die Namen vieler Politiker und bekannter Persönlichkeiten wie von Schriftstellern oder Musikern, aber auch karitative Organisationen, Krankenhäuser und historische Figuren, die schon lange nicht mehr am Leben sind.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211013025
SIEHE DAZU:
=> „Facebook Dangerous Individuals and Organisations List“
QUELLE: http://bit.ly/3AE3U6S
Catherine Stupp: Irische Datenschützer fordern von Facebook klarere Nutzungsbedingungen – Beschwerde gegen Verstecken der Datenpraktiken in Geschäftsbedingungen – Facebook will mehr Zeit, um Bedingungen zu ändern – DJN, 15.10.2021
Ein Entwurf der irischen Datenschutzbehörde sieht vor, dass Facebook Inc. ändern muss, wie es die Nutzer über seine Datenverarbeitung informiert. Der Entwurf ignoriert aber Beschwerden, dass der Social-Media-Gigant eine direkte Zustimmung der Nutzer für seine Aktivitäten einholen müsste. Sollte die Entscheidung rechtskräftig werden, müsste Facebook wegen mangelnder Transparenz gegenüber den Nutzern eine Geldstrafe zwischen 28 und 36 Millionen Euro zahlen.
Der Fall geht auf eine 2018 eingereichte Beschwerde des österreichischen Datenschutzanwalts Max Schrems zurück, dessen gemeinnützige Organisation NOYB den Entscheidungsentwurf am Mittwoch veröffentlichte. Die irische Datenschutzkommission hat die Entscheidung nicht veröffentlicht.
Ein Sprecher der irischen Aufsichtsbehörde lehnte eine Stellungnahme ab, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Er sagte, die Behörde habe das Dokument vergangene Woche an die Aufsichtsbehörden der 26 anderen EU-Länder weitergeleitet. Diese Aufsichtsbehörden haben einen Monat Zeit, um zu reagieren und könnten Einwände erheben. Die irische Datenschutzkommission wird dann eine endgültige Entscheidung treffen, und andere europäische Aufsichtsbehörden können in diesem Stadium immer noch Einwände erheben.
Ein Facebook-Sprecher reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
*** Beschwerde gegen Verstecken der Datenpraktiken in Geschäftsbedingungen ***
In der Beschwerde aus dem Jahr 2018, die im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (GDPR) eingereicht wurde, wird argumentiert, dass Facebook die Zustimmung der Nutzer zu seinen Datenpraktiken nicht einholt, zum Beispiel zur Verwendung personenbezogener Daten für die Schaltung gezielter Werbung, und sie stattdessen auffordert, die Geschäftsbedingungen der Plattform als Vertrag zu akzeptieren. Datenschützer argumentieren, dass es Unternehmen nicht möglich sein sollte, wichtige Informationen über ihren Umgang mit Daten in diesen Dokumenten zu verstecken, die viele Verbraucher nicht sorgfältig lesen.
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung müssen Unternehmen nachweisen, dass sie rechtlich befugt sind, Daten zu verarbeiten, indem sie entweder die Zustimmung von Einzelpersonen einholen oder andere Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel die Daten verwenden, weil sie zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich sind. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB), der Dachverband der EU-Datenschutzbehörden, erklärte 2019, dass sich Unternehmen generell nicht auf Verträge stützen können, um personenbezogene Daten für gezielte Werbung zu verarbeiten.
„Die Frage ist, wie weit man das ausreizen kann, wie weit man mehr Dinge in einen Vertrag aufnehmen kann, von denen der durchschnittliche Nutzer nicht denkt, dass sie Teil des sozialen Netzwerks sind“, sagte Schrems in einem Interview.
Die irische Aufsichtsbehörde widersprach Schrems‘ Argument, dass Facebook keine Nutzerdaten benötige, um seinen Vertrag zu erfüllen. „Das Gegenargument lautet, dass solche Werbung, die den Kern des Geschäftsmodells von Facebook und den Kern des zwischen Facebook-Nutzern und Facebook geschlossenen Vertrags darstellt, notwendig ist, um den spezifischen Vertrag zwischen Facebook und dem Beschwerdeführer zu erfüllen“, schrieb die Regulierungsbehörde.
Notwendigkeit ist „eine hohe Hürde im europäischen Recht“, sagte Frederik Borgesius, Professor für Informations- und Kommunikationstechnologie und Privatrecht an der Radboud Universität in den Niederlanden. Einen Vertrag als Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für zielgerichtete Werbung zu verwenden, sei nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung „nicht plausibel“.
*** Facebook will mehr Zeit, um Bedingungen zu ändern ***
Die irische Aufsichtsbehörde hat vorgeschlagen, Facebook aufzufordern, seine Bedingungen innerhalb von drei Monaten transparenter zu gestalten. Das Unternehmen sagte, es brauche mehr Zeit, um diese Änderungen vorzunehmen, so der Entscheidungsentwurf.
Im vergangenen Jahr waren die europäischen Aufsichtsbehörden in zwei anderen öffentlichkeitswirksamen Fällen, bei denen es im September um den Facebook-Chatdienst Whatsapp und im Dezember 2020 um die die Social-Networking-Website Twitter ging, nicht mit den Schlussfolgerungen ihres irischen Pendants einverstanden. In beiden Fällen nutzte die irische Behörde ein Streitbeilegungsverfahren, um die Auseinandersetzungen zu beenden, wodurch sich die Fälle um mehrere Monate verlängerten.
Im Rahmen der 2018 erlassenen GDPR-Datenschutzgesetze ist die irische Aufsichtsbehörde für die Überwachung der Datenpraktiken vieler großer multinationaler Unternehmen im Namen aller Einwohner der 27-Länder-Union zuständig, da sich deren EU-Unternehmenssitz in Irland befindet. Dieses Verfahren hat andere europäische Regulierungsbehörden verärgert, die in den Fällen Whatsapp und Twitter auf höhere Geldstrafen drängten.
Regulierungsbehörden aus anderen europäischen Ländern werden wahrscheinlich auch gegen Teile der Facebook-Entscheidung Einspruch erheben, da es um ein großes Unternehmen und die grundlegende Frage geht, wie Menschen ihre Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten geben, sagte David Martin Ruiz, leitender Jurist beim Europäischen Verbraucherverband BEUC in Brüssel.
„Es wäre sehr problematisch und gefährlich, den Menschen die Möglichkeit zu nehmen, ihre Zustimmung zu geben, wenn sie zum Beispiel für gezielte Werbung getrackt und profiliert werden“, sagte Martin Ruiz.
Die Entscheidung der irischen Aufsichtsbehörde könnte, wenn sie rechtskräftig wird, andere Unternehmen dazu ermutigen, Details über ihre Datenpraktiken zu verheimlichen anstatt die Zustimmung der Verbraucher einzuholen, sagte Estelle Masse, Leiterin der Abteilung für globalen Datenschutz bei der Datenschutzorganisation Access Now. „Es besteht wirklich die Gefahr, dass Facebook aus der Verantwortung entlassen wird und möglicherweise andere Unternehmen sagen: ‚Nun, wenn ich das nur in meinen Nutzungsbedingungen sagen muss, ist es in Ordnung'“, sagte Masse.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54213131-irische-datenschuetzer-fordern-von-facebook-klarere-nutzungsbedingungen-015.htm
SOZIOLOGIE
Ältere Menschen spenden mehr, aber an inländische Empfänger – Frauen und Ältere prosozialer – Spenden für Zwecke im eigenen Land – Warum das prosoziale Verhalten im Alter zunimmt – Science-APA, 12.10.2021
Ältere Menschen zeigten sich in der Pandemie eher bereit als Jüngere, an wohltätige Organisationen zu spenden, die Covid-Opfern helfen. Sie hielten sich auch stärker an Maßnahmen zur sozialen Distanzierung. Allerdings würden sie im Vergleich zu Jüngeren ihr Geld eher an Einrichtungen im eigenen Land geben. Das zeigte eine Befragung von rund 46.000 Menschen aus 67 Ländern am Beginn der Coronakrise, darunter rund 1.000 aus Österreich.
Die Untersuchung, deren Ergebnisse nun im Fachblatt „Nature Aging“ erschienen, war mit der am Beginn der Krise im April und Mai 2020 durchgeführten Befragung dem prosozialen Verhalten auf der Spur. Dem internationalen Team gehörten auch Claus Lamm und Jonas Nitschke von der Fakultät für Psychologie der Universität Wien als Ko-Autoren an. Im Zusammenhang mit der Coronakrise stellte sich ja die paradoxe Situation ein, dass die Vermeidung direkter sozialer Kontakte plötzlich zum „sozialeren“ Verhalten wurde. Dementsprechend wurde in der Befragungsstudie, an der die Universitäten Birmingham und Oxford (beide Großbritannien) federführend beteiligt waren, auch erfasst, wie sehr Menschen bereit waren, sich an die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung zu halten.
*** Frauen und Ältere prosozialer ***
In nahezu allen Ländern, in denen die Studie durchgeführt wurde, entpuppten sich ältere Menschen als tendenziell prosozialer als jüngere Semester. Das galt sowohl dafür, sich nach Eigenangaben mehr an die „Distancing“-Maßnahmen zu halten, als auch für die Spendenbereitschaft. Um letzteres zu erfassen, gaben die Wissenschafter den Untersuchungsteilnehmern einen hypothetischen Geldbetrag, der in etwa dem Gehalt entsprach, den man im jeweiligen Land im Schnitt pro Tag verdient. Es folgte die Frage, ob sie etwas davon auch einer wohltätigen Organisation, die sich um Opfer der Pandemie kümmert, spenden würden. Die Teilnehmer hatten überdies die Möglichkeit zur Wahl zwischen einer inländischen oder ausländischen Einrichtung.
Insgesamt zeigten sich Frauen prosozialer als Männer. Aber vor allem ältere Menschen erklärten sich im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen öfter bereit zu spenden und würden auch mehr Geld weitergeben. Dieses Ergebnis entpuppte sich als erstaunlich robust über die Länder hinweg. Auch wenn die Forscher etwa das Vermögen der Menschen berücksichtigten, änderte sich nichts entscheidend am Gesamtbild.
*** Spenden für Zwecke im eigenen Land ***
Unterschiede zeigten sich allerdings bei der Spendenbereitschaft für nationale und internationale Wohltätigkeitsorganisationen. „Ältere Menschen spenden viel eher für einen Zweck in ihrem eigenen Land – das gilt für die meisten Länder in unserer Studie“, so die Hauptautorin der Studie Jo Cutler von der University of Birmingham.
Die Ergebnisse aus Österreich liegen hier „ziemlich genau in der Mitte“ im Vergleich zu den internationalen Ergebnissen, erklärte Lamm im Gespräch mit der APA. Ausreißer wie etwa China und Indien könne man sich wahrscheinlich mit wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Systemunterschieden erklären.
*** Warum das prosoziale Verhalten im Alter zunimmt ***
Die Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Menschen seien zwar nicht sehr groß, aber eben erstaunlich einheitlich. Noch dazu hat erst kürzlich eine Gruppe um die als Letztautorin an der groß angelegten Studie beteiligte Patricia L. Lockwood in einer Laborstudie ebenfalls gezeigt, dass das prosoziale Verhalten im Alter zunimmt. Trotz mancher Einschränkungen wertet Lamm beide Ergebnisse als starkes Anzeichen dafür, „dass das auch im echten Leben offensichtlich eine gewisse Relevanz hat“.
Zusammenhängen dürfte dies damit, dass viele ältere Menschen in unserem Kulturkreis im Leben im Gegensatz zu jungen Menschen recht gut dastehen. Da lässt es sich dann offensichtlich auch leichter freigiebig sein. Andererseits könnten in höherem Alter um die 70 und darüber, in dem die Effekte in der Studie auch am stärksten zu sehen waren, schon Gedanken an das Lebensende dazu führen, dass man mehr das soziale Umfeld als das egoistische Fortkommen im Blick hat, so Lamm.
Eine Frage sei auch, ob es im Alter vielleicht psychologisch sinnvoller erscheint, sich zumindest prosozialer darzustellen, weil man sich dafür eine Gegenleistung und Unterstützung der unmittelbareren Umgebung erhofft. Das könne wiederum erklären, warum ältere Menschen hier eher an Hilfsorganisationen spendeten, die im eigenen Land tätig sind, so der Kognitionspsychologe.
Einen anderen Aspekt um Spendenbereitschaft im Corona-Modus haben kürzlich Forscher um die Finanzwissenschaftlerin Esther Blanco von der Universität Innsbruck im Fachmagazin „Frontiers in Psychology“ untersucht: In ihrem Experiment zeigte sich, dass Menschen trotz des omnipräsenten Themas „Covid-19“ sehr wohl auch noch bereit waren, Geld für soziale und politische Anliegen wie Umweltschutz oder den Kampf gegen die Armut bereitzustellen.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/10765207415492744
SIEHE DAZU:
=> Die Studie in „Nature Aging“ und die Laborstudie
QUELLEN:
https://dx.doi.org/10.1038/s43587-021-00118-3
https://doi.org/10.1177/0956797620975781
=> Paper in „Frontiers in Psychology“
QUELLE: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.743054
INTERNATIONAL
SCHULDENBREMSE (Pressepiegel / DJN, 14.10.2021) – Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen flexiblen Umgang mit den Schuldenregeln in Deutschland und Europa angemahnt. Eine verfrühte Sparpolitik würde „die wirtschaftliche Erholung beschädigen“, sagte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath im Interview. Deutschland sollte die Schuldenbremse daher flexibel anwenden. „Investitionen in grüne Technologien und Digitalisierung sind essenziell, um nachhaltiges Wachstum zu kreieren“, so Gopinath. „Wenn höhere Investitionen notwendig sind, sollte Deutschland dafür eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen.“ Auch auf EU-Ebene sei es wichtig, Flexibilität zu zeigen. (Handelsblatt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54196611-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Hans Bentzien: IWF weist auf Warnsignale für Finanzstabilität hin – DJN, 12.10.2021
Die weltweite Finanzstabilität hat sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) seit dem Frühjahr marginal verbessert, das Ausmaß der Schwachstellen im Finanzsystem bleibt aber hoch und wird nur durch außerordentliche Stützungsmaßnahmen kaschiert. „Einige Warnsignale – zum Beispiel die erhöhte finanzielle Risikobereitschaft und die zunehmende Anfälligkeit von Finanzinstituten außerhalb des Bankensektors – deuten auf eine Verschlechterung der Grundlagen der Finanzstabilität hin“, schreibt der IWF in seinem Bericht.
Blieben diese Schwachstellen unkontrolliert, könnten sie sich zu strukturellen Altlasten entwickeln, die das mittelfristige Wachstum gefährden und die Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems auf die Probe stellen würden.
Laut IWF erscheinen die Asset-Preise in einigen Sektoren überzogen. Trotz der jüngsten Marktturbulenzen seien die Aktienkurse seit Frühjahr per Saldo weiter gestiegen, was auf die akkommodierende Geldpolitik und die guten Gewinne der Unternehmen zurückzuführen sei. „Überbewertung der Aktien im Verhältnis zum fundamentalen Unternehmenswert sind jedoch in den meisten Märkten nach wie vor hoch“, merkt der IWF an.
Die Kredit-Spreads sind laut IWF niedriger als vor der Pandemie. Die Hauspreise seien in vielen Ländern rasch gestiegen, was unter anderem auf die verbesserten Aussichten, die politische Unterstützung und die veränderten Präferenzen der Haushalte zurückzuführen sei.
Sorgen bereitet dem IWF die Inflation auch mit Blick auf die Finanzstabilität. „Zwar gehen die Anleger nach wie vor davon aus, dass sich der jüngste Preisdruck abschwächen und dann allmählich zurückgehen wird, doch haben sich die Bedenken hinsichtlich der Inflationsrisiken an den Finanzmärkten in letzter Zeit verstärkt“, schreibt der IWF.
Eine plötzliche Änderung des geldpolitischen Kurses in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften könne zu einer drastischen Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen, was sich negativ auf die Kapitalströme auswirken und den Druck auf hoch verschuldete Länder erhöhen würde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54180207-iwf-weist-auf-warnsignale-fuer-finanzstabilitaet-hin-015.htm
Hans Bentzien: IWF sieht weltweites Stabilitätsrisiko durch Evergrande – DJN, 12.10.2021
Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht in der Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande ein Risiko für die weltweite Finanzstabilität. In seinem aktuellen globalen Finanzstabilitätsbericht schreibt der IWF, derzeit seien die Auswirkungen zwar auf China begrenzt, doch dies könne sich ändern.
„Die Behörden haben zwar die Mittel, um im Falle einer Eskalation einzugreifen, aber trotzdem besteht das Risiko, dass es zu breiteren finanziellen Anspannungen kommt, mit Auswirkungen sowohl für die chinesische Wirtschaft und den Finanzsektor als auch für die globalen Kapitalmärkte“, heißt es in dem Bericht.
Ansteckungsgefahren sieht der IWF neben der Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums in einer Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen – durch direkte Engagements internationaler Investoren in chinesischen Finanzanlagen infolge der Aufnahme Chinas in die globalen Benchmark-Indizes und durch eine Verschlechterung der weltweiten Risikobereitschaft.
Langfristig muss China laut IWF sein Regelwerk für die Restrukturierung und Abwicklung von Unternehmen verbessern. Kurzfristig seien Instrumente zur Eindämmung des finanziellen Stresses und zu Milderung der ökonomischen Auswirkungen durchaus vorhanden, allerdings sei ihr Einsatz mit Zielkonflikten verbunden.
„Je umfassender die Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere wenn sie mit einer tatsächlichen oder vermeintlichen Lockerung der allgemeinen Bemühungen um die Entschuldung des Finanzsystems einhergehen, desto größer ist das Risiko, dass finanzielle Schwachstellen in Zukunft wieder auftauchen“, warnt der IWF.
Eine frühere Intervention würde zwar das Ansteckungsrisiko mindern, zugleich aber den Eindruck verstärken, dass der Staat Unternehmen wegen ihrer Größe zu retten bereit ist. Der Versuch, Marktdisziplin aufrecht zu erhalten, könnte am Ende jedoch noch umfassendere Maßnahmen zur Bewahrung der Finanzstabilität notwendig machen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54180206-iwf-sieht-weltweites-stabilitaetsrisiko-durch-evergrande-015.htm
IEA: Kraftwerke stellen wegen Gasknappheit auf Öl um – Nachfrage steigt – Überblick am Mittag / DJN, 14.10.2021
Steigende Erdgas- und Kohlepreise zwingen Stromerzeuger und Hersteller dazu, auf Öl umzusteigen. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte sich die tägliche Ölnachfrage deshalb um eine halbe Million Barrel erhöhen. In ihrem monatlichen Marktbericht hob die IEA ihre Prognosen für die tägliche Ölnachfrage um 170.000 Barrel für 2021 und um 210.000 Barrel für 2022 an. Die IEA hält es allerdings für möglich, dass die kumulative Wirkung der anhaltenden Energiekrise von September bis zum Ende des ersten Quartals 2022 bis zu 500.000 Barrel ausmachen könnte. Damit schätzt die IEA, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl im nächsten Jahr über dem Vor-Corona-Niveau liegen wird.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54201343-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Opec: Partner aus Opec+ werden 2021 weniger Öl als angenommen liefern – Überblick am Abend / DJN, 13.10.2021
Die Partnerländer der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), die zur sogenannten Opec+ zählen, werden nach Einschätzung der Opec im laufenden Jahr weniger als bisher angenommen liefern. In ihrem aktuellen Monatsbericht schreibt die Opec, dass die tägliche Fördermenge dieser Länder 2021 nicht um 1 Millionen Barrel, sondern nur um 0,7 Millionen Barrel zunehmen wird. Das Kartell begründete dies mit der verminderten Produktion im Golf von Mexiko nach dem Hurrikan Ida sowie mit anderen Ausfällen in Kanada, Mexiko und der kaspischen Region.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193431-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Banger Blick Richtung Weihnachten: Lieferkettenchaos als doppelte Gefahr – Vor Containerumschlagplätzen bilden sich derzeit enorme Staus. Auch die Überlandlogistik ist teils in Turbulenzen – ORF, 15.10.2021
Weltweit sind vor allem durch die CoV-Pandemie die zeitlich oft äußerst knapp bemessenen Lieferketten seit Monaten in Turbulenzen. Das belastet den Wirtschaftsaufschwung – und das Weihnachtsgeschäft – zunehmend. CoV-Impfungen für die gesamte Welt werden angesichts dessen neben einer humanitären immer mehr auch zu einer wirtschaftlichen Frage.
Seit Monaten steht die Wirtschaftswelt Kopf: Es ist nicht eine mangelnde Nachfrage, die die Konjunktur bremst. Vielmehr werden die seit Monaten andauernden und sich zuspitzenden Lieferengpässe für die Globalisierung und das damit verbundene System der großräumig verteilten, großteils an Zulieferer ausgegliederten Produktion zu einer zunehmenden Herausforderung. Von Auto- über Möbel- und Pharma- bis Schuhproduzenten betreffen die durch die Pandemie ausgelösten Produktionsausfälle fast alle Branchen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.
Die Pandemie führte und führt zudem in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu Verzögerungen in der Produktion oder überhaupt Schließungen ganzer Werke. Und wenn auch nur ein Zulieferteil fehlt, kann die Endfertigung nicht stattfinden. Das bremst in den USA und Europa mittlerweile den Aufschwung nach der schweren pandemiebedingten Krise.
*** „Paradoxe Lage“ ***
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) betonte zuletzt, es gebe Firmen, „die in existenzielle Bedrohung kommen – bei vollen Auftragsbüchern“. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sprach daher im ARD-Interview von einer fast schon „paradoxen“ Lage.
Wansleben nannte als Beispiel Baufirmen, die Bauzusagen an Käufer gegeben haben und sich jetzt mit gestiegenen Einkaufspreisen für Materialien und Engpässen konfrontiert sehen. Das bedeute nicht nur Kosten, die nicht einkalkuliert seien, sondern auch mögliche Strafzahlungen oder Kompensierungen für die Käufer, die nicht rechtzeitig ihr Haus erhielten.
Die heimische Wirtschaft kosteten die Lieferschwierigkeiten allein im zweiten und dritten Quartal laut Nationalbank 750 Mio. Euro. Die Wirtschaftskammer sieht daher weiter „große Herausforderungen“ für Unternehmen und verwies in einem internen Papier auf die dadurch steigende Teuerungsrate. Auch jüngste Eurostat-Zahlen zur Industrieproduktion in der Euro-Zone bestätigen den Trend: Diese ging laut „Financial Times“ im August im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozentpunkte zurück.
*** Warnung vor großen Unterschieden ***
Nicht von ungefähr erklärten die Finanzminister der G-20-Staatengruppe am Mittwoch, an den wegen der Panademie beschlossenen Konjunkturhilfen festhalten zu wollen. Die G-20-Staaten erklärten, die Erholung verlaufe zwischen den Staaten und innerhalb von Ländern höchst unterschiedlich und sei zudem von Rückfällen etwa beim Auftreten neuer Virusvarianten bedroht. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte zuvor seine weltweite Wachstumsprognose leicht gesenkt und als Risikofaktor vor allem vor den großen Unterschieden bei der wirtschaftlichen Erholung gewarnt.
*** Hafen von Los Angeles geht in Dauerbetrieb ***
US-Präsident Joe Biden ordnete angesichts der weltweiten Lieferengpässe an, dass der Hafen von Los Angeles nun rund um die Uhr betrieben wird, berichtete unter anderem das „Wall Street Journal“. Normalerweise ist der zweitgrößte Containerhafen der USA nur montags bis freitags untertags in Betrieb. Durch die 24/7-Öffnung können Containerschiffe 60 Stunden zusätzlich pro Woche be- und entladen werden. Der größte Containerhafen der USA im nahe gelegenen Long Beach arbeitet bereits im Dauerbetrieb.
*** Biden beruhigt Konsumenten ***
Die Lieferengpässe etwa wegen Staus in Häfen und fehlenden Containerkapazitäten machen sich zunehmend bemerkbar. Mit dem Dauerbetrieb der beiden Häfen soll der Rückstau abgebaut werden. „Ich weiß, dass Sie viel über Lieferketten hören und wie schwierig es ist, eine Reihe von Dingen zu bekommen – vom Toaster über Turnschuhe bis hin zu Fahrrädern und Schlafzimmermöbeln“, sagte Biden. Er verstehe, dass das vielen Menschen Sorge bereite.
Der US-Einzelhändler Walmart und die US-Paketdienste UPS und Fedex hätten zugesagt, ebenfalls außerhalb ihrer Hauptzeiten zu arbeiten, um die Waren zu entladen oder zu transportieren. „Die heute eingegangenen Verpflichtungen sind ein Zeichen für einen großen Fortschritt und dafür, dass die Waren von den Herstellern in die Geschäfte oder zu Ihnen nach Hause kommen“, sagte Biden.
„Wir sind nicht die Post oder UPS oder Fedex, wir können nichts garantieren“, reagierte die Sprecherin des Weißen Haus, Jen Psaki, zuletzt auf die Frage, ob zum Beispiel Weihnachtspakete rechtzeitig ankommen werden. „Was wir tun können, ist, alle der Regierung zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um Verzögerungen zu verringern und sicherzustellen, dass wir Engpässe im System beseitigen.“
*** Weihnachtsbäume aus Plastik und Warnungen vor leeren Regalen: Christbäume aus Plastik könnten heuer mancherorts Mangelware sein ***
Zuletzt hatten sich die Warnungen von Händlern vor Engpässen im Weihnachtsgeschäft – und zuvor in den USA rund um Halloween – gehäuft. Vor allem bei Computerspielen, -konsolen und generell bei Elektronikartikeln könnte es angesichts des weiter großen Chipmangels knapp werden, berichtete etwas das Magazin „Focus“.
Wer Geschenke gern auf dem letzten Drücker besorgt, könnte heuer vor teils leeren Regalen stehen, auch online deutlich weniger Auswahl haben und mit höheren Preisen konfrontiert sein, so die Warnungen. Nicht nur in den USA, auch in Europa gibt es Stimmen – vor allem von Branchenvertretern –, man solle sich nicht auf „Last Minute“ verlassen.
Die US-Ökonomin Betsey Stevenson betonte zuletzt gegenüber dem öffentlich-rechtlichen US-Radiosender NPR, dass der Arbeitskräftemangel, der letztlich die Hauptursache für die Material- und Lieferengpässe ist, nicht rasch vorbeigehen werde. Wegen der Pandemie gebe es weniger Mobilität – das wirke sich besonders bei Migrantinnen und Migranten und Saisonarbeitskräften aus, die in den USA und Europa überwiegend die schlecht bezahlten Arbeiten machen.
*** Solidarität im eigenen Interesse ***
Viele wechselten während der Pandemie zudem ihren Job. Andere würden sie etwa in den USA abwarten, um einen besser bezahlten Job zu finden. Stevenson zufolge seien nicht wenige Menschen durch die Lockdowns entschleunigt worden. In der Folge hätten sie überdacht, was ihnen in ihrem Leben wirklich wichtig sei, und hätten eine Weiterbildung begonnen.
Die Lieferprobleme zeigen laut Stevenson aber vor allem auch, dass es für die USA und die EU nicht reiche, die eigene Bevölkerung gegen Covid-19 zu impfen. Mehr Solidarität wäre hier auch im eigenen Interesse, denn: Um die ständigen Unterbrechungen in der globalisierten Wirtschaft zu beenden, müssten die USA und Europa dafür sorgen, dass es auch in Entwicklungsländern die Möglichkeit gebe, sich impfen zu lassen.
Entgangenes Geschäft, rapid steigende Preise
Die Versorgungsengpässe sind für die Wirtschaft für sich genommen eine Gefahr – für einzelne Unternehmen und für die gesamte Konjunktur von Ländern. Die Materialknappheit an allen Ecken und Enden lässt zugleich die Preise nach oben schnellen und damit die Inflation. Großteils sehen die Notenbanken darin noch ein vorübergehendes Problem, das sich bis nächsten Sommer entspannen wird. Doch gibt es auch Stimmen, die in der Inflation eine längerfristige Gefahr sehen.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232680/
Lieferengpässe bremsen PC-Absatz im 3. Quartal – Überblick am Morgen / DJN, 12.10.2021
Die Lieferengpässe vieler Komponenten haben die PC-Verkäufe im dritten Quartal gebremst. Das Marktforschungsunternehmen Gartner berichtete für die drei Monate einen Anstieg der weltweiten PC-Lieferungen um 1 Prozent auf 84,1 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahr, während die International Data Group einen Anstieg um 3,9 Prozent auf 86,7 Millionen meldete. Besonders betroffen war die HP Inc, die nach Angaben beider Unternehmen Rückgänge im mittleren einstelligen Bereich verzeichnete.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54174315-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Getreidepreis steigt so stark wie zuletzt 2013 – Überblick am Mittag / DJN, 14.10.2021
Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind auch im August deutlich gestiegen. Sie lagen um 13,3 Prozent über den Preisen des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Insbesondere pflanzliche Erzeugnisse waren mit einem Plus von 23,4 Prozent deutlich teurer – vor allem wegen höherer Preise für Getreide und Raps. Der Preisanstieg bei Getreide von 34,4 Prozent war der höchste seit Januar 2013.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54201343-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Hans Bentzien: IWF passt Wachstumsprognosen an und warnt vor US-Inflation – Weltwirtschaft dürfte 2021 und 2022 um 5,9 und 4,9 Prozent wachsen – IWF sieht Weltwirtschaftswachstum mittelfristig bei 3,3 Prozent – Wachsende pandemiebedingte Unterschiede zwischen Industrie- und Schwellenländern – Wachstumsprognose Deutschland jetzt 3,1 (3,6) bzw 4,6 (4,1) Prozent – Haltung der Fed gegenüber erhöhter Inflation unklar – IWF sieht Gefahr einer Entankerung der US-Inflationserwartungen – DJN, 12.10.2021
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr nahezu unverändert gelassen. Wie aus seinem aktuellen Weltwirtschaftsausblick zudem hervor geht, betrachtet er den jüngsten Anstieg der Inflation in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften als ein vorübergehendes Phänomen – warnt aber vor einem Anstieg der Inflationserwartungen in den USA. Sorge bereiten dem IWF zudem die sich abzeichnenden längerfristigen Schäden, die die Corona-Pandemie in den Schwellen- und Entwicklungsländern anrichtet und die wegen der geringeren Impfquoten in diesen Ländern möglichen weiteren Schäden durch neue Virusvarianten.
Der IWF rechnet für 2021 mit einem Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,9 (zuvor: 6,0) Prozent und für 2022 mit 4,9 (4,9) Prozent Wachstum. Die Prognosen für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften wurden auf 5,2 (5,6) und 4,5 (4,4) Prozent geändert und die für die Schwellen- und Entwicklungsländer auf 6,4 (6,3) und 5,1 (5,2) Prozent.
Die Abwärtsrevision für 2021 spiegelt eine Senkung für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften – teilweise aufgrund von Lieferkettenproblemen – und für Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen – vor allem wegen der Pandemie-Dynamik – wider. „Dies wird teilweise durch bessere kurzfristige Aussichten für einige rohstoffexportierende Schwellen- und Entwicklungsländer ausgeglichen“, merkt der IWF an.
*** IWF sieht Weltwirtschaftswachstum mittelfristig bei 3,3 Prozent ***
Nach 2022 wird sich das globale Wachstum laut IWF mittelfristig auf etwa 3,3 Prozent abschwächen, wobei die Produktion in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften voraussichtlich über den mittelfristigen Projektionen von vor der Pandemie liegen wird – vor allem wegen der erwarteten wirtschaftspolitischen Unterstützung in den USA. Im Gegensatz dazu werden für die Gruppe der Schwellen- und Entwicklungsländer dauerhafte Output-Verluste erwartet. Gründe sind die langsamere Einführung von Impfstoffen und eine generell schwächere wirtschaftspolitische Unterstützung.
Den USA prognostiziert der IWF Wachstumsraten von 6,0 (7,0) und 5,2 (4,9) Prozent, dem Euroraum 5,0 (4,6) und 4,3 (4,3) Prozent, China 8,0 (8,1) und 5,6 (5,7) Prozent und Japan 2,4 (2,8) und 3,2 (3,0) Prozent. Unter den Euro-Staaten traut die Organisation Deutschland 3,1 (3,6) und 4,6 (4,1) Prozent, Frankreich 6,3 (5,8) und 3,9 (4,2) Prozent und Italien 5,8 (4,9) und 4,2 (4,2) Prozent Wachstum zu.
Die Wachstumsrisiken sind laut IWF abwärts gerichtet, die Inflationsrisiken aber aufwärts. Letzte könnten eintreten, wenn die pandemiebedingten Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage länger als erwartet anhielten und damit auch der Schaden am Angebotspotenzial unerwartet deutlich ausfiele, warnt der IWF. Das wiederum könnte zu steigenden Inflationserwartungen und einer raschen geldpolitischen Normalisierung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften führen.
*** IWF sieht Gefahr einer Entankerung der US-Inflationserwartungen ***
Als einen besonderen Problemfall hat der IWF dabei offenbar die USA vor Augen. „Die hohe Inflation in den USA, ein reales Risiko, dass die Inflation anhaltend hoch bleibt, und eine gewisse Unsicherheit darüber, wie tolerant die Federal Reserve Reserve gegenüber dieser hohen Inflation sein wird, könnten zu einer anhaltenden Verschiebung der Inflationserwartungen nach oben führen“, warnt der IWF.
Die Fed verfolgt eine Strategie des Average Inflation Targeting. Statt einem sich aufbauenden Inflationsdruck wie früher vorbeugend zu begegnen und die Zinsen erhöhen, will sie nun für Jahre zu niedriger Inflation einen Ausgleich schaffen, indem sie höhere Inflationsraten toleriert. Allerdings ist die Inflation derzeit sehr hoch, und weder Fed noch Finanzmärkte haben Übung im Umgang mit diesem Konzept.
Der IWF prognostiziert den USA Inflationsraten von 4,3 und 3,5 Prozent. Die Fed strebt 2 Prozent an. Für den Euroraum erwartet die Fed 2,2 und 1,7 Prozent Inflation, darunter für Deutschland 2,9 und 1,5 Prozent. Für Großbritannien schätzt der IWF 2,2 und 2,6 Prozent Inflation und für China 1,1 und 1,8 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54179089-iwf-passt-wachstumsprognosen-an-und-warnt-vor-us-inflation-015.htm
SIEHE DAZU:
=> World Economic Outlook October 2021: Recovery During a Pandemic – Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures – International Monetary Fund, 12.10.2021
QUELLE: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
OECD-Frühindikator September deutet auf schwächeren Aufschwung – DJN, 12.10.2021
Die Erholung der Weltwirtschaft dürfte sich nach Aussage der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verlangsamen. Die von der OECD beobachteten Frühindikatoren deuten weiterhin auf ein über dem Trendniveau liegendes Wachstum in Kanada, im Euroraum und in Großbritannien hin. Ähnliche Anzeichen gibt es auch für die USA und Japan. Für Frankreich zeigt der Index dagegen an, dass das reale Bruttoinlandsprodukt unter dem langfristigen Trend bleiben wird.
Der OECD-Frühindikator für September bleibt bei 100,9 Punkten und der für den Euroraum bei 100,4 Punkten. Der US-Index verharrt bei 100,5 Punkten und der deutsche bei 102,0 Punkten.
Ein Faktor, der die Frühindikatoren nach unten zieht, ist laut OECD der anhaltende Anstieg der Verbraucherpreise, der auf die stark gestiegenen Energiepreise zurückzuführen ist. Für China, die durch den Rückgang der Stahlproduktion belastet ist, deutet der Indikator nun eher auf ein stabiles Wachstum als auf einen stetigen Anstieg hin.
Bei den Frühindikatoren, zu denen Auftragsbestände, Baugenehmigungen, Vertrauensindikatoren, langfristige Zinssätze, Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen und viele andere gehören, handelt es sich um zyklische Indikatoren, die Schwankungen der Wirtschaftstätigkeit in den nächsten sechs bis neun Monaten vorhersagen sollen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54176669-oecd-fruehindikator-september-deutet-auf-schwaecheren-aufschwung-015.htm
CLIs continue to point to a moderating pace of expansion in economic activity – OECD, 12.10.2021
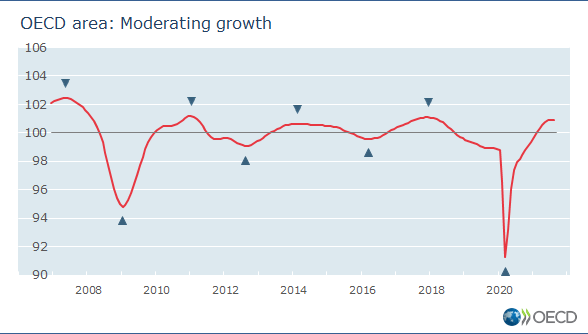
GRAPHIK: https://www.oecd.org/media/oecdorg/directorates/statisticsdirectorate/2021/CLI500-10-21.png
The pace of expansion in economic activity in the OECD area as a whole looks set to continue to moderate after the post-pandemic rebound, according to the latest OECD Composite Leading Indicators.
The CLIs continue to anticipate a moderating pace of expansion at above trend level in Canada, the euro area as a whole and the United Kingdom, as reported last month. Similar indications have now emerged in the United States and Japan. In France, the CLI expects real GDP levels to remain below the long-term trend and also suggests that growth is likely to moderate. One factor pulling down the CLIs is the persistent rise in consumer prices in recent months, driven by surging energy prices.
Among major emerging-market economies, the CLI for China, weighed down by the contraction of steel production, is now pointing towards stable growth rather than a steady increase, as reported last month. In India the CLI indicates stable growth, but real GDP levels are expected to remain below the long-term growth trend. Slowing growth continues to be anticipated in Brazil. The CLI for Russia is still pointing to a steady increase in growth above the long-term GDP growth trend.
The leading indicators, which include order books, building permits, confidence indicators, long-term interest rates, new car registrations and many more, are cyclical indicators designed to anticipate fluctuations in economic activity over the next six to nine months. They paint a broad picture of economic activity from a large amount of recent forward-looking data.
Despite the gradual lifting of COVID-19 containment measures in some countries and the progress of vaccination campaigns, persisting uncertainties may result in higher than usual fluctuations in the CLI and its components. As such, the CLIs should be interpreted with care and their magnitude should be regarded as an indication of the strength of the signal rather than a precise measure of anticipated growth in economic activity.
QUELLEN: https://www.oecd.org/economy/composite-leading-indicators-cli-oecd-october-2021.htm
Website: https://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-october-2021.htm
3-Seiten-PDF: https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-10-2021.pdf
David Hodari: IEA: Regierungszusagen reichen nicht für Erreichen der Pariser Klimaziele – DJN, 13.10.2021
Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) wird es den Regierungen der Welt nicht gelingen, den Klimawandel zu verhindern – selbst wenn die hehren Versprechungen, die Gesetzgeber und Unternehmen in den letzten Monaten abgegeben haben, erfolgreich umgesetzt werden. Unabhängig davon, ob die bereits eingeleitete Maßnahmen fortgesetzt oder die jüngsten Versprechungen eingehalten würden, würden die steigenden Temperaturen den Grenzwert überschreiten, zu dem sich die Staats- und Regierungschefs im Pariser Abkommen verpflichtet hätten, so die IEA. Ziel der internationalen Klimapolitik ist es, die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen.
Einen Monat nach der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, dass sich die USA und die Europäische Union für eine Verringerung der weltweiten Methanemissionen einsetzen würden, und wenige Wochen vor den von den Vereinten Nationen geführten Klimaverhandlungen in Glasgow, hat die IEA mehrere langfristige Energieszenarien vorgelegt. Die Energieagentur schätzt, dass die von den Regierungen bereits abgegebenen Zusagen gerade mal weniger als ein Fünftel der Emissionen abdecken, die die Welt bis 2030 reduzieren muss, wenn sie bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen möchte.
„Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Investitionen in saubere Energieprojekte und -infrastrukturen in den nächsten zehn Jahren mehr als verdreifachen“, sagte Fatih Birol, Exekutivdirektor der IEA, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angegliedert ist.
Anfang dieses Jahres hatte die in Paris ansässige Organisation erklärt, dass Investitionen in neue Projekte zur Versorgung mit fossilen Brennstoffen sofort eingestellt werden müssten, um planmäßig Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Eine drastische Erhöhung der Investitionen in saubere Energie sei zudem auch die Lösung für die Energiekrise. „Es besteht die Gefahr weiterer Turbulenzen auf den globalen Energiemärkten. Wir investieren nicht genug, um unseren künftigen Energiebedarf zu decken, und die Ungewissheit bereitet die Bühne für eine unbeständige Zeit“, sagte Birol. Etwa 70 Prozent der zusätzlich benötigten Ausgaben müssten jedoch in Schwellen- und Entwicklungsländern getätigt werden, in denen Finanzierung knapp sei.
Die Entwicklungsländer haben die wohlhabenderen Länder der Welt aufgefordert, sich an der Finanzierung ihrer Energiewende zu beteiligen. Der südafrikanische Umweltminister sagte im Juli, dass die Industrieländer jährlich 750 Milliarden US-Dollar zahlen sollten, um ihre Abkehr von fossilen Brennstoffen zu finanzieren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54185768-iea-regierungszusagen-reichen-nicht-fuer-erreichen-der-pariser-klimaziele-015.htm
With clock ticking, sustainable transport key to Global Goals – UN, 12.10.2021
From electric cars and buses to zero-carbon producing energy sources, new and emerging technologies along with innovative policy changes, are critical for combating climate change. But to be effective, they must ensure that transport strategies benefit everyone, including the poorest, according to a new UN multi-agency report launched on Tuesday.
QUELLE: https://news.un.org/en/story/2021/10/1102872
Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Arbeitsmarktökonomen – Haben „empirische Forschung revolutioniert“ – Forschung hat „großen praktischen Nutzen“ – Erst ein österreichischer Preisträger – Die diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger – Science-APA, 11.10.2021
Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an die drei Arbeitsmarktforscher David Card, Joshua D. Angrist und Guido W. Imbens. Der Kanadier David Card von der University of California in Berkeley werde „für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie“ ausgezeichnet, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Montag bekanntgab.
Er widerlegte mit Experimenten die damals gängige Meinung von Ökonomen, dass eine Mindestlohnanhebung zwangsläufig in eine sinkende Beschäftigung münde müsse. Der Amerikaner Joshua D. Angrist vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und der gebürtige Niederländer Guido W. Imbens von der Stanford University teilen sich die zweite Hälfte des Preises „für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen“. „Ich war absolut fassungslos, als ich den Telefonanruf bekam“, sagte Imbens. Er freue sich sehr, den Preis mit zwei guten Freunden zu teilen. Angrist war sogar Trauzeuge bei seiner Hochzeit.
*** Haben „empirische Forschung revolutioniert“ ***
Alle drei Forscher „haben uns neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus natürlichen Experimenten gezogen werden können“, begründete die Akademie ihre Entscheidung. „Ihr Ansatz hat auf andere Bereiche übergegriffen und die empirische Forschung revolutioniert.“ Viele der großen Fragen in den Sozialwissenschaften hätten mit Ursache und Wirkung zu tun – etwa, wie sich Einwanderung auf das Lohn- und Beschäftigungsniveau auswirke. Diese Fragen seien schwer zu beantworten, weil es dazu keine Vergleiche gebe. „Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn es weniger Zuwanderung gegeben hätte“, so die Akademie. Die Preisträger hätten jedoch gezeigt, dass es möglich sei, solche und ähnliche Fragen mit natürlichen Experimenten zu beantworten.
Die stellvertretende Direktorin des heimischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Ulrike Famira-Mühlberger, begrüßt den Nobelpreis für die drei Arbeitsmarktökonomen. Die Forschungsergebnisse seien „extrem relevant für die Praxis“ und seien zentral für die heutige Arbeitsmarktforschung. Card habe gezeigt, wie man mit natürlichen Experimenten, kausale Zusammenhänge identifizieren könne, etwa bei Mindestlöhnen, so die Wifo-Ökonomin zur APA. Angrist und Imbens hätten als Ökonometriker die Methoden weiterentwickelt.
*** Forschung hat „großen praktischen Nutzen“ ***
Im Jahr 1993 veröffentliche Card gemeinsam mit Alan Krueger eine Forschungsarbeit zu Mindestlöhnen und Beschäftigung, die von anderen Wissenschaftern bisher über 4.000-mal zitiert wurde. Am 1. April 1992 wurde der Mindestlohn im US-Bundesstaat New Jersey von 4,25 Dollar auf 5,05 Dollar pro Stunde erhöht. Um die Auswirkungen des Gesetzes zu bewerten, analysierten Card und Krueger 410 Fast-Food-Restaurants in New Jersey und Pennsylvania vor und nach der Erhöhung des Mindestlohns. Sie verglichen Veränderungen bei Löhnen, Beschäftigung und Preisen in Geschäften in New Jersey im Vergleich zu Geschäften in Pennsylvania, wo der Mindestlohn bei 4,25 Dollar pro Stunde blieb. Die empirischen Ergebnisse der beiden Ökonomen stellte die Annahme der Standardtheorie infrage, dass eine Erhöhung des Mindestlohns zu einem Rückgang der Beschäftigung führt.
Deutsche Ökonomen begrüßten die Auswahl. Ifo-Präsident Clemens Fuest nannte die Entscheidung der Schwedischen Reichsbank eine „sehr gute Wahl“. Die Forschung der drei Wissenschafter habe einen „großen praktischen Nutzen“, weil sie Methoden entwickelt hätten, um Ursache und Wirkung zu bestimmen. Das sei wichtig, um herauszufinden, „wie wirtschaftspolitische Maßnahmen wirken“. Auch Ökonomie-Professor Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf begrüßte die Entscheidung. „Bin super happy über die Auswahl und kann mir keine würdigeren Preisträger vorstellen als diese drei, sie haben die Econ-Welt verändert“, twitterte Südekum.
*** Erst ein österreichischer Preisträger ***
Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird seit 1968 verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank gestiftet und ist mit zehn Millionen Kronen (knapp 1 Million Euro) dotiert. Traditionell geht er vor allem an aus den USA Stammende oder dort Forschende. Im vergangenen Jahr erhielten die US-Wissenschafter Paul Milgrom und Robert Wilson die Auszeichnung. Beide forschen auf dem Gebiet der sogenannten Auktionstheorie.
Seit der ersten Vergabe des Wirtschaftsnobelpreises war bisher erst ein Österreicher unter den Preisträgern: Der österreichische liberale Ökonom Friedrich August von Hayek erhielt 1974 den Preis gemeinsam mit dem Schweden Gunnar Myrdal für Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie. Der österreichische Verhaltensökonom Ernst Fehr (Uni Zürich) wurde in der Vergangenheit öfters als Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis genannt.
*** Die diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger ***
David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens haben drei Dinge gemeinsam: Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft forschen die drei Wirtschaftswissenschaftler an Elite-Universitäten in den USA, zum anderen haben sie teils ähnliche Forschungsinteressen. Und: Alle drei können sich künftig als Wirtschaftsnobelpreisträger bezeichnen. Ein Überblick über die drei Forscher, die die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm auszeichnete:
David Card, Universität von Kalifornien: Card kam 1956 im kanadischen Guelph in der Nähe von Toronto zur Welt. Wie den gebürtigen Niederländer Imbens zog es ihn für seine wissenschaftliche Karriere in die USA, wo er 1983 seinen Doktor an der Elite-Uni Princeton machte. Heute ist er Wirtschaftsprofessor an der University of California in Berkeley und Direktor des Programms für Arbeitsstudien am wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitut NBER. Seine Forschungsinteressen umfassen unter anderem Einwanderung, Löhne, Bildung sowie geschlechts- und hautfarbenbedingte Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Der mehrfach ausgezeichnete Ökonom hat die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft inne.
Joshua Angrist, Massachusetts-Institut für Technologie (MIT): Angrist kommt aus dem US-Staat Ohio und machte seinen Doktor 1989 ebenfalls in Princeton. Der 1960 geborene Wissenschaftler lehrte bereits in Harvard und an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Er ist amerikanischer und israelischer Staatsbürger. Seit 1996 arbeitet er am renommierten MIT in der Nähe von Boston, wo er 2008 den Ford-Lehrstuhl als Professor für Wirtschaftswissenschaften übernahm. Seine Arbeit fokussiert sich auf die Bildungsökonomik und Schulreformen, auf Sozialprogramme und den Arbeitsmarkt sowie die Auswirkungen von Einwanderung und Arbeitsmarktregulierungen.
Guido Imbens, Stanford-Universität: Wie seine Mitpreisträger ist Imbens doppelter Staatsbürger: Er hat neben dem amerikanischen den Pass seiner niederländischen Heimat inne. Der in Eindhoven geborene 58-Jährige ist Fachmann für Ökonometrie und Statistik. Im Zentrum seiner Forschung stehen unter anderem kausale Zusammenhänge und die Entwicklung der Forschungsmethodik. Seit 2012 ist er in Stanford Professor für Angewandte Ökonometrie und Professor für Wirtschaftswissenschaften. Er ist seit fast zwei Jahrzehnten mit der Ökonomin Susan Athey verheiratet – Angrist war damals Trauzeuge auf der Hochzeit.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/8738796041658712838
IWF hält an Kristalina Georgiewa fest – Der Vorstand des Internationalen Währungsfonds spricht der geschäftsführenden Direktorin trotz Vorwürfen der Datenmanipulation sein Vertrauen aus – Reuters / Finanz & Wirtschaft, 12.10.2021
Der Internationalen Währungsfonds (IWF) spricht der geschäftsführenden Direktorin Kristalina Georgiewa sein volles Vertrauen aus. Der Bericht der Kanzlei WilmerHale über die Datenmanipulationsvorwürfe gegen die IWF-Chefin werfe zwar «berechtigte Fragen und Bedenken auf, ein Führungswechsel sei mangels direkter Beweise jedoch nicht gerechtfertigt», sagte US-Finanzministerin Janet Yellen am Montag. Es müssten aber «proaktive Schritte» unternommen werden, «um die Datenintegrität und die Glaubwürdigkeit des IWF zu stärken». Georgiewa und andere Führungskräfte des Fonds müssten ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Transparenz in Forschung, Analyse und Politik verstärken. Der IWF-Vorstand erklärte, er vertraue darauf, dass Georgiewa sich für die Einhaltung der höchsten Standards und Integrität bei der Unternehmensführung einsetze.
Hintergrund der Datenmanipulationsvorwürfe ist ein Untersuchungsbericht der Kanzlei WilmerHale, wonach führende Vertreter der Weltbank – darunter deren damalige Geschäftsführerin Georgiewa – «unangemessenen Druck» auf Mitarbeiter ausgeübt haben sollen, um China im Ranking des «Doing Business»-Berichts für 2018 besser abschneiden zu lassen. China landete schliesslich auf Platz 78, nachdem es im ersten Entwurf zunächst auf Rang 85 gelegen hatte. Der Bericht bewertet das Investitionsklima und die Wirtschaftsfreundlichkeit eines Landes. Zu der Zeit versuchte die Weltbank Unterstützung von der Regierung in Peking für eine grosse Kapitalerhöhung zu bekommen. Georgiewa hatte die Vorwürfe, die auf das Jahr 2017 zurückgehen, bereits mehrfach zurückgewiesen. Im Oktober 2019 wurde sie geschäftsführende Direktorin des IWF.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/iwf-vorstand-haelt-an-georgiewa-fest/
BÖRSE
SENTIX-Sentimente: Ergebnisse des sentix Global Investor Survey 42-2021 – Sentimentimpuls – SENTIX, 17.10.2021
Die Zahl der Bullen für US-Aktien, gemessen im sentix Sentiment, hat sich in den letzten beiden Wochen sprunghaft vergrößert. Dieses dürfte die Kursaussichten auf kurze Sicht dämpfen. Eine Trendwende steht aber nicht auf der Agenda, da dieser Anstieg Teil eines bullischen Sentimentimpuls ist, der auf Sicht von 8-10 Wochen noch weitere Kursgewinne erwarten lässt. Weitere Ergebnisse: * Goldminen: Bessere Zeiten voraus * Edelmetalle: Strategisches Grundvertrauen steigt weiter an
QUELLE (REGISTRIERPFLICHT): https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-42-2021.html
Frank Heiniger: Small Caps versus Large Caps – Die Kleinen schwächeln – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 12.10. 2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/10/screenshot-2021-10-11-163220-640×340.jpg
Für die relative Kursentwicklung von klein- und grosskapitalisierten Unternehmen spielt das geldpolitische Umfeld eine wichtige Rolle. Während die Small Caps in Phasen einer monetären Lockerung oft eine Überrendite erzielen, haben die Large Caps in Zeiten einer Normalisierung respektive einer Straffung tendenziell die Nase vorn. Die Konjunkturentwicklung ist ebenfalls ein Treiber – belegen doch zahlreiche Studien, dass Nebenwerte meist schlechter als die Blue Chips abschneiden, sobald sich das Wirtschafts- und das Gewinnwachstum abschwächen.
Dies lässt sich auch im Nachgang der Coronakrise erkennen. Wie die obige Grafik von Morgan Stanley illustriert, legten die kleinkapitalisierten Werte ab Herbst 2020 mit den sich verbessernden Konjunkturaussichten und der Unterstützung der Notenbanken überproportional zu. Die Outperformance (inklusive Dividenden) über die jeweils zurückliegenden zwölf Monate erreichte im Frühjahr 2021 an Wallstreet mit rund 50 Prozentpunkten (blaue Linie) respektive im europäischen Aktienmarkt mit beinahe 40 Prozentpunkten (gelbe Linie) das Höchst.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2160/
Markus Frühauf: Emission für Wiederaufbau: EU legt größte grüne Anleihe auf – Günstigere Finanzierungskonditionen – Deutscher Staat setzte bereits auf grüne Anleihen: 3-Milliarden-Aufstockung der 10-jährigen Anleihe noch im Oktober – Unterschiedliche Minusrenditen für unterschiedliche Laufzeiten – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.10.2021
Das Debüt der Europäischen Union (EU) am Markt für grüne Anleihen ist am Dienstag sehr erfolgreich gewesen: Zum einen hat sie als Emittent neue Maßstäbe für die ökologischen und nachhaltigen Zielen dienenden Schuldtitel gesetzt. Zum anderen zeigt das abermals hohe Interesse der Investoren an der Emission, dass die EU am Anleihemarkt sehr willkommen ist. Die erste grüne EU-Anleihe weist eine Laufzeit von 15 Jahren auf und stellt mit einem Volumen von 12 Milliarden Euro den bislang größten Titel in dieser Kategorie dar.
Wie schon bei den ersten EU-Anleihen im vergangenen Jahr, die im Zuge der Corona-Krise an sozialen Zwecken ausgerichtet waren, stürzten sich die Anleger regelrecht auf die Emission: Die Nachfrage von gut 135 Milliarden Euro lag um mehr als das Zehnfache über dem Angebot. Damit übertraf die EU den von Großbritannien im vergangenen Monat aufgestellten Nachfragerekord für eine grüne Anleihe. Damals hatte das britische Schatzamt Orders von mehr als 100 Milliarden Pfund (umgerechnet knapp 118 Milliarden Euro) registriert bei einer Emission über 10 Milliarden Pfund. Der EU gelang es mit ihrem Debüt am grünen Anleihemarkt aber nicht, einen Nachfragerekord über alle Anleihekategorien hinweg aufzustellen. Sie kann sich aber damit trösten, diesen Rekord selbst im vergangenen Jahr mit 145 Milliarden Euro aufgestellt zu haben.
*** Günstigere Finanzierungskonditionen ***
Die hohe Nachfrage nach der grünen Anleihe drückte die Finanzierungskonditionen. Sorgt die hohe Nachfrage nach einer Anleihe für steigende Kurse, dann fällt deren Rendite, also die von den Investoren geforderte Verzinsung. Hatte die EU ursprünglich einen Nachlass von 0,05 Prozentpunkten oder fünf Basispunkten zum Referenzzins (Swapmitte 15 Jahre) angestrebt, waren es am Ende sogar acht Basispunkte weniger. Das entspricht einer Rendite von 0,44 Prozent. Eine vergleichbare Bundesanleihe, die Anfang 2037 fällig wird, weist dagegen eine Rendite von nur 0,02 Prozent auf. Der Renditevorsprung gegenüber den überwiegend negativ verzinsten Bundesanleihen ist ein wichtiger Grund, warum viele Investoren die neuen EU-Anleihen schätzen. Diese weisen ebenfalls eine sehr hohe Kreditwürdigkeit auf. An den fristgerechten Zinszahlungen und Tilgungen der EU bestehen keine Zweifel.
Diese will bis Ende 2026 insgesamt 800 Milliarden Euro aufnehmen, um den in der Corona-Krise beschlossenen Wiederaufbaufonds zu finanzieren. 30 Prozent oder rund 250 Milliarden Euro sollen über grüne Anleihe abgedeckt werden. Damit schickt sich die EU an, der größte Emittent grüner Anleihen in der Welt zu werden. Da viele institutionelle Investoren inzwischen verpflichtet sind, mehr Mittel in nachhaltig konzipierte Wertpapiere anzulegen, wächst die Nachfrage nach grünen Anlageprodukten kontinuierlich, Dazu trägt auch die EU bei, die bis Ende des Jahres ihre Kriterien für nachhaltige Finanzprodukte, die sogenannte Taxonomie, endgültig verabschieden will. Doch noch ist nicht geklärt, ob sich Frankreich mit seiner Forderung, Atomkraft als Übergangstechnologie einzustufen, durchsetzen kann.
*** Deutscher Staat setzte bereits auf grüne Anleihen: 3-Milliarden-Aufstockung der 10-jährigen Anleihe noch im Oktober ***
Auch der deutsche Staat setzt seit dem vergangenen Jahr auf grüne Anleihen. Bislang hat er in den Laufzeiten über fünf, zehn und 30 Jahre insgesamt 21 Milliarden Euro aufgenommen. In diesem Monat sollen weitere 3 Milliarden Euro über die Aufstockung der neuen grünen zehnjährigen Anleihe hinzukommen. Der Bund verfolgt das Konzept der Zwillingsanleihe, zu jedem grünen gibt es einen konventionellen Zwillingstitel. Aufgrund der selben Laufzeit lässt sich der Zinsvorteil der grünen Titel exakt bestimmen.
*** Unterschiedliche Minusrenditen für unterschiedliche Laufzeiten ***
Am Markt wird die grüne Prämie als „Greenium“ bezeichnet. Die fünfjährige grüne Bundesanleihe liegt mit einer Rendite von minus 0,67 Prozent um sechs Basispunkte unterhalb des konventionellen Zwillings. In der zehnjährigen Laufzeit weist der grüne Titel mit minus 0,18 Prozent eine um vier Basispunkte niedrigere Rendite auf. Die 30-jährige grüne Anleihe hat mit einer Rendite von 0,29 Prozent derzeit einen Zinsvorteil von fünf Basispunkten.
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/eu-legt-groesste-gruene-anleihe-auf-17581257.html
ZENTRALBANKEN und UMFELD
– INTERNATIONAL / FSB, BASEL IV
BASEL IV (Pressespiegel / DJN, 12.10.2021) – Es braucht einen zweiten Backstop in Form des Output Floors. Nur so würde Basel IV die Kreditvergabe nicht übermäßig belasten, schreibt Iris Bethge-Krauß, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands, in einem Gastbeitrag. Ein Anstieg der notleidenden Kredite sei absehbar. Die Institute müssten entsprechend vorsorgen und Wertberichtigungen bilden. Dadurch verringere sich ihr Eigenkapital. (Börsen-Zeitung)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173318-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
FSB macht Vorschläge für Regulierung von Geldmarktfonds – Überblick am Mittag / DJN, 11.10.2021
Der Financial Stability Board (FSB) hat den Finanzministern und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer Vorschläge für die Regulierung von Geldmarktfonds gemacht, die zu einer größeren Stabilität dieser Finanzvehikel beitragen sollen. Der FSB reagiert damit auf die Turbulenzen vom März 2020, als Geldmarktfonds zu Beginn der Corona-Krise einen Run erlebten und de facto von den Notenbanken gerettet werden mussten. Das vom FSB vorgeschlagene Instrumentarium sieht unter anderem vor, die Kosten für Mittelabzüge aus solchen Fonds jenen Investoren aufzubürden, die ihre Mittel abziehen wollen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54167325-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
– USA / FED
Nick Timiraos: Fed-Protokoll: Anleihekäufe könnten bis Mitte 2022 enden – DJN, 13.10.2021
Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung im September Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms (Tapering) ab nächstem Monat geprüft. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen vom 21. und 22. September hervorgeht, könnten die Anleihekäufe womöglich bis Mitte nächsten Jahres ganz eingestellt werden. Das Sitzungsprotokoll zeigt zudem einen stärkeren Konsens darüber, wie die monatlichen Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren im Wert von 120 Milliarden US-Dollar reduziert werden sollen, da es Anzeichen dafür gibt, dass eine höhere Inflation und eine starke Nachfrage eine straffere Geldpolitik im nächsten Jahr erforderlich machen könnten.
Die Hälfte der 18 Fed-Vertreter war bei der vergangenen Sitzung des Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) der Ansicht, dass die Konjunkturerholung eine Zinserhöhung bis Ende 2022 erforderlich macht. Im Juni hatten hingegen lediglich sieben Notenbanker diese Auffassung vertreten. Die neuen Projektionen zeigten auch, dass mehrere Notenbanker im nächsten Jahr eine etwas höhere Inflation erwarteten als im Juni, und fast alle rechnen mit weiteren Zinserhöhungen im Jahr 2023.
Ein besonderes Augenmerk von Marktteilnehmern und Analysten liegt derzeit auf der Inflationsentwicklung. Die US-Verbraucherpreise stiegen im September mit einer Jahresrate von 5,4 (August: 5,3) Prozent. Das Inflationsziel der Fed beträgt 2 Prozent.
Allerdings verfolgt sie seit kurzen eine Strategie des Average Inflation Targeting. Statt einem sich aufbauenden Inflationsdruck wie früher vorbeugend zu begegnen und die Zinsen erhöhen, will sie nun für Jahre zu niedriger Inflation einen Ausgleich schaffen, indem sie höhere Inflationsraten toleriert. Allerdings ist die Inflation derzeit sehr hoch, und weder Fed noch Finanzmärkte haben Übung im Umgang mit diesem Konzept.
Die US-Notenbank hat bei ihrer Sitzung am 22. September signalisiert, dass sie im November mit der Rücknahme ihrer pandemischen Kaufprogramme beginnen und die Zinsen im nächsten Jahr anheben könnte. Der Zinsausschuss der Fed revidierte seinen Begleittext zum Zinsbeschluss dahingehend, dass er den Beschluss zur Reduzierung der Wertpapierkäufe in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar bereits bei der nächsten Sitzung am 2. und 3. November fassen könnte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193825-fed-protokoll-anleihekaeufe-koennten-bis-mitte-2022-enden-015.htm
FED: Clarida: Anleihekäufe könnten Mitte 2022 enden – FED Atlanta: Bostic warnt vor längerem Andauern der Inflation – Überblick am Abend / DJN, 12.10.2021
Die Reduzierung des Anleihekaufprogramms (Tapering), das die US-Notenbank zurzeit vorbereitet, könnte nach den Worten von Fed-Vize-Chairman Richard Clarida bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Laut Clarida ist die Mehrheit der US-Notenbanker nach wie vor der Meinung, dass der jüngste Inflationsanstieg nur vorübergehend und primär auf die derzeitigen Lieferengpässe zurückzuführen ist. Sollte die Federal Reserve jedoch zu der Auffassung gelangen, dass der Preisanstieg bei Haushalten und Unternehmen zu höheren Inflationserwartungen führt, werde sie entsprechend reagieren.
Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat zwar eingeräumt , dass die Inflation stärker angestiegen ist als er und andere erwartet hätten, und das Risiko bestehe, dass sie hartnäckiger sei als gewünscht. Er glaube aber dennoch, dass der Preisdruck mit der Zeit nachlassen werde, sagte der US-Notenbanker.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54181681-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Larry Summers: Fed hinkt bei Inflationsrisiken-Bekämpfung hinterher – Überblick am Morgen / DJN, 13.10.2021
Der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers hat vor der Gefahr einer galoppierenden Inflation in den USA gewarnt. Die US-Notenbank Federal Reserve bewege sich bei ihren Bemühungen, der Gefahr zu begegnen, viel zu behäbig. Die traditionelle Rolle der Federal Reserve bestehe darin, „die Bowle zu entfernen, kurz bevor die Party beginnt“, sagte Summers am Mittwoch auf einer Citi-Investmentkonferenz via Zoom. „Jetzt ist die Party großartig geworden, und die Fed wird die Bowle erst dann entfernen, wenn sie schlüssige Beweise dafür gesehen hat, dass sich alle betrinken werden.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54186271-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
– CHINA / PBoC
Immobilienfirma vor dem Kollaps: Zentralbank: Evergrande-Gefahr „beherrschbar“ – n-tv, 15.10.2021
siehe unter CHINA
– SÜDKOREA
Bank of Korea bestätigt Zinsniveau – Überblick am Morgen / DJN, 12.10.2021
Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,75 Prozent belassen, nachdem sie ihn im August um 25 Basispunkte erhöht hatte. Von 21 Ökonomen, die das Wall Street Journal vor der Entscheidung befragte, hatte nur einer mit einer Zinserhöhung in diesem Monat gerechnet. Allgemein wird aber erwartet, dass die Notenbank die Zinsen im nächsten Monat erneut anheben wird.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54174315-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
– SINGAPUR
Singapurs Zentralbank strafft unerwartet Geldpolitik – Überblick am Morgen / DJN, 14.10.2021
Die Zentralbank Singapurs hat unerwartet ihre Geldpolitik gestrafft. Wie die Behörde mitteilte, will sie die Neigung des Bandes des nominalen effektiven Wechselkurses des Singapur-Dollar leicht anheben, nachdem sie sie bisher bei null gehalten hatte. Zwölf der 14 vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank ihre Politik bei ihrer halbjährlichen Überprüfung unverändert lassen würde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54197902-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
– TÜRKEI
Türkische Lira erreicht nach Entlassung von Notenbankern neues Rekordtief – Überblick am Mittag / DJN, 14.10.2021
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat drei Mitglieder des Zentralbankrats entlassen und damit die Währung des Landes weiter auf Talfahrt geschickt. Die Lira verlor über Nacht rund 1 Prozent und stand am Donnerstagmorgen bei 9,19 zum Dollar. Sie erreichte damit ein neues Rekordtief. Seit Jahresbeginn hat die Lira angesichts der Bedenken wegen der politischen Einmischung in die Arbeit der Zentralbank fast ein Fünftel an Wert verloren. Erdogan entließ zwei stellvertretende Gouverneure der Notenbank sowie ein Mitglied des geldpolitischen Ausschusses, wie per Dekret bekannt wurde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54201343-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
– EUROPÄISCHE UNION / EZB
EZB: Deutlich höhere PEPP-Nettokäufe in der Vorwoche – Tabelle / DJN, 12.10.2021
Die Anleihebestände der Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP sind in der Woche zum 8. Oktober 2021 stärker als zuvor gestiegen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahmen sie um 23 (zuvor: 6) Milliarden Euro zu. Zum APP nannte die EZB folgende Daten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54179284-tabelle-ezb-deutlich-hoehere-pepp-nettokaeufe-in-der-vorwoche-015.htm
Hans-Joachim Koch: Deutsche Wirtschaftsinstitute erwarten bis 2023 keine EZB-Zinserhöhung – Nach Abklingen der Basiseffekte Einpendeln der Inflation um 2 Prozent – Volumen des entfallenden PEPP-Programms wird durch Aufstockung des APP-Programms aufgefangen werden – Neubelebung der TLTRO-Geschäfte – Geldpolitisch wird weder eine Expansion noch eine Restriktion erwartet – Skepsis bezüglich Inflationseinschätzung – DJN, 14.10.2021
Aus Sicht der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ist bis einschließlich 2023 nicht mit einer Anhebung der Leitzinsen im Euroraum zu rechnen. Sie gehen aber in ihrem Herbstgutachten davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das Volumen der im Rahmen des Anleihekaufprogramms PEPP monatlich erworbenen Wertpapiere „wohl im Winterhalbjahr 2021/22 allmählich reduziert“ und dann im März 2022 auslaufen lassen wird.
Die Annahme zur Zinsentwicklung im Prognosezeitraum bis 2023 basiert darauf, dass sich die Inflation nach Abklingen der Basiseffekte und temporären Faktoren wie erwartet wieder in der Nähe des Inflationsziels von 2 Prozent bewegen wird. Die Konjunkturforscher verweisen darauf, dass die Forward Guidance angesichts der aktuellen Prognosen der EZB für die Preisentwicklung weiterhin keine Leitzinserhöhungen erwarten lasse.
Da das mittelfristige Inflationsziel in den EZB-Projektionen weiterhin nicht erreicht wird, dürfte für das wegfallende PEPP-Volumen stattdessen das APP-Programm etwas aufgestockt werden, erwarten die Institute. Bei den längerfristigen Refinanzierungsgeschäften werde das pandemiebedingt zusätzlich aufgelegte PELTRO-Programm wohl planmäßig auslaufen.
Die schon seit 2014 angebotenen TLTRO-Geschäfte dürften jedoch neu aufgelegt werden, um dem Bankensystem weiterhin einen stabilen und günstigen Refinanzierungsrahmen zu bieten. Anderenfalls würde die Refinanzierung deutlich weniger günstig werden, wenn sich die Banken ab Jahresbeginn wieder verstärkt über Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Zinssatz derzeit 0,00 Prozent) mit Liquidität versorgen müssten.
Damit dürfte die Geldpolitik im Prognosezeitraum weiter locker bleiben. Es werden weder neue expansive Impulse noch deutlich restriktive Impulse erwartet. Angesichts der aktuellen Inflationsdynamik und der strategischen Neuausrichtung der EZB-Geldpolitik ergeben sich jedoch Risiken für diese Annahme, wie die Institute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose schreiben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54200471-institute-erwarten-bis-2023-keine-ezb-zinserhoehung-015.htm
Villeroy de Galhau: Inflation sinkt bis Ende 2022 unter 2% – Überblick am Mittag / DJN, 11.10.2021
EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau rechnet damit, dass die Inflation im Euroraum in den nächsten Monaten ihren Höhepunkt erreichen und bis Ende 2022 auf unter 2 Prozent sinken wird. „Ein Buckel ist kein langfristiger Trend, auch wenn er hoch ist“, sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag in einem Radiointerview. Er glaube nicht, dass es zu einer Preisspirale kommen werde, auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) diesbezüglich wachsam bleiben müsse.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54167325-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Hans Bentzien: Lane: EZB handelt bei „dauerhaft weit über 2% Inflation“ – DJN, 11.10.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet die aktuell erhöhten Inflationsraten nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane nicht als einen Anlass für eine geldpolitische Straffung, da die mittelfristig erwartete Inflation zu niedrig sei. Lane sagte bei der Jahrestagung des internationalen Bankenverbands IIF: „Für mich ist die große Frage: Wird die Inflation dauerhaft weit über 2 Prozent bleiben? Dann wären wir in einer Gefahrenzone, wo die Geldpolitik handeln müsste.“
Gegenwärtig rechne die EZB zwar mit einem Inflationsanstieg, der aber nicht bis 2 Prozent reiche. „Für das Ende unseres Prognosehorizonts erwarten wir 1,5 Prozent Inflation, das sind deutlich weniger als 2 Prozent“, sagte Lane. Unter diesen Umständen gebe es keine Notwendigkeit zu handeln. Lane zufolge will die EZB vermeiden, ihre Geldpolitik verfrüht zu straffen. „Es ist ein globaler Trend, dass wir weniger ‚trigger happy‘ sein dürfen und viel mehr auf die tatsächlichen Ergebnisse achten müssen“, sagte er.
Die EZB veröffentlicht im Dezember neue Inflationsprognosen, die dann auch das Jahr 2024 erfassen werden. Zu diesem Zeitpunkt will sie auch über die Zukunft ihres Pandemiekaufprogramms PEPP entscheiden. Lane sagte: „Die Anleihekäufe bleiben, egal unter welchem Label.“ Die Bedingungen für eine völlige Einstellung der Käufe seien nicht gegeben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54168483-lane-ezb-handelt-bei-dauerhaft-weit-ueber-2-inflation-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Lane: Einmalige Lohnsteigerungen noch keine Spirale – DJN, 11.10.2021
EZB-Chefvolkswirt Philip Lane dämpft die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf die sich in einigen Ländern abzeichnenden höheren Tarifabschlüsse mit einer Straffung ihrer Geldpolitik reagieren wird. „Die Beobachtung der Lohnentwicklung und die Unterscheidung zwischen vorübergehenden und anhaltenden Veränderungen des Lohnwachstums wird eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der zugrunde liegenden Inflation spielen“, sagte Lane laut veröffentlichtem Text bei einer EZB-Forschungskonferenz.
Insbesondere bedeute eine einmalige Verschiebung des Lohnniveaus als Teil der Anpassung an einen vorübergehenden unerwarteten Anstieg des Preisniveaus keine Trendverschiebung des Verlaufs der zugrunde liegenden Inflation.
Die Zins-Guidance der EZB besagt, dass die Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis der EZB-Rat einen Anstieg der Inflation auf das Ziel von 2 Prozent deutlich vor dem Ende des Projektionszeitraums und dauerhaft für den Rest dieses Zeitraums erkennen kann.
Sie verlangt außerdem, dass die schon erreichten Fortschritte bei der unterliegenden Inflation so deutlich erkennbar sein müssen, dass eine mittelfristige Stabilisierung der Inflation bei 2 Prozent plausibel scheint. Auf diesen Punkt beziehen sich Lanes Äußerungen. Lane verwies darauf, dass der größte Teil des Harmonisierten Verbraucherpreisindex im Dienstleistungssektor gemessen werde. Dort seien die Löhne das wichtigste Element und hier wiederum die „persistente“ Komponente der Lohnsteigerungen.
Der EZB-Chefvolkswirt machte zudem deutlich, dass steigende Energiepreise kein Grund für die EZB sind, ihre Geldpolitik zu straffen. Zwar erhöhten sie kurzfristig die Gesamtinflation, doch schwächten sie andererseits über negative Vermögenseffekte und die Terms of Trade die unterliegende Inflation.
Lane deutete zudem an, dass Anleihekäufe auch nach dem Ende des Pandemiekaufprogramms PEPP eine wichtige Quelle geldpolitischer Unterstützung bleiben werden. „Insbesondere die Komprimierung der Laufzeitprämien über den Entzug von Duration spielt eine quantitativ bedeutsame Rolle bei der Bestimmung der längerfristigen Renditen und gewährleistet, dass die Finanzierungsbedingungen ausreichend günstig sind, um mit der Erreichung unseres mittelfristigen Inflationsziels vereinbar zu sein“, sagte er.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54168069-ezb-lane-einmalige-lohnsteigerungen-noch-keine-spirale-015.htm
EZB-Ratsmitglied warnt vor Inflationsrisiken – dpa-AFX, 11.10.2021
Das niederländische Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Klaas Knot, hat Anleger an den Finanzmärkten vor Risiken einer weiter steigenden Inflation gewarnt. Seit Beginn der Corona-Krise hätten sich Akteure an den Finanzmärkten deutlich risikofreudiger gezeigt, sagte Knot am Montag in Amsterdam. Das riskantere Anlegerverhalten mache die Märkte aber anfälliger für Stimmungsumschwünge. Die stärkere Risikofreude ist nach Einschätzung des Notenbankers nur bei einer schwachen Inflation und niedrigen Zinsen tragfähig.
Die aktuell vergleichsweise hohe Inflation in der Eurozone ist nach Einschätzung von Knot noch weitgehend als vorübergehend anzusehen. Der Präsident der Notenbank der Niederlande machte aber auch deutlich, dass es aus der Perspektive eines gesunden Risikomanagements wichtig sei, andere Szenarien ebenfalls zu berücksichtigen.
In der Eurozone ist die Inflationsrate im September auf 3,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen. Angetrieben wird die Preisentwicklung vor allem durch einen starken Zuwachs bei den Kosten für Energie und durch die Folgen von Materialengpässen.
Bei der aktuellen Inflationsentwicklung gebe es derzeit mehr Dinge, die wir nicht verstehen, als Dinge, die wir verstehen, räumte der EZB-Notenbanker ein. Er fügte hinzu, dass der Preisdruck möglicherweise stärker sein könnte als bisher prognostiziert. Knoot gilt im EZB-Rat als Verfechter einer eher strafferen Geldpolitik. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass die Notenbank den aktuellen Preisanstieg als ein zeitlich begrenztes Phänomen ansieht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54167883-ezb-ratsmitglied-warnt-vor-inflationsrisiken-016.htm
Hans Bentzien: EZB/Enria sieht Anzeichen für schlechtere Asset-Qualität bei Banken – DJN, 14.10.2021
Der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, sieht trotz des offiziell sinkenden Volumens notleidender Kredite (Non-performing Loans – NPL) Anzeichen für zunehmende Risiken in den Bankbilanzen. „Die NPL-Zahlen sehen noch gut aus, aber trotzdem scheint sich die Asset-Qualität zu verschlechtern“, sagte Enria laut veröffentlichtem Text in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Darauf deuteten mehrere sich schneller entwickelnde Messgrößen wie der Anteil von Krediten mit Stundungen und Streckungen sowie qualitätsgeminderte Kredite der Stufe zwei hin.
Enria zufolge ist in einigen Ländern ein Anstieg der Schwachstellen am Markt für Wohnimmobilien zu beobachten. Darüber hinaus seien im ersten Quartal 2021 die Insolvenzen in einigen Sektoren gestiegen, obwohl sie im Allgemeinen unter dem Niveau vor der Pandemie blieben. „Alles in allem könnten die NPL-Prognosen der Banken zu optimistisch sein, und die Banken sollten mit der Auflösung von Rückstellungen vorsichtig bleiben und sicherstellen, dass sie über angemessene Kreditrisikokontrollen verfügen“, mahnte der EZB-Bankenaufsichtschef.
Da es schwierig sei, die Entwicklung der Asset-Qualität verlässlich abzuschätzen, liegt der Schwerpunkt der Aufsichtsarbeit laut Enria weiterhin auf der Kreditrisikokontrolle der Banken. „Wir untersuchen auch gefährdete Sektoren wie die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe sowie Gewerbeimmobilien“, sagte er.
Enria erläuterte außerdem, wie die EZB nach den beendeten Stresstests in der laufenden Bankenaufsicht verfahren wird. In einem zweistufigen Ansatz wird demnach jede Bank zunächst auf Basis ihres Stresstestergebnisses einer von vier Säulen-2-Gruppen zugeteilt. Im Rahmen der Säule 2 werden die institutsspezifischen Eigenkapitalanforderungen bestimmt, Säule 1 enthält die für alle Institute geltenden Mindestanforderungen.
Die Aufsichtsbehörden werden dann nach eigenem Ermessen die Säule-2-Kapitalanforderungen dem das individuellen Profil der Bank anpassen. Sie können Anpassungen innerhalb der Spannen der entsprechenden Gruppe vornehmen und nur unter außergewöhnlichen Umständen über diese Spannen hinausgehen. Erfüllen müssen die Banken diese Anforderungen allerdings erst nach Auslaufen der pandemiebedingten Sonderregelungen, also Ende 2022.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54198620-ezb-enria-sieht-anzeichen-fuer-schlechtere-asset-qualitaet-bei-banken-015.htm
Hans Bentzien: EZB-Ratsmitglied Kazimir wehrt sich gegen Bestechungsvorwürfe – DJN, 13.10.2021
Der Gouverneur der Slowakischen Nationalbank und ehemalige Finanzminister Peter Kazimir wehrt sich gegen Bestechungsvorwürfe. „Ihm wird Bestechung vorgeworfen, und wir werden gegen die Anschuldigung Beschwerde einlegen“, sagte sein Anwalt Ondrej Mularcik laut einem Bericht der Website aktuality.sk. Weiteren Angaben könne er nicht machen. Kazimir ist Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB wollte den Vorgang nicht kommentieren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54187712-ezb-ratsmitglied-kazimir-wehrt-sich-gegen-bestechungsvorwuerfe-015.htm
– DEUTSCHLAND / DBB, BdB, BAFIN
Hans Bentzien: Abwicklung gefallener Banken: Bundesbank/Vizepräsidentin Buch verteidigt Ring-fencing bei Bankenregulierung – Finanzstabilitätsrisiko: Ohne Ring-fencing Filialisierung schwacher Banken im Gastgeberland leichter möglich – BAFIN-Buch kontra EZB: Ressourcen-Risiko-Balance halten, Abwicklungsregime stärken und glaubwürdiger gestalten – DJN, 14.10.2021
Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch hat die Praxis nationaler Aufsichtsbehörden verteidigt, Kapital und Liquidität von Zweigstellen ausländischer Banken regulatorisch im Gastgeberland einzuschließen („Ring-fencing“). In einer Rede bei einer Jahrestagung des Bankenabwicklungsfonds SRB sagte Buch, dieses Vorgehen erhöhe das Vertrauen des Gastgeberlandes, dass solche Institute ohne Einsatz öffentlicher Gelder abgewickelt werden könnten.
„Ohne Vertrauen könnten die Behörden des Mutterlandes grenzüberschreitend tätigen Banken Anreize bieten, im jeweiligen Aufnahmeland Zweigstellen anstelle von Tochtergesellschaften zu errichten“, sagte Buch. Zweigniederlassungen ermöglichten eine flexiblere und effizientere Ressourcenallokation durch das Management der Banken in ruhigen Zeiten. Durch Zweigstellenstrukturen erhielten die Herkunftslandbehörden im Falle einer Abwicklung mehr Kontrolle über grenzüberschreitende Bankengruppen.
„Die Filialisierung kann jedoch auch Schwierigkeiten für das Aufnahmeland mit sich bringen, wenn die Zweigstellen kritische Funktionen erfüllen oder für die Finanzstabilität des Aufnahmelandes wichtig sind“, gab Buch zu bedenken.
Auch wenn sich die Abwicklungsbehörden vorab verpflichteten, bestimmte Regeln einzuhalten und keine öffentlichen Mittel zu verwenden, erweise sich dies im Nachhinein möglicherweise als nicht glaubwürdig. „In einem konkreten Abwicklungsfall besteht ein erhebliches Maß an Unsicherheit über das Ausmaß der Verluste und die Auswirkungen des Einsatzes von Abwicklungsinstrumenten“, gab Buch zu bedenken. Mechanismen zur Verbesserung der Zusammenarbeit seien daher von entscheidender Bedeutung.
Gegenwärtig jedoch achten die nationalen europäischen Aufsichtsbehörden – auch die deutschen – darauf, dass Auslandsbanken Kapital und Liquidität im Gastgeberland vorhalten. Aus Sicht der grenzüberschreitend tätiger Bankengruppen ist das ärgerlich, weil es den effizienten Einsatz von Mitteln beeinträchtigt. Nicht zuletzt macht es grenzüberschreitende Zusammenschlüsse wirtschaftlich unattraktiv.
Die Europäische Zentralbank (EZB) appelliert in ihrer Rolle als Bankenaufseherin deshalb immer wieder an die Staaten, den freien Verkehr von Kapital und Liquidität zuzulassen. Buch fordert dagegen, zunächst das Abwicklungsregime zu stärken und glaubwürdiger zu gestalten. „In dieser Diskussion ist es wichtig, die richtige Balance zwischen der freien Beweglichkeit von Ressourcen innerhalb einer Gruppe und dem Vorhalten von Ressourcen zu finden“, sagte sie.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54200003-bundesbank-buch-verteidigt-ring-fencing-bei-bankenregulierung-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): BdB/Sewing: EZB sollte wegen Inflationsdruck Geldpolitik überdenken – Negativfolgen der Minuszinsen mildern – Günstiges Ausstiegsszenario aus NIRP-Politik: höhere Inflation wird länger bestehen bleiben – DJN, 13.10.2021
Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Sewing, hat angesichts der anhaltend hohen Inflationsraten im Euroraum an die Europäische Zentralbank (EZB) appelliert, ihre Geldpolitik zu überdenken. Die von den Negativzinsen ausgelösten Belastungen sollten reduziert werden, forderte Sewing, der auch Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank AG ist.
„Mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise und der Rückkehr von Inflationsraten von deutlich über 2 Prozent ist der Zeitpunkt gekommen, über eine Ausstiegsperspektive aus dem geldpolitischen Krisenmodus [der NIRP, Negative Interest Rate Policy] zu sprechen“, sagte Sewing.
Auch wenn die Teuerungsraten 2022 Stand heute wieder zurückgehen dürften, spreche vieles dafür, dass der erhöhte Inflationsdruck noch länger bleiben und die Inflationsrate in der Währungsunion mittelfristig wohl nicht mehr auf das Vor-Pandemie-Niveau von deutlich unter 2 Prozent zurückfallen werde.
„Die Geldpolitik sollte deswegen offen über Wege diskutieren, die aus dem gegenwärtigen Ausnahmezustand herausführen“, forderte Sewing. Insbesondere die Negativzinsen, die seit Mitte 2014 die europäischen Banken erheblich belasteten, „können und dürfen kein dauerhaftes Instrument der Geldpolitik“ sein, so der BdB-Präsident.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54188571-bdb-sewing-ezb-sollte-wegen-inflationsdruck-geldpolitik-ueberdenken-015.htm
Bafin-Chef Branson: Ungewollte Nebenwirkungen von Basel 3 verhindern – Überblick am Abend / DJN, 13.10.2021
Die neue Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 sollten nach Aussage von Mark Branson, Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), nicht dazu führen, dass Mittelstandskredite oder Immobilienkredite teurer werden. „Es ist aus meiner Sicht nicht das Ziel dieser Reform, KMU-Kredite oder Immobilienkredite zu verteuern, und es ist auch nicht ihr Ziel, sie günstiger zu machen“, sagte Branson. Ziel dieses Pakets sei es, zu verhindern, dass „Modellbanken“ übermäßig profitierten. „Wenn es ungewollte Nebenwirkungen gibt, dann muss man einen anderen, äquivalenten Weg finden“, fügte er hinzu.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193431-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Hans Bentzien: BdB/Sewing: EU-Kommission hat bei gesetzlicher Umsetzung des Basel-Abkommens klare Haltung zu Output Floors – „Parallel Stack Approach“ lehnt EU-Kommission ab: Eigenkapitalanforderung und „Kleinrechnungs-Option“ für Banken in Diskussion – DJN, 13.10.2021
Die deutschen Banken haben offenbar keine Hoffnung mehr, dass die EU-Kommission die Pläne des Baseler Ausschusses für strengere Regeln bei der Bemessung von Eigenkapitalanforderungen noch verwässern wird. „Es scheint zur Zeit so zu sein, dass die EU-Kommission da eine klare Haltung hat“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, in seiner Eigenschaft als Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) in einer Pressekonferenz anlässlich der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank.
Sewing bezog sich dabei auf das Vorhaben des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, die Möglichkeit der Banken, ihre Risikoaktiva und damit die Eigenkapitalanforderungen über interne Modelle kleinzurechnen, mit so genannten Output Floors zu begrenzen. Das hätte zur Folge, dass die so berechneten Risikoaktiva mindestens 72,5 Prozent der in einem Standardverfahren berechneten Aktiva ausmachen müssten.
Die Bankenindustrie hatte den Vorschlag gemacht, bei der Bemessung der Eigenkapitalanforderungen für besonders riskante Geschäftsmodelle nicht die durch Output Floors erhöhten Risiko-Aktiva zu verwenden. Diesen „Parallel Stack Approach“ lehnt die EU-Kommission laut Sewing jedoch ab. Die Basel 3 genannte Eigenkapitalrichtlinie muss noch in europäisches Recht umgesetzt werden. Vorschläge dafür dürfte die EU-Kommission demnächst machen.
Sewing sagte, angesichts der festen Haltung der Kommission in Sachen „Parallel Stack“ werde man sich nun auf andere Punkte des Reformpakets konzentrieren. Er nannte das Problem von Unternehmen ohne Kreditrating und die Hypothekenkredite. Der deutsche und europäische Wohnungs- und Baufinanzierungsmarkt sind schon aus rechtlichen Gründen ein anderer als in Amerika“, sagte er. „Ich bin immer noch guten Mutes, dass wir hoffentlich zu einer guten Lösung kommen.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54189536-bdb-sewing-eu-kommission-hat-klare-haltung-zu-output-floors-015.htm
Andrea Thomas: Andrea Thomas (WSJ): BdB/Sewing will Investitionsoffensive und fairen Wettbewerb für Banken – Stärkere Abhängigkeit von globalen Banken wäre falsch – Globale Abhängigkeiten reduzieren – DJN, 13.10.2021
Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Sewing, hat Deutschland und Europa zu einer Investitionsoffensive aufgerufen, um private Investitionen zu erleichtern. Auch müsse der Bankensektor global wettbewerbsfähiger gemacht werden. Er warnte Deutschland und Europa zudem davor, dass sich der globale Wettbewerb um die maßgeblichen Zukunftstechnologien noch erheblich schärfer werde, sagte Sewing bei einer Pressekonferenz anlässlich der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank.
Für die deutschen Privatbanken sind aus Sewings Sicht drei Dinge wichtig: Europa müsse sich erstens dem globalen Wettbewerb stellen und eine Investitionsoffensive einläuten. Der Kontinent stehe beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung und bei der Wettbewerbsfähigkeit vor einem beispiellosen Transformationsjahrzehnt, für das er noch nicht gut aufgestellt sei.
„Niemand bestreitet, dass es einen erheblichen staatlichen Investitionsbedarf gibt. Um die Transformation unserer Wirtschaft und das Ziel ‚Null Emissionen bis 2045‘ finanzieren zu können, müssen wir aber in erster Linie privates Kapital mobilisieren“, so der BdB-Präsident. Daher müssten die Weichen für mehr private Investitionen gestellt werden. „Die Arbeit an der Kapitalmarkt- und der Bankenunion muss in den kommenden Monaten allergrößte Priorität genießen“, so Sewing.
*** Stärkere Abhängigkeit von globalen Banken wäre falsch ***
In seinem zweite Appell drängte er dazu, den europäischen Finanzbinnenmarkt so rasch wie möglich verwirklichen. Denn davon würden alle profitieren. Unternehmen kämen leichter an Kapital, Verbraucher könnten unter sehr viel mehr Finanzprodukten auswählen und Banken hätten endlich einen großen Heimatmarkt und könnten dadurch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA überwinden.
„Es wäre ein strategischer Fehler, wenn wir uns in einer zunehmend fragmentierten und von nationalen Interessen dominierten Welt noch stärker von globalen Banken abhängig machten, die ihren Sitz außerhalb Europas haben“, warnte Sewing. Über allem stehe daher die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzplatzes.
In seinem dritten Punkt mahnt der Bankenpräsident an, dass die Profitabilität des deutschen und europäischen Finanzsektors zu steigern sei. Zwar sei das vor allem Aufgabe der Banken. „Dazu gehören aber auch faire Wettbewerbsbedingungen, also ein wirkliches Level Playing Field“, mahnte Sewing. Dies sei gegenwärtig jedoch nicht gegeben.
„Die regulatorische Schieflage im Wettbewerb mit den Big Techs, die Teile des Bankengeschäfts abgreifen und von ihren großen Datenbergen profitieren, ist mit Händen zu greifen“, kritisierte Sewing. Wenn europäische Banken immer restriktiver reguliert würden und das Geschäft dadurch in andere Finanzbereiche abwanderten, sei für die Stabilität nichts gewonnen.
*** Globale Abhängigkeiten reduzieren ***
Sewing mahnte zudem angesichts der anhaltenden Pandemie, der wirtschaftliche Aufschwung bleibe solange brüchig, wie Teile der Welt unter Corona litten. Eine höhere Impfquote sei nötig.
Außerdem habe sich gerade in der Pandemie gezeigt, dass die europäische Wirtschaft wegen der weltweiten Arbeitsteilung besonders anfällig sei für Rohstoffmangel, Materialknappheit und Lieferengpässe. Es liege in erster Linie an den Unternehmen, hier aktiv zu werden. „Um unsere Wirtschaft insgesamt widerstandsfähiger zu machen, müssen wir wirtschaftliche Abhängigkeiten reduzieren und Lieferketten diversifizieren“, sagte der BdB-Präsident.
Bei der Rückholung von Produktionskapazitäten gehe es nicht darum, Europa zu einer Festung zu machen oder das gegenwärtige Niveau weltweiter Waren- und Investitionsströme grundsätzlich in Frage zu stellen.
„Wir brauchen in einigen strategischen Bereichen mehr Diversifizierung, teilweise auch ein Stück Autonomie, aber wir brauchen ganz sicher keine Bestrebungen in Richtung Autarkie“, so Sewing. „Freihandel und globale Arbeitsteilung bleiben von existenzieller Bedeutung für unseren Wohlstand – gerade in Deutschland und Europa.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54188858-bdb-sewing-will-investitionsoffensive-und-fairen-wettbewerb-fuer-banken-015.htm
USA
Sylvia Walter: USA droht Zahlungsunfähigkeit an Weihnachten – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 13.10.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/10/treasury-default.png
Erst vor knapp einer Woche hat der US-Senat einer vorübergehenden Erhöhung der Schuldenobergrenze zugestimmt. Gestern abend (Ortszeit) hat auch das Repräsentantenhaus geschlossen für den Vorschlag votiert. Dadurch wurde die drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abgewendet.
Doch der zusätzliche Segen von 480 Mrd. $ wird den Haushalt nicht lange finanzieren können, wie die Ökonomen von Oxford Economics berechnet haben. Kurz vor Weihnachten wird wieder Ebbe in der Staatskasse herrschen. Bis dahin dürfte das Barguthaben (Cash balance) aufgebraucht sein, die Kreditaufnahmefähigkeit (Borrowing ability) wird schon deutlich früher dahingeschmolzen sein.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2161/
Biden unterzeichnet Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze – Überblick am Morgen / DJN, 15.10.2021
US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag (Ortszeit) ein Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze unterzeichnet und damit die drohende Zahlungsunfähigkeit zunächst abgewandt. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag für die Anhebung. Durch den Beschluss wird die Schuldengrenze um 480 Milliarden Dollar (415 Milliarden Euro) erhöht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54209386-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
US-Repräsentantenhaus stimmt für Anhebung von Schuldenobergrenze – Überblick am Morgen / DJN, 13.10.2021
Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben einer Anhebung der Schuldenobergrenze zugestimmt und damit eine Zahlungsunfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt vorerst abgewendet. Die 219 Abgeordneten der US-Demokraten, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, stimmten am Dienstag (Ortszeit) geschlossen für den Vorschlag. Damit wird das Schuldenlimit um 480 Milliarden Dollar erhöht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54186271-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
USA drohen Iran in Atomstreit Konsequenzen an – Überblick am Morgen / DJN, 14.10.2021
Im Atomstreit mit dem Iran haben die USA der Regierung in Teheran mit Konsequenzen gedroht, sollte eine Verhandlungslösung scheitern. „Wir werden alle Optionen in Betracht ziehen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Jair Lapid in Washington.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54197902-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Hafen von Los Angeles soll wegen Lieferengpässen 24 Stunden am Tag laufen – Überblick am Abend / DJN, 13.10.2021
Angesichts der weltweiten Lieferengpässe wegen der Corona-Pandemie soll der Hafen der US-Millionenstadt Los Angeles 24 Stunden am Tag laufen. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Hafenbetreiber und der Gewerkschaft der Hafenarbeiter wollte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch verkünden, wie US-Regierungsvertreter sagten. Auch Logistikunternehmen wie Fedex und UPS sollen ihre Arbeitszeiten ausweiten, um den Rückstau bei Lieferungen abzubauen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193431-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
EIA: US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gestiegen – DJN, 14.10.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. Oktober stärker als erwartet ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,088 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 0,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,345 Millionen Barrel erhöht. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 5,2 Millionen Barrel eine Zunahme registriert worden.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,958 Millionen Barrel ab. Analysten hatten dagegen ein Plus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,256 Millionen gestiegen waren. Die API-Daten hatten einen Rückgang von 4,6 Millionen Barrel angezeigt. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11,4 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,9 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54204152-us-rohoellagerbestaende-staerker-als-erwartet-gestiegen-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände – DJN, 13.10.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,6 Millionen Barrel nach plus 3,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,6 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54194848-api-daten-zeigen-anstieg-der-us-rohoellagerbestaende-015.htm
US-Importpreise ziehen spürbar an – DJN, 15.10.2021
Die US-Importpreise sind im September kräftig geklettert, wenngleich nicht ganz so stark, wie von Volkswirten geschätzt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, nach einem Minus von 0,3 Prozent im August. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,5 Prozent ausgegangen. Die Jahresveränderung lag bei 9,2 Prozent.
Den Angaben zufolge erhöhten sich die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl nur um 0,1 Prozent. Für die Ölpreise wurde verglichen mit dem Vormonat ein Plus von 3,9 Prozent gemeldet.
Die Exportpreise verzeichneten im September einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent, nachdem sie sich im August um 0,4 Prozent erhöht hatten. Auf Jahressicht wurde ein Plus von 16,3 Prozent berichtet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54213847-us-importpreise-ziehen-spuerbar-an-015.htm
Hans Bentzien u.a.: US-Erzeugerpreise steigen im September gegenüber dem Vormonat etwas weniger als erwartet, aber mit stärkstem Zuwachs seit 2010 auf Jahressicht – DJN/dpa-AFX, 14.10.2021
Der Preisdruck auf Produzentenebene in den USA ist im September etwas geringer als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lagen um 8,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.
Das ist der stärkste Zuwachs seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2010. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 8,7 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Rate 8,3 Prozent betragen.
Auch im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, weiter an. Gegenüber August erhöhten sie sich um 0,5 Prozent, nach 0,7 Prozent im Vormonat. Auch hier wurden die Erwartungen von Analysten leicht unterboten. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent prognostiziert.
Ohne Energie und andere im Preis schwankungsanfällige Waren erhöhten sich die Erzeugerpreise um 6,8 Prozent zum Vorjahresmonat und um 0,2 Prozent zum Vormonat.
Getrieben werden die Herstellerpreise durch eine Reihe von Faktoren. Dazu zählt die zum Teil drastische Materialknappheit, die auf Lieferprobleme im weltweiten Handelsverkehr zurückgehen. Hinzu kommen stark steigende Preise für Energie, die den Produktionsprozess erschweren und verteuern.
Die jüngste Entwicklung dürfte die Inflationserwartungen weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Nach Zahlen vom Mittwoch waren die Lebenshaltungskosten im September zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent gestiegen. Das ist deutlich mehr als das Ziel der Fed von zwei Prozent. Allerdings betrachtet die Notenbank den Anstieg überwiegend als zeitweilig und durch Sonderfaktoren getrieben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54202281-us-erzeugerpreise-steigen-im-september-etwas-weniger-als-erwartet-015.htm
Hans Bentzien u.a.: US-Inflation steigt unerwartet auf 5,4 Prozent – DJN/dpa/AFX, 13.10.2021
Der Inflationsdruck in den USA hat im September entgegen den Erwartungen erneut zugenommen. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 5,4 (August: 5,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel und Energie erhöhten sich um 0,2 Prozent, die Jahresteuerung blieb bei 4,0 Prozent.
Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit monatlichen Preisanstiegen von je 0,3 Prozent und unveränderten Jahresraten von 5,3 und 4,0 Prozent gerechnet.
Mit dem Anstieg erreichte die Inflation in den USA wieder das Niveau der Sommermonate Juni und Juli, als die Rate den höchsten Wert seit 2008 erreicht hatte.
Die Kerninflation ohne im Preis oft schwankende Komponenten wie Energie und Lebensmittel betrug verglichen mit dem Vorjahresmonat 4,0 Prozent. Ökonomen hatten dies erwartet.
In der größten Volkswirtschaft der Welt liegt die Inflation weiter deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed, die zwei Prozent anstrebt. Die Fed macht aber vor allem vorübergehende Faktoren für die hohe Rate verantwortlich. Insbesondere wird die Inflation durch hohe Energiepreise getrieben. Hier meldete das Ministerium für September im Jahresvergleich eine Verteuerung um knapp 25 Prozent.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54190604-us-inflation-steigt-unerwartet-auf-5-4-prozent-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54190633-usa-inflationsrate-steigt-ueberraschend-auf-5-4-prozent-energiekosten-treiben-016.htm
New Yorker Konjunkturindex fällt deutlicher als erwartet – DJN, 15.10.2021
Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Oktober etwas schwächer als erwartet gewachsen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf 19,8 (September: 34,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 26,5 prognostiziert.
Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.
Die Indexkomponente für den Ordereingang sank im September auf 24,3 (33,7) Punkte und der Subindex für die Beschäftigung auf 17,1 (20,5) Punkte. Für die erzielten Preise wurde ein Wert von 43,5 (47,8) Punkten gemeldet.
Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.
QUELLE: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html
US-Konsumentenpreise steigen schneller – Vor allem stark gestiegene Energiepreise treiben – FED-Chef: inflationsbefeuernde Lieferketten-Engpässe nicht absehbar – Reuters/Finanz & Wirtschaft, 13.10.2021
US-Dienstleistungen sowie Energie kosten mehr als im Vorjahresmonat. Experten hatten damit gerechnet, dass die Rate auf dem August-Niveau verharrt.
Der ohnehin starke Preisauftrieb in den USA hat sich im September überraschend beschleunigt. Waren und Dienstleistungen kosteten 5,4% mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Damit wurde das 13-Jahres-Hoch vom Sommer erneut erreicht. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet, dass die Inflationsrate auf dem August-Niveau von 5,3% verharrt. Besonders Energie kostet erheblich mehr: Kraftstoffe etwa verteuerten sich um 42,1%. Wegen Knappheiten waren auch Gebrauchtwagen und -Lkw teurer als im September 2020. Hier lag der Aufschlag bei 24,4%.
«Ein wesentlicher Grund sind die Energiepreise», sagte NordLB-Analyst Bernd Krampen zur hartnäckig hohen Inflation. «Aber auch Nahrungsmittel, Güterengpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenschliessungen, Containermangel halten den Preisdruck hoch.» Viele Experten sehen noch kein Ende der Inflationsspirale, zumal auch die Mieten zuletzt merklich gestiegen sind. «Angesichts der auch im Oktober weiter anziehenden Notierungen für Energie könnte sich die Vorhersage mancher Ökonomen, dass der Höhepunkt der US-Inflation schon hinter uns liegt, als voreilig herausstellen», sagte LBBW-Volkswirt Dirk Chlench. Das schlage auf die Verbraucher durch. So kostet Erdöl aktuell mit rund 80 Dollar je Fass so viel wie seit Jahren nicht mehr, weil mit der Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Pandemie die Nachfrage steigt. Auch die Preise für Erdgas (Erdgas 1.82 -3.75%) sind kräftig angezogen.
US-Notenbankchef Jerome Powell machte für die hohe Inflation vor allem Engpässe in der Lieferkette verantwortlich. Er hielt das bislang für ein vorübergehendes Phänomen. Allerdings gibt es derzeit noch keine Anzeichen dafür, dass der Mangel an wichtigen Produkten wie Halbleitern zu Ende geht. Die US-Notenbank, die Vollbeschäftigung und stabile Preise anstrebt, hat die Zahlen genau im Blick. Angesichts der erhöhten Inflation und der fortschreitenden Erholung am Arbeitsmarkt nach dem Corona-Schock fasst sie ein Herunterfahren ihrer Krisenhilfen ins Auge. «Wegen der Inflationsrisiken dürfte die Fed im November beschliessen, die Anleihenkäufe zu reduzieren, auch wenn die Wirtschaft zuletzt an Schwung verloren hat», sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/us-verbraucherpreise-steigen-schneller/
US-Realeinkommen steigen im September um 0,8 Prozent – DJN, 13.10.2021
Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im August ein Rückgang um 0,2 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug saison- und inflationsbereinigt 391,62 US-Dollar nach 388,57 Dollar im Vormonat.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54190682-us-realeinkommen-steigen-im-september-um-0-8-prozent-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
USA: Einzelhandel überrascht im September mit Umsatzanstieg – dpa-AFX, 15.10.2021
Der US-Einzelhandel hat seine Umsätze im September zur Überraschung von Experten ausgeweitet. Die Umsätze seien um 0,7 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Außerdem wurde der Anstieg im Vormonat von 0,7 auf 0,9 Prozent nach oben revidiert.
Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen stiegen die Umsätze um 0,8 Prozent im Monatsvergleich. Hier wurde nur ein Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54213468-usa-einzelhandel-ueberrascht-mit-umsatzanstieg-016.htm
Michigan-Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt – DJN/dpa-AFX, 15.10.2021
Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober entegene den Erwartungen abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 71,4. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 73,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende September lag er bei 72,8.
Der Index für die Erwartungen belief sich auf 67,2 (Vormonat: 68,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 77,9 (80,1) angegeben.
Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,8 von 4,6 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 2,8 von 3,0 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.
Das Konsumklima bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Die Kaufbereitschaft würde vor allem durch den jüngsten Preisanstieg belastet, hieß es von der Universität. Im September ist die Inflationsrate auf 5,4 Prozent gestiegen. Sie erreichte damit wieder das Niveau der Sommermonate Juni und Juli, als die Rate den höchsten Wert seit 2008 erreicht hatte.
Die Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Konsumente trübte sich erneut ein. Die Erwartungen der Verbraucher gingen ebenfalls zurück, wie aus der Erhebung hervorgeht.
Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54214708-stimmung-der-us-verbraucher-im-oktober-eingetruebt-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54214508-usa-konsumklima-der-uni-michigan-truebt-sich-ueberraschend-ein-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.sca.isr.umich.edu/
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet – DJN/dpa-AFX, 14.10.2021
Am US-Arbeitsmarkt hat sich die Lage überraschend deutlich verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel erstmals in der Corona-Krise unter 300 000.
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. Oktober 2021 deutlicher als erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel sie auf saisonbereinigter Basis um 36.000 auf 293.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 318.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 329.000 von ursprünglich 326.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 10.500 auf 334.250.
In der Woche zum 2. Oktober erhielten 2,593 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 134.000 weniger als in der Vorwoche.
Seit Beginn des Jahres ist die Zahl dank der Aufhebung von Corona-Beschränkungen im Trend merklich gefallen. In den Sommermonaten war die Erholung auf dem Arbeitsmarkt allerdings zeitweise ins Stocken geraten.
Die wöchentlichen Hilfsanträge bewegen sich trotz des Rückgangs immer noch auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. In der Zeit vor der Corona-Krise, die ab dem Frühjahr 2020 in den USA einsetzte, wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Allerdings befand sich der Jobmarkt vor der Krise in einem ungewöhnlich guten Zustand nahe der Vollbeschäftigung.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54202427-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-sinken-staerker-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54202082-usa-arbeitslosen-hilfsantraege-sinken-erstmals-in-corona-krise-unter-300-000-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
CHINA
Chinas Präsident pocht nach jüngsten Spannungen auf Wiedervereinigung mit Taiwan – Wochenendüberblick / DJN, 11.10.2021
Chinas Präsident Xi Jinping hat nach den jüngsten militärischen Spannungen zwischen Peking und Taipeh seine Forderung nach einer „friedlichen“ Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt. „Die vollständige Wiedervereinigung unseres Landes kann und wird verwirklicht werden“, sagte Xi am Samstag anlässlich des 110. Jahrestags der chinesischen Revolution, die zum Sturz der Qing-Dynastie und zur Ausrufung der Republik geführt hatte. Der 10. Oktober ist zugleich der Nationalfeiertag Taiwans.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54162544-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-09-und-10-oktober-2021-015.htm
Erzeugerpreise in China mit stärkstem Anstieg seit über 20 Jahren – Überblick am Morgen / DJN, 14.10.2021
Die Produzentenpreise in China sind im September so stark gestiegen wie seit 1996 nicht mehr. Der Erzeugerpreisindex (PPI) kletterte vergangenen Monat um 10,7 Prozent, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Im Vormonat lag der Zuwachs bei 9,5 Prozent. Ökonomen hatten laut Wall Street Journal für September nur mit einem Anstieg um 10,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat kletterte der PPI um 1,2 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54197902-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Chinas Exporte ziehen im September stärker als erwartet an – Überblick am Morgen / DJN, 13.10.2021
Die chinesischen Exporte sind im vergangenen Monat schneller als erwartet gestiegen und trotzten logistischen Engpässen, Stromausfällen und anderen Widrigkeiten, die die Nachfrage dämpfen können. Die Ausfuhren legten im September um 28,1 Prozent zu und wuchsen damit stärker als im August mit 25,6 Prozent, wie die Zollverwaltung am Mittwoch mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen geringeren Anstieg von 21,0 Prozent erwartet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54186271-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Chinas Autoverkäufe mit kräftigem Rückgang im September – Überblick am Morgen / DJN, 12.10.2021
Der chinesische Automarkt hat sich im dritten Quartal wegen den anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern deutlich abgekühlt. Wie der chinesische Herstellerverband mitteilte, sanken die Pkw-Verkäufe alleine im September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 1,58 Millionen Fahrzeug. Das ist der stärkste Rückgang seit März vergangenen Jahres. Im Zeitraum Juli bis September gingen die Pkw-Verkäufe insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent zurück.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54174315-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Immobilienfirma vor dem Kollaps: Zentralbank: Evergrande-Gefahr „beherrschbar“ – n-tv, 15.10.2021
Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande wird von Milliardenschulden erdrückt. Kredite können nicht mehr bedient werden, Baustellen liegen brach. Angesichts der Lage versucht Chinas Zentralbank zu beruhigen: Es bestehe keine Gefahr, dass andere Bereiche mit in den Abgrund gezogen werden.
Nach wochenlanger Aufregung um den völlig verschuldeten Immobilienentwickler Evergrande hat sich Chinas Zentralbank erstmals dazu geäußert. Das Risiko einer Ansteckung für die chinesische Wirtschaft sei „beherrschbar“, zitierten chinesische Medien Zentralbankvertreter Zou Lan. Evergrande sei „sehr schlecht geführt“ worden und habe „blind“ expandiert, kritisierte er.
Evergrande hat durch eine auf Pump finanzierte aggressive Expansion der vergangenen Jahre einen Schuldenberg von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro angehäuft. Das Unternehmen ist aktuell weder in der Lage, seine Fälligkeiten umfassend zu bedienen, noch fertige Wohnungen an die Käufer zu übergeben. Zou erklärte, die Behörden würden Evergrande „drängen, seine Bemühungen zu verstärken, Geschäftsteile zu verkaufen und die Übergabe von Baustellen zu beschleunigen“.
Erst heute wurde bekannt, dass der geplante milliardenschwere Verkauf der Hongkong-Zentrale von Evergrande vorerst geplatzt ist. Der dem Staat gehörende Immobilienentwickler Yuexiu Property zog sich aus den Gesprächen angesichts der schwierigen Finanzlage des Unternehmens zurück, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Verhandelt worden sei ein Kauf des Gebäudekomplexes für umgerechnet 1,7 Milliarden US-Dollar. Evergrande und Yuexiu ließen Anfragen nach einer Stellungnahme unbeantwortet.
Evergrande hält viele Firmenbeteiligungen
Die chinesische Regierung hatte sich bislang nicht zu den Schwierigkeiten des Immobilienentwicklers geäußert. Experten mutmaßten, Peking könne eine Zerschlagung anordnen. Evergrande hat Beteiligungen in der Tourismus-, Versicherungs- und Gesundheitsbranche und gründete 2019 den Elektroautohersteller Evergrande Auto, der Tesla Konkurrenz machen sollte.
Die Immobilienwirtschaft in China war lange Zeit Lokomotive des Wirtschaftswachstums. Millionen Wohnungen wurden in den vergangenen Jahren gebaut. Für Chinesen ist der Erwerb von Wohneigentum ein sehr wichtiger Schritt nach oben auf der sozialen Leiter. Zahlreiche Firmen verschuldeten sich hoch, um an dem Geschäft teilzuhaben. Die Regierung begann im Sommer 2020, die Entwicklung zu bremsen. Sie gab den Immobilienkonzernen die sogenannten „drei roten Linien“ vor.
Diese setzten den Firmen Grenzen für die Kreditaufnahme und zwangen sie, ihre Verbindlichkeiten zu reduzieren. Damit begannen die Schwierigkeiten für Evergrande. In den vergangenen Tagen hatten auch zwei weitere Immobilienentwickler ernste Probleme eingeräumt: Fantasia zahlte fällige Schulden nicht zurück, Sinic warnte vor dem Zahlungsausfall. Zentralbankvertreter Zou versicherte indes, der chinesische Immobiliensektor sei „generell gesund“. (ntv.de, jhe/AFP/rts)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Zentralbank-Evergrande-Gefahr-beherrschbar-article22868656.html
SIEHE DAZU:
=> Zahlungsausfall bei Fantasia: Chinas Immobilienbranche steckt in Teufelskreis – Fantasia sitzt auf einem Schuldenberg von umgerechnet 13 Milliarden US-Dollar. Bei Evergrande sind es sogar 300 Milliarden – n-tv, 5.10.2021
Im Vergleich zu dem Immobiliengiganten Evergrande, dessen Zusammenbruch die ganze chinesische Wirtschaft bedroht, ist die Fantasia Holding viel kleiner. Doch der jüngste Zahlungsausfall erschüttert das Vertrauen in die gesamte Branche. …
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Chinas-Immobilienbranche-steckt-in-Teufelskreis-article22847086.html
JAPAN
JAPAN (Pressespiegel / DJN, 15.10.2021) – Japans neuer Premierminister hat versprochen, das Land vom neoliberalen Fundamentalismus wegzubringen, während er das Versagen seiner eigenen Partei anprangerte, im Rahmen des Abenomics-Programms, das die Wirtschaft fast ein Jahrzehnt lang geprägt hat, ein breit angelegtes Wachstum zu erzielen. In seinem ersten Interview mit internationalen Medien seit der Übernahme der Führung Japans erklärte Fumio Kishida, dass eine Reform der Regulierung zwar weiterhin notwendig sei, er sich dabei aber darauf konzentrieren werde, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern. (Financial Times)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54208223-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
IRAN
Iran will Gespräche mit EU über Atomverhandlungen in Brüssel fortsetzen – Überblick am Morgen / DJN, 15.10.2021
Die iranische Regierung will nach eigenen Angaben „in den kommenden Tagen“ in Brüssel mit der EU über eine Wiederaufnahme der Wiener Atomverhandlungen sprechen. Das teilte das iranische Außenministerium am Donnerstag nach einem mehrstündigen Treffen von Vize-Außenminister Ali Bagheri mit dem für die Verhandlungen mit Teheran zuständigen EU-Unterhändler Enrique Mora mit.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54209386-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
RUSSLAND
Putin: Russland bereit zu höheren Gasexporten – Überblick am Abend / DJN, 13.10.2021
Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bereitschaft seines Landes zu höheren Gasexporten betont. „Wenn sie uns fragen, ob wir unsere Lieferungen erhöhen, sind wir bereit das zu tun“, sagte Putin am Mittwoch bei einer Energiemesse in Moskau. Russland sei bereit, seine Exporte so weit anzuheben, wie es seine Partner wünschten, fuhr er fort.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193431-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Russland strebt CO2-Neutralität bis zum Jahr 2060 an – Überblick am Abend / DJN, 13.10.2021
Russland strebt bis zum Jahr 2060 die sogenannte Kohlendioxid-Neutralität an. Seine Regierung habe als „konkretes Ziel“ festgelegt, die Neutralität bis „spätestens“ 2060 zu erreichen, sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch zur Eröffnung eines Energieforums in Moskau. Kohlendioxid-Neutralität bedeutet, dass ein Land nicht mehr Mengen dieses klimaschädlichen Gases ausstößt als durch Wälder und andere natürliche Speicher ausgeglichen werden kann.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193431-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Putin: Kämpfer aus Syrien und dem Irak kommen nach Afghanistan – Überblick am Morgen / DJN, 14.10.2021
Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor dem Einsickern von kampferprobten Extremisten nach Afghanistan gewarnt. „Kämpfer aus dem Irak und Syrien, die militärische Erfahrung mitbringen, werden aktiv dorthin gezogen“, sagte der Staatschef während einer Videokonferenz mit den Chefs der Sicherheitsdienste der ehemaligen Sowjet-Staaten am Mittwoch. „Es ist möglich, dass Terroristen versuchen, die Lage in den Nachbarstaaten zu destabilisieren“, fügte er hinzu.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54197902-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Putin nennt Diskussionen über seine Nachfolge „destabilisierend“ – Überblick am Abend / DJN, 14.10.2021
Der russische Präsident Wladimir Putin hat Diskussionen über seine Nachfolge als „destabilisierend“ für Russland bezeichnet. „Die Lage muss ruhig bleiben“, sagte Putin im Interview mit dem US-Sender CNBC, das in der Nacht zum Donnerstag ausgestrahlt wurde. Die staatlichen Organe und Strukturen müssten „ruhig in die Zukunft schauen“. Putin erinnerte daran, dass er sich 2024 laut den Bestimmungen der Verfassung zur Wiederwahl stellen könne, eine Entscheidung habe er aber noch nicht getroffen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54205036-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
TÜRKEI
Türkei erstmals seit zwei Jahren mit Leistungsbilanzüberschuss – Überblick am Mittag / DJN, 11.10.2021
Die Türkei hat im August erstmals seit fast zwei Jahren wieder einen Leistungsbilanzüberschuss verzeichnet. Nach Mitteilung der Zentralbank betrug der positive Saldo 528 Millionen US-Dollar. Zuletzt war im Oktober 2019 ein Überschuss angefallen. Im Juli hatte sich noch ein Defizit von 683 Millionen Dollar ergeben. Im Durchschnitt der zwölf Monate bis August betrug das Defizit 23,03 Milliarden Dollar.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54167325-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
GROSSBRITANNIEN
Britisches BIP steigt im August weniger stark als erwartet – Überblick am Morgen / DJN, 13.10.2021
Die Wirtschaftsleistung Großbritanniens hat im August etwas weniger stark als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten einen BIP-Zuwachs von 0,6 Prozent prognostiziert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54186271-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
London zeigt sich in Nordirland-Streit mit Brüssel unnachgiebig: britische Vorlage kommt Abschaffung bisheriger Regelungen gleich – Überblick am Mittag / DJN, 13.10.2021
Großbritannien hat sich im Streit mit der EU um das Nordirland-Protokoll unnachgiebig gezeigt. Kurz bevor die EU-Kommission in Brüssel am Mittwoch neue Kompromissvorschläge vorlegen wollte, drohte Brexit-Minister David Frost erneut mit einer einseitigen Aussetzung der vereinbarten Zollregelungen für die britische Provinz. Eigene Vorschläge für eine „Überarbeitung“ des Protokolls, die Frost am Dienstag vorlegte, kommen hingegen einer weitgehenden Abschaffung der bisherigen Regelungen gleich.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54189630-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
SCHWEIZ
Hypozinsen steigen auf höchsten Stand seit Anfang 2019 – Finanz & Wirtschaft, 13.10.2021
In der Schweiz macht sich der jüngste Renditeanstieg für Staatsanleihen bemerkbar. Immobilienkäufer müssen so viel Zinsen zahlen wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.
Die Hypothekarzinsen in der Schweiz steigen im Oktober noch stärker als im Vormonat. Fast alle ausser einer von dreizehn Anbietern, welche die FuW beobachtet, setzten in den vergangenen Wochen ihre Richtsätze für eine Laufzeit von zehn Jahren deutlich nach oben. Im Schnitt machte der Zinsanstieg 0,15 Prozentpunkte auf 1,29% aus: Durchweg alle liegen jetzt bei mehr als 1%.
Seit dem Tiefpunkt in diesem Jahr vom August bei 1,07% ist dies ein merklicher Anstieg. Es ist zudem der höchste Satz in diesem Jahr, zuletzt mussten Hauskäufer im Januar 2019 mehr für einen Immobilienkauf berappen. Auch bei fünfjährigen Laufzeiten hoben die Anbieter zuletzt die Richtsätze spürbar an.
Wachstumssorgen ebben ab
Die Entwicklung bei den Hypothekarzinsen spiegelt vor allem den rasanten Zinsanstieg am Markt für Staatsanleihen in Europa. So ist die Verzinsung von Schweizer «Eidgenossen» mit zehn Jahren Laufzeit von –0,41% Anfang August auf mittlerweile –0,05% gestiegen. Zuletzt waren die Renditen im Sommer 2018 höher. Der für die Refinanzierung am Immobilienmarkt relevante Swapsatz (zehn Jahre) ist seit Mitte September wieder positiv, aktuell liegt er bei 0,21%.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/hypozinsen-steigen-auf-hoechsten-stand-seit-anfang-2019/
EUROPÄISCHE UNION
Übertragungsnetzbetreiber: EEG-Umlage sinkt 2022 auf 3,723 Cent – Überblick am Mittag / DJN, 15.10.2021
Die Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien wird im kommenden Jahr deutlich sinken. Wie die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) miiteilen, soll die Umlage ab Januar auf 3,723 Cent je Kilowattstunde fallen. Ausschlaggebend für die Absenkung ist vor allem der hohe Börsenstrompreis.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54212783-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
EEG-UMLAGE (Pressespiegel / DJN, 14.10.2021) – Vor Bekanntgabe der geplanten EEG-Umlage für 2022 erwarten Experten wegen der Gegenfinanzierung mit CO2-Preiseinnahmen eine deutliche Absenkung. „Die EEG-Umlage wird 2022 auf ein Rekordtief von drei bis vier Cent je Kilowattstunde sinken“, schätzt der Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, Patrick Graichen. „Das kompensiert knapp die gestiegenen Börsenstrompreise, sodass die Stromkosten für Haushalte 2022 weitgehend stabil bleiben dürften.“ Die Umlage finanziert den Ausbau der Erneuerbaren Energien und gehört mit einem Preisanteil von 22 Prozent zu den größten Kostentreibern für Strom. Ermittelt wird sie von den Übertragungsnetzbetreibern Tennet TSO, 50Hertz, Amprion und TransnetBW. Die Prognose für 2022 wird am Freitag veröffentlicht. (Augsburger Allgemeine)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54196611-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Euroraum-Industrieproduktion sinkt im August um 1,6 Prozent – DJN, 13.10.2021
Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich im August wie erwartet deutlich verringert. Nach Mitteilung von Eurostat sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent, nachdem sie im Juli um revidiert 1,4 (vorläufig: 1,5) Prozent zugelegt hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von 1,7 Prozent prognostiziert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion um 5,1 (Juli: 8,0) Prozent. Erwartet worden war ein Zuwachs von 4,6 Prozent.
Die Produktion von Investitionsgütern sank gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent, die von Gebrauchsgütern um 3,4 Prozent, die von Vorleistungsgütern um 1,5 Prozent und die von Verbrauchsgütern um 0,8 Prozent. Dagegen nahm die Energieerzeugung um 0,5 Prozent zu.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54187757-euroraum-industrieproduktion-sinkt-im-august-um-1-6-prozent-015.htm
Autoabsatz in Europa bricht im September ein – Überblick am Morgen / DJN, 15.10.2021
Fehlende Bauteile haben den Autoherstellern den schwächsten September in Europa seit 1995 beschert. In der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurde nur noch 972.723 Fahrzeuge neu zu gelassen, ein Minus von 25,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Herstellerverband Acea mitteilte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54209386-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
EU schlägt in Streit um Nordirland-Protokoll gelockerte Warenkontrollen vor – Überblick am Morgen / DJN, 14.10.2021
Die EU hat im Post-Brexit-Streit mit Großbritannien eine Lockerung der Warenkontrollen an der Grenze zu Nordirland vorgeschlagen. Die Maßnahme solle für einen Großteil der für Nordirland bestimmten Waren gelten, erklärte die EU-Kommission am Mittwochabend. Die Kontrollen würden demnach um 80 Prozent reduziert und die Zollformalitäten um 50 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54197902-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
EU-Kommission legt Vorschläge gegen hohe Energiepreise vor – Überblick am Abend / 13.10.2021
Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten am Mittwoch zahlreiche Maßnahmen gegen die deutlich gestiegenen Energiepreise vorschlagen. Energiekommissarin Kadri Simson sagte in Brüssel, die Staaten könnten einkommensschwachen Haushalten etwa Gutscheine ausstellen oder gezielt Steuersätze senken. Auch für Unternehmen seien staatliche Hilfen und gezielte Steuersenkungen möglich. Dies könne finanziell aus den gestiegenen Einnahmen des europäischen Emissionshandels unterstützt werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193431-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
EU-Kommission fordert Mitgliedsstaaten wegen hohen Energiepreisen zu Steuersenkungen auf – Überblick am Abend, 11.10.2021
Angesichts der gestiegenen Energiepreise will die EU-Kommission die Mitgliedstaaten dazu ermuntern, Energiesteuern zu senken. Gewinne aus Preiserhöhungen sollten mit Hilfe unterschiedlicher Instrumente an die am stärksten Benachteiligten zurückgegeben werden, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Montag dem Sender France Inter. Es gebe „eine ganze Bandbreite von Instrumenten, an die wir die Mitgliedstaaten einzeln erinnern werden“.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54170418-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Europaparlament: Ja zu EuGH-Klage gegen Kommission – ORF, 14.10.2021
Der Rechtsausschuss im Europaparlament hat sich dafür ausgesprochen, vor dem Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen die EU-Kommission zu klagen. Grund dafür ist, dass die Brüsseler Behörde eine neue Regelung zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen in EU-Staaten bisher nicht angewendet hat. 13 Abgeordnete stimmten am Donnerstag für die Untätigkeitsklage, drei dagegen und sechs enthielten sich, wie die dpa aus Parlamentskreisen erfuhr.
Der EU-Rechtsstaatsmechanismus ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Er sieht vor, dass EU-Ländern Mittel aus dem gemeinsamen Haushalt gekürzt werden können, wenn wegen Rechtsstaatsverstößen ein Missbrauch des Geldes droht. Die Regierungen in Ungarn und Polen befürchten, dass das neue Verfahren vor allem gegen sie eingesetzt werden soll. Sie haben deshalb Klage gegen die Verordnung beim EuGH eingereicht – das Verfahren läuft noch. Die EU-Kommission wollte eigentlich erst tätig werden, wenn der EuGH über die Klagen von Ungarn und Polen entschieden hat.
„Während die Kommission hadert, drückt das Parlament auf die Tube“, sagte der zuständige Berichterstatter im Ausschuss, Sergey Lagodinsky (Grüne), der dpa. „Die Einschränkung von Grundrechten und Unabhängigkeit der Justiz durch Regierungen in Ungarn oder Polen sind eine ernste Gefahr für die Bürger dieser Länder, aber auch für die Aufsicht über EU-Gelder, die diesen Regierungen zuteilwerden.“ Genau dafür sei der Rechtsstaatsmechanismus geschaffen worden.
Nun ist Parlamentspräsident David Sassoli am Zug. Er müsste die Klage beim höchsten EU-Gericht in Luxemburg einreichen. Zuvor könnte er kommende Woche noch einmal das Parlamentsplenum darüber abstimmen lassen. Das Parlament hat bis zum 2. November Zeit, die Klage gegen die EU-Kommission beim EuGH anzustrengen. Bereits im Juni hatte es beschlossen, das Verfahren für die Untätigkeitsklage zu beginnen und so Druck auf die EU-Kommission auszuüben.
Die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen betonte stets, die Vorbereitungen für Verfahren nach dem Mechanismus liefen und kein Fall werde verloren gehen. Zuletzt schien jedoch nicht mehr ausgeschlossen, dass sie schon vor einem EuGH-Urteil Verfahren einleiten könnte.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232777/
POLEN
POLEN (Pressepiegel / DJN, 14.10.2021) – Der frühere polnische Außenminister Witold Waszczykowski warnt vor einer weiteren Eskalation im Streit seines Landes mit der Europäischen Union. Falls die EU-Kommission Gelder aus dem neu geschaffenen Wiederaufbaufonds zurückhalte, könnte die polnische Regierung ihrerseits Zahlungen an die EU einstellen. „Ich schlage vor, dass wir dann die gleiche Summe von unseren jährlichen EU-Beiträgen abziehen“, sagt Waszczykowski der Wochenzeitung Die Zeit. „Es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, dass die Kommission das Geld aus dem Fonds zurückhält.“ Polen sollte ursprünglich 36 Milliarden Euro aus dem Fonds bekommen, die Auszahlung ist aber an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. (Die Zeit)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54196611-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Polens Regierungschef will nach umstrittenem Urteil vor EU-Parlament sprechen – Überblick am Morgen / DJN, 14.10.2021
Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wird sich kommenden Dienstag vor dem EU-Parlament zu dem Rechtsstreit zwischen Warschau und Brüssel äußern. Wie ein Sprecher von Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch mitteilte, werde der Regierungschef an der Sitzung um 09.00 Uhr teilnehmen. Morawiecki wolle „Polens Position“ erläutern, teilte ein Sprecher der Regierung in Warschau beim Onlinedienst Twitter mit.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54197902-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
ITALIEN
Italien: Inflation zieht weiter an – dpa-AFX, 15.10.2021
ROM (dpa-AFX) – In Italien hat die Inflation im September weiter angezogen, allerdings nicht so stark wie zunächst gedacht. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,9 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Eine erste Schätzung wurde leicht um 0,1 Punkte nach unten korrigiert. Im Vormonat hatte die Rate 2,5 Prozent betragen.
Der höhere Preisauftrieb stand laut Istat auf breiter Basis. Teurer war nicht nur Energie. Auch für Lebensmittel und Alkohol, langlebige Güter sowie Dienstleistungen musste mehr bezahlt werden
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54210264-italien-inflation-zieht-weiter-an-016.htm
Italiens Industrieproduktion sinkt im August – Überblick am Mittag / DJN, 11.10.2021
Italiens Industrieproduktion ist im August gefallen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück, nachdem sie im Juli um 1,0 Prozent gestiegen war. Auf Jahressicht war der Output unverändert. Zugleich lag er um 1,5 Prozent höher als im Februar 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie. Eurostat veröffentlicht am Mittwoch Produktionsdaten für den Euroraum.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54167325-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
FRANKREICH
Frankreich: Inflation zieht weiter an – dpa-AFX, 15.10.2021
Die Inflation in Frankreich hat im September weiter angezogen. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) um 2,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Eine vorläufige Schätzung wurde bestätigt. Im August hatte die Rate 2,4 Prozent betragen.
Ausschlaggebend für die Entwicklung waren stärker steigende Preise für Dienstleistungen und Energie. Dagegen schwächte sich der Preisauftrieb von industriell gefertigten Gütern sowie von Lebens- und Genussmitteln etwas ab.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54209282-frankreich-inflation-zieht-weiter-an-016.htm
Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister fordert Ausbau der Atomkraft in Europa – DJN, 10.10.2021
In einem offenen Brief hat der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire gemeinsam mit weiteren europäischen Ministern gefordert, im Kampf gegen den Klimawandel auch auf Atomenergie zurückzugreifen. „Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wollen, brauchen wir Kernenergie. Sie ist für uns alle ein unverzichtbarer und verlässlicher Faktor für eine kohlenstofffreie Zukunft“, heißt es in dem Brief, der Welt und den Partnerzeitungen der Leading European Newspaper Alliance (Lena) vorliegt. „Kurz gesagt“, so Le Maire: „Kernenergie ist eine saubere, sichere, unabhängige und wettbewerbsfähige kohlenstoffarme Energiequelle.“
In dem Brief, den unter anderem auch der polnische Umweltminister Michal Kurtyka und der finnische Wirtschaftsminister Mika Tapani Lintilä unterschrieben haben, heißt es weiter: „Für uns Europäer bedeutet die Kernenergie eine Chance, eine starke, ausgesprochen rentable Industrie zu entwickeln, Tausende von qualifizierten Arbeitsplätzen zu schaffen, unsere Führungsrolle in Sachen Klimaschutz zu stärken und Europas strategische Autonomie und Energie-Unabhängigkeit zu sichern.“ Die Unterzeichner fordern: „Wir sollten diese so entscheidende Chance nicht ungenutzt lassen.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54161078-frankreichs-wirtschafts-und-finanzminister-fordert-ausbau-der-atomkraft-in-europa-015.htm
Paris droht im Fischereistreit mit London mit „Vergeltungsmaßnahmen“ – Überblick am Mittag / DJN, 14.10.2021
Frankreich hat im Fischereistreit mit Großbritannien mit „Vergeltungsmaßnahmen“ gedroht. Die Regierung werde innerhalb einer Woche reagieren, falls es bis dahin keine „Signale“ aus Großbritannien für zusätzliche Fischerei-Lizenzen für französische Fischer gebe, sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune am Mittwochabend im französischen Senat. Er kündigte ein mit den „europäischen Partnern“ abgestimmtes Vorgehen an.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54201343-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
DEUTSCHLAND
KREDITKOSTEN (Pressespiegel / DJN, 14.10.2021) – Verbraucher können nach Angaben des Vergleichsportals Verivox derzeit Kredite deutlich unter der Inflationsrate aufnehmen. „Dass eine Mehrheit ihren Ratenkredit zu Zinsen unterhalb der laufenden Teuerung abschließen kann, ist eine historische Ausnahmeerscheinung“, sagte Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, den Zeitungen der Mediengruppe. Laut Verivox schließt die Hälfte der Verbraucher derzeit ihre Kredite im Mittel für 2,99 Prozent und weniger ab. Der Realzins bei Kreditabschluss liege damit mit 1,07 Prozent unter der Inflationsrate im September von 4,1 Prozent. (Funke Mediengruppe)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54196611-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche HVPI-Teuerung steigt im September wie erwartet auf 4,1% – DJN, 13.10.2021
Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im September wie erwartet verstärkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 4,1 (August: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Destatis bestätigte damit wie von Volkswirten erwartet das Ergebnis der ersten Veröffentlichung. Gleiches galt für den nationalen Verbraucherpreisindex, der auf Monatssicht stagnierte und im Jahresabstand um 4,1 (3,9) Prozent stieg. Ohne die volatilen Preise von Energie und Nahrungsmitteln betrug die Teuerung hier 2,9 Prozent.
Die hohe Inflationsrate hat laut Destatis verschiedene Gründe, darunter Basiseffekte durch niedrige Preise im Jahr 2020. „Insbesondere die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im zweiten Halbjahr 2020 und der Preisverfall der Mineralölprodukte im Vorjahr wirken sich erhöhend auf die Gesamtteuerung aus“, schreiben die Statistiker. Zusätzlich wirkten krisenbedingte Effekte, wie die deutlichen Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen, die sich bisher nur teilweise oder abgeschwächt im Verbraucherpreisindex niedergeschlagen hätten.
Nicht nur die Preise von Energieprodukten, sondern auch die von Nahrungsmitteln erhöhten gegenüber dem Vorjahresmonat überdurchschnittlich mit, nämlich um 4,9 Prozent. Spürbar teurer wurden Gemüse (plus 9,2 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Eier (plus 5,5 Prozent). Darüber hinaus verteuerten sich neben den Verbrauchsgütern auch Gebrauchsgüter wie Fahrzeuge (plus 6,4 Prozent) oder Möbel und Leuchten (plus 4,4 Prozent).
Die Preise von Dienstleistungen insgesamt lagen im September um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die aufgrund des großen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushalte bedeutsamen Nettokaltmieten verteuerten sich um 1,4 Prozent. Deutlicher erhöhten sich unter anderem die Preise der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (plus 5,4 Prozent), Leistungen sozialer Einrichtungen (plus 5,0 Prozent) sowie für Gaststättendienstleistungen (plus 3,6 Prozent).
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54185794-deutsche-hvpi-teuerung-steigt-im-september-wie-erwartet-auf-4-1-015.htm
Deutschland: Energiepreise steigen stark – Inflationsrate über 4 Prozent – dpa-AFX, 13.10.2021
Gestiegene Energiepreise heizen die Inflation in Deutschland weiter an. Erstmals seit knapp 28 Jahren überschritt die Jahresteuerungsrate im September die Vier-Prozent-Marke. Die Verbraucherpreise kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit vorläufige Daten. Eine Vier vor dem Komma wurde zuletzt im Dezember 1993 mit 4,3 Prozent ermittelt. Gegenüber dem August blieben die Verbraucherpreise im September unverändert.
Vor allem für Energie mussten Verbraucher im September deutlich tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor (plus 14,3 Prozent). Heizöl verteuerte sich innerhalb eines Jahres um 76,5 Prozent. Sprit kostete 28,4 Prozent mehr. Auch die Preise für Erdgas (plus 5,7 Prozent) und Strom (plus 2,0 Prozent) zogen an. Die Teuerung wird seit geraumer Zeit von gestiegenen Energiepreisen angeheizt. Die weltweite Nachfrage ist angesichts der Konjunkturerholung nach dem Einbruch in der Corona-Krise groß.
Wesentlich für den Anstieg der Energiepreise „waren Basiseffekte, da wir die aktuellen Preise mit den sehr niedrigen Preisen des Vorjahres vergleichen. Auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe wirkt insbesondere erhöhend auf die Teuerungsrate der Energieprodukte“, erläuterten die Statistiker. In Deutschland sind seit Januar 25 Euro je Tonne Kohlendioxid fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im September ebenfalls überdurchschnittlich um 4,9 Prozent.
Inzwischen schlägt auch die Rücknahme der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung des zweiten Halbjahres 2020 voll durch. Seit Januar gelten wieder die normalen Mehrwertsteuersätze. Waren und Dienstleistungen werden also tendenziell teurer. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54185741-deutschland-energiepreise-steigen-stark-inflationsrate-ueber-4-prozent-016.htm
Andrea Thopmas (WSJ): HWWI: Starke Preisanstiege bei Rohöl, Kohle und Erdgas – Preise für Rohöl schießen in die Höhe – Industrierohstoffe billiger – DJN, 12.10.2021
Öl, Kohle und Erdgas haben sich auf den Rohstoffmärkten im September stark verteuert. Der Rohstoffpreisindex des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) kletterte im September um durchschnittlich 8,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und übertraf damit seinen entsprechenden Vorjahreswert um 91,5 Prozent.
„Hintergrund der Preissteigerungen ist, dass der gestiegenen Nachfrage nach Energierohstoffen im Zuge der Erholung der Weltwirtschaft derzeit eine Verknappung des Angebots gegenübersteht“, erklärte das HWWI.
Die stärksten Preissteigerungen seien auf den Märkten für europäisches Erdgas zu verzeichnen, was die leeren Erdgasspeicher in Europa widerspiegelten.
Entspannung an der Preisfront zeigte sich im September hingegen bei den beiden anderen Teilindizes für Industrierohstoffe sowie für Nahrungs- und Genussmittel. Hier fielen im September die Preise im Durchschnitt.
*** Preise für Rohöl schießen in die Höhe ***
Beim Teilindex für Energierohstoffe war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Hier erhöhten sich die Preise im September um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Der deutliche Aufwärtstrend der Ölpreise machte sich bemerkbar. Im Vergleich zum September 2020 stiegen die Rohölpreise durchschnittlich sogar um mehr als 77 Prozent. Die Preise für Kohle und Erdgas setzten im September ihren starken Aufwärtstrend ebenfalls fort. „Ein wichtiger Preistreiber ist die erhöhte Stromnachfrage aus China, ausgelöst durch die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie und einer Hitzeperiode, die für einen starken Anstieg der Nachfrage nach Strom für Klimaanlagen sorgte“, erklärte das Institut.
Die Preise für europäisches Erdgas erreichten im September historische Höchstwerte und waren mehr als viermal so hoch wie noch im September des Vorjahres. Als Grund nannte das HWWI, dass die Erdgasspeicher in Europa infolge des langen, kalten Winters 20/21 bereits stark entleert waren und aufgrund der gestiegenen Nachfrage nicht vollständig wieder aufgefüllt werden konnten. Zusätzlich sei das Angebot an Erdgas in Europa zurückgegangen.
*** Industrierohstoffe billiger ***
Anders sah es bei den Industrierohstoffen aus. Der Teilindex, der sich in den Index für Agrarrohstoffe, den Index für Nichteisenmetalle und den Index für Eisenerz und Stahlschrott untergliedert, sank im September gegenüber dem Vormonat um 7,6 Prozent. Die Preise für Eisenerz und Stahlschrott fielen im September weiter. Hier machte sich laut HWWI bemerkbar, dass China als der größte Eisenerzverbraucher der Welt seine Eisenerzimporte einschränkte, da die chinesische Stahlproduktion aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen stark zurückgefahren wurde.
Der Index für Nahrungs- und Genussmittel sank im September im Vergleich zum Vormonat lediglich leicht um durchschnittlich 0,7 Prozent und lag damit um 32,5 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert.
Während die Preise für Getreide und Pflanzenöle leicht zurückgingen, seien die Preise für Genussmittel im September leicht gestiegen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54177550-hwwi-starke-preisanstiege-bei-rohoel-kohle-und-erdgas-015.htm
Bundesregierung sieht keine Engpässe bei Gasversorgung – Überblick am Abend / DJN, 13.10.2021
Die Bundesregierung macht sich aktuell keine Sorgen über mögliche Engpässe bei Deutschlands Gasversorgung. Die deutschen Gasspeicher seien mit aktuell 75 Prozent zwar geringer gefüllt als in den Vorjahren, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Aber die Füllstände stiegen weiter und ähnliche Werte im Jahr 2015 hätten zu keinen Engpässen im darauffolgenden Winter geführt. Deutschland habe absolut gesehen deutlich mehr Gas vorrätig als etwa Großbritannien.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193431-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Mieterbund und Verbraucherschützer warnen vor „Nebenkostenexplosion“ – Überblick am Morgen / DJN, 14.10.2021
Der Deutsche Mieterbund und Verbraucherschützer haben angesichts der hohen Energiepreise Entlastungen für einkommensschwache Haushalte gefordert. „Ohne ein Gegensteuern der neuen Regierung droht eine Nebenkostenexplosion“, sagte Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Mieterbundes, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband erarbeitete der Mieterbund ein Positionspapier, das die beiden Verbände am Donnerstag vorlegen wollten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54197902-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Deutsche Großhandelspreise mit stärkstem Anstieg seit 1974 – DJN/dpa-AFX, 12.10.2021
Die Preise im deutschen Großhandel sind im September so stark wie zuletzt 1974 gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis), erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 13,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Während der ersten Ölkrise 1974 war eine Jahresrate von 13,3 Prozent ermittelt worden.
Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate der Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat hatten die Preisanstiege im Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (plus 62,8 Prozent) sowie mit Mineralölerzeugnissen (plus 42,3 Prozent).
Besonders kräftige Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr gab es auch im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (plus 84,6 Prozent) sowie mit Roh- und Schnittholz (plus 54,6 Prozent). Erheblich teurer wurden auch Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (plus 23,9 Prozent). Niedriger als im September 2020 waren dagegen die Preise im Großhandel mit lebenden Tieren (minus 7,1 Prozent).
Das war der stärkste Großhandelspreisanstieg Anstieg seit der ersten Ölkrise im Jahr 1974. Im August 2021 hatte der Anstieg 12,3 Prozent und im Juli 11,3 Prozent betragen. Schon dies waren ungewöhnlich hohe Preisanstiege.
Der hohe Anstieg sei zum einen durch stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte begründet, erklärten die Statistiker. Zum anderen wirke ein sogenannter Basiseffekt: Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sei das Preisniveau in den Vorjahresmonaten sehr niedrig gewesen, was die aktuellen Teuerungsraten rechnerisch nach oben treibt.
Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsebenen in Deutschland, auf denen sich das allgemeine Preisniveau bildet. Hinzu kommen die Preise für nach Deutschland eingeführte Güter und die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, die Erzeugerpreise. Sie alle wirken auf die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. In Deutschland waren die Verbraucherpreise zuletzt mit 4,1 Prozent so stark gestiegen wie seit Ende 1993 nicht mehr.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173739-deutsche-grosshandelspreise-mit-staerkstem-anstieg-seit-1974-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54174431-deutschland-grosshandelspreise-steigen-so-stark-wie-seit-1974-nicht-016.htm
INFLATION (Pressespiegel / DJN, 12.10.2021) – Angesichts immer höherer Energiepreise rechnet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer mit einem weiteren Anstieg der allgemeinen Inflation in den nächsten Monaten. „Verteuert sich die Energie weiter, könnte die Inflation im November auf fünf Prozent steigen“, sagte er Etwas Entspannung sieht Krämer erst im nächsten Jahr. „Die Inflation zieht weiter an, bevor sie nach der Jahreswende wieder fällt“, schätzt Krämer . Grund sei unter anderem, dass dann „Sonderfaktoren wie die zwischenzeitliche Senkung der Mehrwertsteuer wegfallen“. (Bild)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173318-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
ROHSTOFFKOSTEN (Pressespiegel / DJN, 12.10.2021) – Preissteigerungen bei wichtigen Rohmaterialien und Vorprodukten werden sich bis weit in das Jahr 2022 hinein fortsetzen. Darauf stellen sich zumindest zahlreiche deutsche Industrieunternehmen ein. Eine Umfrage der Einkaufsberatung Inverto unter rund 100 Managern und Einkaufsverantwortlichen ergab, dass drei Viertel der Befragten in den kommenden 18 Monaten mit moderaten oder starken Preissteigerungen bei Vorprodukten rechnen. Als besonders kritisch sehen die Unternehmen der Studie zufolge die Versorgung mit Kunststoffen, gefolgt von Aluminium sowie Stahl und anderen Eisenmetallen. Auch Zellulose und Kupfer haben für die befragten Firmen eine hohe Bedeutung. (Handelsblatt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173318-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
AUTOZULIEFERER (Pressespiegel / DJN, 14.10.2021) – Die Chipkrise in der Autoindustrie zieht die ganze Zuliefererindustrie in Mitleidenschaft. Bis zu elf Millionen Fahrzeuge, die sonst vom Band laufen würden, werden nicht hergestellt, schätzt die Boston Consulting Group. Umsatz von fast 180 Milliarden Euro falle damit aus. Die Branche, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, stehe unter einem nie da gewesenen Druck. Gefährdet sind vor allem mittelständische Autozulieferer mit weniger als einer Milliarde Euro Umsatz. Zwei kleinere Betriebe, die Bolta-Werke sowie Heinze aus Westfalen, sind bereits insolvent. (Handelsblatt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54196611-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
BAUSTOFFE (Pressespiegel / DJN, 12.10.2021) – Hausbauer müssen sich noch länger auf eine angespannte Lage bei der Verfügbarkeit von Baustoffen einstellen. „Baumaterialien wie Isolation sind in Europa und Nordamerika ausverkauft“, sagte Holcim-Chef Jan Jenisch. Auch bei Zement, dem Grundstoff für Beton, sei die Versorgungslage angespannt. „In den USA sind wir momentan ebenfalls ausverkauft.“ Jenisch versichert: „Wir tun alles dafür, dass wir mehr produzieren können. Aber der Bedarf ist sehr hoch.“ Bis an den Baustoffmärkten wieder so etwas wie Normalität einkehre, könne es noch bis mindestens Anfang nächsten Jahres dauern. (Handelsblatt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173318-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Ifo: Einzelhandel klagt über Lieferprobleme – DJN, 12.10.2021
Im Einzelhandel kann nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts gegenwärtig nicht jede Bestellung erfüllt werden. 74 Prozent der Einzelhändler klagten im September über entsprechende Probleme, wie aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. „Die Beschaffungsprobleme aus der Industrie sind nun auch hier angekommen“, sagte der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Manches Weihnachtsgeschenk wird vielleicht nicht lieferbar sein oder teuer werden.“
Im Fahrradeinzelhandel berichteten 100 Prozent aller befragten Unternehmen von Problemen bei ihren Bestellungen. „Gegenwärtig ist Sand im Getriebe der weltweiten Logistik. Zudem sind Frachtraten in der Schifffahrt deutlich erhöht worden“, sagte Wohlrabe. Bei den Baumärkten (99 Prozent) und Möbelhäusern zeigen sich die Nachwirkungen der Holzpreisrally im ersten Halbjahr.
Die Knappheit bei Chips und Halbleitern führt bei Händlern mit elektronischen Produkten aller Art dazu, dass nicht jedes Produkt sofort verfügbar ist. Das melden 97 Prozent der Einzelhändler von Unterhaltungselektronik. Im Kfz-Handel (88 Prozent) zeigen sich die Lieferprobleme insbesondere bei Elektroautos. Als Konsequenz nehmen jetzt auch die Einzelhändler Preiserhöhungen ins Visier. „Die Industrie hat Preiserhöhungen angekündigt und diese kommt jetzt zwangsläufig im Einzelhandel an“, sagte Wohlrabe.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173353-ifo-einzelhandel-klagt-ueber-lieferprobleme-015.htm
Hans Bentzien: MAKRO TALK/VP Bank: Deutsche Industrie hat bessere Zeiten vor sich – DJN, 12.10.2021
Die deutsche Industrie hat nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, in der Nach-Corona-Phase trotz sinkender Stimmungsindikatoren die besten Zeiten noch vor sich. „Kommt der Materialfluss wieder in Gang, wird es zu einer stark anziehenden Industriekonjunktur kommen“, schreibt Gitzel in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen im Oktober. Einerseits würden die Unternehmen die liegengebliebenen Aufträge abarbeiten, andererseits müssten die leergefegten Lager wieder befüllt werden. „Beides spricht für hohe Wachstumsraten der Industrieproduktion – es ist noch nicht aller Tage Abend“, meint Gitzel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54176321-makro-talk-vp-bank-deutsche-industrie-hat-bessere-zeiten-vor-sich-015.htm
Hans-Joachim Koch: Institute erwarten für 2021 geringeres und für 2022 höheres Wachstum – Straffung der Geldpolitik könnte notwendig werden – Gebremste Erholung im Winterhalbjahr – Haushaltsdefizit verringert sich bis 2023 spürbar – Weltproduktion wächst langsamer, lebhafter Warenhandel – Arbeitslosenquote sinkt schrittweise und kontinuierlich – DJN, 14.10.2021
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wachstum Deutschlands im laufenden Jahr aufgrund der Lieferengpässe in der Wirtschaft und der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie gesenkt, die für das nächste Jahr aber angehoben. Dann dürfte die deutsche Wirtschaft wieder Normalauslastung erreichen. Wie aus ihrem Herbstgutachten hervorgeht, erwarten sie einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um nur noch 2,4 (Frühjahrsgutachten: 3,7) Prozent in diesem Jahr und 4,8 (3,9) Prozent 2022. Für 2023 sehen sie ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent.
Die Ökonomen erwarten zudem eine höhere Inflation. Sie dürfte 2021 aufgrund der Energiepreisentwicklung auf 3,0 Prozent steigen, was deutlich über der im Frühjahr projizierten Rate von 2,4 Prozent liegt. Für 2022 erwarten die Institute einen Rückgang auf 2,5 (bisherige Prognose: 1,7) Prozent und im darauffolgenden Jahr auf 1,7 Prozent.
*** Straffung der Geldpolitik könnte notwendig werden ***
Mit Blick auf den Einfluss der Zentralbanken heißt es in dem Gutachten, dass die inflationären Tendenzen schon im Prognosezeitraum so stark zunehmen könnten, dass „eine Straffung der Geldpolitik notwendig wird“. Über die Preise für Rohstoffe als eine spezielle Form der Vermögensanlage „pflanzt sich die Vermögenspreisinflation schon jetzt auf Produktionskosten und Verbraucherpreise fort“.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr zwar deutlich gestiegen. Allerdings behinderten im Verarbeitenden Gewerbe Lieferengpässe bei Vorprodukten die Produktion, sodass nur die konsumnahen Dienstleistungsbranchen zulegten, so die Wirtschaftsforscher.
*** Gebremste Erholung im Winterhalbjahr ***
Das dürfte die Erholung im Winterhalbjahr 2021/2022 weiter bremsen. In der kalten Jahreszeit werde die Aktivität im Dienstleistungsbereich auch bei geringem Infektionsgeschehen unter dem üblichen Niveau bleiben. Für 2022 setzen die Institute auf eine allmähliche Überwindung der Beeinträchtigungen durch Pandemie und Lieferengpässe, sodass die Normalauslastung wieder erreicht werde.
Aktuell sei weltweit der Mangel an Halbleitern ein „beschränkender Faktor, besonders in der Automobilindustrie“. Das dürfte nach Meinung der Institute noch längere Zeit bedeutsam bleiben, da die Chiphersteller ihre Produktion nur langsam an die höhere Nachfrage anpassen könnten. Rascher auflösen könnten sich dagegen andere Engpässe, etwa bei Baumaterialien oder Chemiegrundstoffen.
*** Haushaltsdefizit verringert sich bis 2023 spürbar ***
Beim Blick auf die Finanzlage des Staates sehen die Konjunkturforscher eine relative Entlastung. Das Defizit der öffentlichen Haushalte dürfte von 4,9 Prozent des BIP in diesem Jahr auf 2,1 Prozent im Folgejahr zurückgehen und 2023 nur noch 0,9 Prozent betragen. Angesichts der kräftigen Zunahme des nominalen BIP werde die öffentliche Schuldenstandsquote voraussichtlich von 71 Prozent 2021 auf 67 bzw 65 Prozent für 2022/2023 sinken.
Mit dem Abflauen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden allerdings andere Belastungsfaktoren spürbar werden. „Die Herausforderungen des Klimawandels und das demografisch bedingt absehbar niedrigere Wirtschaftswachstum führen zu geringeren Konsummöglichkeiten“, sagt Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
*** Weltproduktion wächst langsamer, lebhafter Warenhandel ***
Auch weltweit dürften die Lieferengpässe spürbare Auswirkungen zeigen. Die Institute haben ihre Schätzung für den Zuwachs der Weltproduktion in diesem Jahr auf 5,7 von 6,3 Prozent gesenkt und für 2022 nur um 0,1 Punkt auf 4,2 Prozent hochrevidiert. Der weltweite Warenhandel dürfte – trotz der nur schwachen Zunahme im Verlauf – um 10,9 Prozent, im kommenden Jahr aber nur noch um 3,1 Prozent wachsen.
*** Arbeitslosenquote sinkt schrittweise und kontinuierlich ***
Die Tendenz am Arbeitsmarkt werten die Forscher positiv. Nach dem Rückgang der Erwerbstätigkeit als Folge des Konjunktureinbruchs 2020 steigt sie inzwischen. Das sollte sich fortsetzen, sodass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,7 von 5,9 Prozent im Vorjahr zurückgehen dürfte. Für 2022 und 2023 werden weitere Rückgänge auf 5,3 bzw 5,1 Prozent erwartet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54198647-institute-erwarten-fuer-2021-geringeres-und-fuer-2022-hoeheres-wachstum-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): Institute senken deutsche Wachstumsprognose für 2021 – Kreise – DJN, 13.10.2021
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für Deutschlands Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr aufgrund der Lieferengpässe in der Wirtschaft gesenkt. Wie eine mit dem Herbstgutachten der Institute vertraute Person Dow Jones Newswires sagte, erwarten die Institute für das laufende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um nur noch 2,4 Prozent. Bisher waren es 3,7 Prozent gewesen. Im kommenden Jahr sollte die Wirtschaft dann aber mit 4,8 (bisher: 3,9) Prozent stärker anziehen.
Die Ökonomen erwarten zudem, dass die Inflation in diesem Jahr aufgrund der hohen Energiepreise stärker steigen wird als noch im April erwartet. Die Inflation könnte 2021 auf 3,0 Prozent steigen, was deutlich über der im Frühjahr projizierten Rate von 2,4 Prozent läge. Für 2022 erwarten die Institute einen Rückgang der Rate auf 2,5 (1,7) Prozent. Bei den Erwartungen zur Inflation könnte es allerdings noch Änderungen geben, so die mit den Daten vertraute Person.
Das Herbstgutachten wird offiziell am Donnerstag veröffentlicht.
Die Institute stellen ihre neue Gemeinschaftsprognose am Donnerstag vor.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54191043-institute-senken-deutsche-wachstumsprognose-fuer-2021-kreise-015.htm
Hans Bentzien u.a.: ZEW-Konjunkturerwartungen sinken bereits zum fünften Mal – deutlich schlechtere Lagebeurteilung – DJN/dpa-AFX, 12.10.2021
Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland sind im Oktober etwas stärker als erwartet gesunken, wobei vor allem ein starker Rückgang der Lagebeurteilung negativ überraschte. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen ging auf 22,3 (September: 26,5) Punkte zurück, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Es war der fünfte Rückgang in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 24,0 Punkten prognostiziert.
„Der konjunkturelle Ausblick für die deutsche Wirtschaft hat sich spürbar eingetrübt. Der erneute Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen geht hauptsächlich auf die weiterhin bestehenden Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten zurück. Die Finanzmarktexpertinnen und -experten erwarten vor allem bei den exportorientierten Branchen wie zum Beispiel Fahrzeugbau und Chemie/Pharma eine Verschlechterung der Ertragslage“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten.
Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage in Deutschland sank auf 21,6 (31,9) Punkte. Es war der erste Rückgang nach sieben Anstiegen in Folge. Volkswirte hatten hier einen Rückgang auf nur 28,0 Punkte erwartet.
Die Konjunkturerwartungen für den Euroraum sanken auf 21,0 (31,1) Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage verringerte sich auf 15,9 (22,5) Zähler. Die Inflationserwartungen für den Euroraum sanken auf 17,1 (20,1) Punkte. Die Expertinnen und Experten rechnen laut ZEW aber damit, dass die Inflation in den nächsten sechs Monaten zurückgehen wird.
Noch im Mai hatte der Indikator den höchsten Stand seit gut zwei Dekaden erreicht. Seither ist der Indikator fünf Mal in Folge gesunken. „Der konjunkturelle Ausblick für die deutsche Wirtschaft hat sich spürbar eingetrübt“, erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. Der erneute Rückgang der Konjunkturerwartungen gehe hauptsächlich auf bestehende Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten zurück.
Die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage trübte sich erstmals seit Februar ein. Der Indikator fiel um 10,3 Punkte auf 21,6 Zähler. Für die Eurozone trübten sich Erwartungen und Lagebewertung ebenfalls ein.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54176070-zew-konjunkturerwartungen-sinken-deutlich-schlechtere-lagebeurteilung-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54175757-deutschland-zew-konjunkturerwartungen-sinken-fuenftes-mal-in-folge-016.htm
Autoproduktion: 40 Regionen laut IW besonders vom Aus für Verbrenner betroffen – Politik soll Standortfaktoren verbessern und Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen fördern – 53% der in der Automobilwirtschaft Beschäftigten betroffen – Ökonomen sind zuversichtlich: Wandel in Richtung Nachhaltigkeit ist möglich – Unternehmen investieren bereits jetzt viel in Weiterbildung – Unternehmenskooperation angemahnt – DJN, 13.10.2021
Jede zehnte deutsche Region ist besonders abhängig vom traditionellen Verbrennungsmotor und muss sich schnell wandeln. Nur so könnten diese Regionen in der geplanten Transformation Deutschlands zum klimaneutralen Industrieland bestehen, lautet das Fazit einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für das Bundeswirtschaftsministerium. Demnach stehen 40 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten wegen des geplanten Aus für Verbrenner vor großen Herausforderungen.
Das IW appellierte daher an die Politik, in den betroffenen Kreisen und Städten die Standortfaktoren zu verbessern und den Beschäftigten mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen unter die Arme zu greifen. Auch sollten neue Chancenfelder aktiv erschlossen sowie innerhalb der Regionen gemeinsame Projekte initiiert werden.
„Damit die deutsche Automobilwirtschaft nicht den Anschluss verliert, müssen die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt werden“, forderte das IW.
Die besonders betroffenen Regionen konzentrierten sich größtenteils auf den konventionellen Antriebsstrang einschließlich aller daran hängenden Komponenten wie zum Beispiel der Abgasreinigung. Von den rund 260.000 Beschäftigten, die deutschlandweit in diesen Tätigkeitsfeldern identifiziert werden konnten, arbeiten allein in diesen 40 Regionen etwa 139.500 Beschäftigte, so der Bericht. Das entspricht laut IW 53 Prozent.
„Bis heute ist der Verbrenner für diese Regionen vor allem ein Motor für Wachstum und Wohlstand, gemessen an Produktivität und der Arbeitslosenquote schneiden die 40 Kreise besser ab als der Durchschnitt“, erklärte IW.
Als Beispiele für die schwierigen Anpassungsprozesse nannte das Institut die Regionen Schweinfurt, Salzgitter, Bamberg und den Saarpfalz-Kreis, wo mehr als jeder zehnte Beschäftigte in dem Segment arbeitet. In Ingolstadt, Wolfsburg und im Bodenseekreis dürfte die Transformation laut IW leichter fallen. Denn diese drei Kreise beschäftigten sich bereits viel mit Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung, so der Bericht.
Dennoch zeigten sich die Ökonomen zuversichtlich, dass der erfolgreiche Wandel auch in den besonders betroffenen Regionen gelingen könnte. Denn die Dynamik in der Transformation sei sehr hoch, die Unternehmen investierten in erheblichem Ausmaß, insbesondere auch in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten.
Außerdem könnten die Herausforderungen besser gemeistert werden, wenn die Regionen ihre Kräfte bündelten und miteinander kooperierten. „Unsere Studie hat deutlich gezeigt, dass es unter den 40 Kreisen Regionen gibt, die vor sehr ähnlichen Problemen stehen. Gemeinsame Forschung oder der bloße Austausch von Erfahrungen schaffen Synergien“, sagte Studienautor Hanno Kempermann.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54187759-iw-40-regionen-besonders-vom-aus-fuer-verbrenner-betroffen-015.htm
Bundesländer mit Opel-Standorten fordern Zukunftsperspektive – Überblick am Abend / DJN, 14.10.2021
Die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen haben angesichts einer möglichen Ausgliederung zweier Opel-Werke sowie des dreimonatigen Produktionsstopps in Eisenach eine Zukunftsperspektive für die Standorte in Deutschland gefordert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54205036-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Florian Fügemann: Deutsche Reifenproduktion erreicht Tiefststand – Rückgang um 40,6 Prozent gegenüber 2015 – Corona-Pandemie und Chip-Lieferprobleme schuld – Trend setzt sich fort – Rohstoffpreise ziehen an – Pressetext, 11.10.2021
Die coronabedingt rückläufige Nachfrage nach Neuwagen in Deutschland sowie Engpässe bei Chips haben die Automobilproduktion gedrückt und 2020 zu einem Tiefststand bei der Herstellung von Pkw-Reifen geführt. Wie das Statistische Bundesamt http://destatis.de heute, Montag, bekanntgegeben hat, wurden 2020 nur rund 36,3 Mio. Pkw-Reifen produziert – rund ein Viertel (26,6 Prozent) weniger als im Vorjahr und damit ein Rückgang um 40,6 Prozent gegenüber 2015.
*** Trend setzt sich fort ***
Den Statistikern nach setzt sich dieser auch in diesem Jahr fort. Im ersten Halbjahr lagen die Produktionszahlen zwar 20 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, aber immer noch deutlich unter dem Niveau im vergleichbaren Vorkrisenzeitraum (minus 25,4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2019). Der Produktionsrückgang in Deutschland spiegelt sich auch in den Umsätzen der Reifenhersteller wider. Diese erwirtschafteten 2020 rund 4,9 Mrd. Euro und verzeichneten damit ein Umsatzminus von 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im längerfristigen Vergleich gingen die Umsätze um mehr als ein Viertel (26,8 Prozent) zurück. 2015 lagen sie noch bei insgesamt 6,7 Mrd. Euro.
Auch der Außenhandel mit Pkw-Reifen hat unter den weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. 2020 wurden mit 74,8 Mio. Autoreifen rund 13,4 Prozent weniger eingeführt als 2019. Die Ausfuhrmengen lagen mit 54,5 Mio. Stück ein Fünftel unter dem Niveau des Vorjahres. Dies setzte sich auch im ersten Halbjahr 2021 fort: Zwar stieg sowohl die Einfuhr (plus 23,7 Prozent) als auch die Ausfuhr (plus 16,7 Prozent) zum Vorjahreszeitraum, das vergleichbare Vorkrisenniveau wurde jedoch nicht erreicht (gegenüber dem ersten Halbjahr 2019: Import minus 6,5 Prozent; Export minus 16,7 Prozent).
*** Rohstoffpreise ziehen an ***
Lieferengpässe und eine große weltweite Nachfrage sorgen seit Längerem für wachsende Rohstoffpreise bei dem für die Reifenherstellung wichtigen Kautschuk. Die Einfuhrpreise von Naturkautschuk waren im August 2021 um 41,7 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Synthetischer Kautschuk verteuerte sich im gleichen Zeitraum um 46,7 Prozent. Kautschuk wird auch zur Herstellung von Dichtungen, Schutzhandschuhen, Luftballons, Klebebändern oder Kondomen verwendet. Auswirkungen der erhöhten Einfuhrpreise auf die Erzeuger- oder Verbraucherpreise von Autoreifen sind aktuell noch nicht zu beobachten.
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211011012
Andrea Thomas (WSJ): Bitkom: Markt für IT-Sicherheit stellt neue Umsatzrekorde auf – DJN, 12.10.2021
Der Markt für IT-Sicherheit wird in diesem und im kommenden Jahr laut Berechnungen Marktforschungsunternehmens IDC für den Digitalverband Bitkom rasant wachsen und neue Umsatzrekorde aufstellen. In diesem Jahr dürften in Deutschland demnach 6,2 Milliarden Euro für Hardware, Software und Services im Bereich IT-Sicherheit ausgegeben werden, 9,7 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020.
Für das Jahr 2022 wird ein Umsatzplus von 9,9 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro prognostiziert. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 9,5 Prozent pro Jahr sollen im Jahr 2025 rund 8,9 Milliarden Euro Umsatz mit Lösungen für ein Mehr an IT-Sicherheit erzielt werden, erklärte Bitkom.
„Cyberangriffe sind für die Wirtschaft zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Für Unternehmen und Verwaltungen ist eine hohe IT-Sicherheit überlebensnotwendig und muss fester Bestandteil guten Managements sein“, sagte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. „Die Corona-Krise hat gezeigt, wie verwundbar viele Firmen sind. Die Ausgaben für IT-Sicherheit werden künftig weiter steigen.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54177184-bitkom-markt-fuer-it-sicherheit-stellt-neue-umsatzrekorde-auf-015.htm
EINZELHANDEL (Pressespiegel / DJN, 15.10.2021) – Trotz der gedämpften Konjunkturerwartungen für die Wirtschaft insgesamt hält der Einzelhandelsverband (HDE) an seiner Prognose fest, wonach der deutsche Einzelhandel in diesem Jahr insgesamt ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent verzeichnen wird. „Der Binnenmarkt wird auch in der Pandemie die Konjunktur stützen“, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Verbraucher hätten im vergangenen Jahr 100 Milliarden Euro zusätzlich auf die Sparkonten gelegt. Der private Konsum habe daher eine solide Basis. Wachstumstreiber bleibt laut HDE vor allem der Online-Handel, der seine Umsätze 2021 demnach um fast 20 Prozent steigern wird. (RND)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54208223-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Bitkom: Deutscher Handel wegen Corona-Effekt so digital wie nie – Überblick am Mittag / DJN, 13.10.2021
Die Corona-Pandemie hat sich als entscheidender Treiber des Online-Handels erwiesen. Deutlich mehr Einzelhändler verkaufen ihre Waren im Netz und für neun von zehn Händlern hat Digitalisierung an Bedeutung gewonnen, ergab eine repräsentative Befragung von mehr als 500 stationär oder online tätigen Groß- und Einzelhändlern in Deutschland, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde. Der Einzelhandel in Deutschland sei so digital wie nie.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54189630-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Umfrage: 50 Prozent mehr Leerstand in deutschen Innenstädten erwartet – Überblick am Mittag / DJN, 15.10.2021
Die Zahl der Einzelhändler in deutschen Innenstädten dürfte nach einer Umfrage weiter sinken und damit zu mehr Leerstand beitragen: Wie die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Ergebnisse der Studie „Zukunftsfeste Innenstädte“ berichtete, rechnen Kommunen und Wirtschaftsvereinigungen mit einem Anstieg des Leerstands um fast 50 Prozent. Demnach lag die Quote leerstehender Geschäfte 2019 vor der Corona-Krise bei rund 10 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54212783-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Große Unterschiede bei Unternehmensplänen zur Zukunft des Homeoffice – Überblick am Mittag / DJN, 11.10.2021
Die Pläne deutscher Unternehmen bei der künftigen Ausgestaltung von Homeoffice-Regelungen fallen einer aktuellen Umfrage zufolge sehr unterschiedlich aus. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit am Montag erklärte, wollen rund zwei Drittel der Unternehmen Homeoffice künftig im selben Umfang ermöglichen wie vor der Corona-Pandemie. Jeder zehnte Betrieb plant hingegen weniger Homeoffice, ein Fünftel der Unternehmen möchte mehr Flexibilität ermöglichen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54167325-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Hans Bentzien: Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt um 6 Prozent – DJN, 12.10.2021
Die Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland hat im September erneut zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 6,0 Prozent und lag um 25 Prozent höher als im September 2020, als die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt war. Die Regelinsolvenzen geben Hinweise auf die Entwicklung der gesamten Unternehmensinsolvenzen. Deren Anzahl lag um Juli um 12,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat.
Der rückläufige Trend bei der Zahl der Unternehmensinsolvenzen der vergangenen Monate setzte sich damit auch nach Auslaufen vieler Sonderregelungen, wie der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen infolge der Corona-Pandemie, fort. Gegenüber Juli 2019, also vor Beginn der Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland, ging die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Juli um 27,0 Prozent zurück.
Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte im Juli 2021 auf rund 4,6 Milliarden Euro. Im Juli 2020 hatten sie noch bei etwa 3,9 Milliarden Euro gelegen. Dieser Anstieg bei gleichzeitigem Rückgang der Unternehmensinsolvenzen ist darauf zurückzuführen, dass im Berichtsmonat mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt hatten als im Juli 2020.
Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im Baugewerbe mit 222 (Juli 2020: 204) Fällen. Im Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) waren es 189 (228) Verfahren. Im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen- und technischen Dienstleistungen (zum Beispiel Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Architektur- und Ingenieursbüros, Forschung und Entwicklung, Werbung und Marktforschung, Fotolabors sowie Veterinärwesen) wurden 131 (182) Insolvenzen gemeldet.
Beim Vergleich der Insolvenzzahlen ist zu beachten, dass das Insolvenzgeschehen in den Jahren 2020 und 2021 von Sonderregelungen geprägt war. Von Anfang März 2020 bis Ende 2020 war die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen infolge der Corona-Pandemie ausgesetzt.
Diese Regelung galt bis Ende April 2021 weiterhin für Unternehmen, bei denen die Auszahlung der seit 1. November 2020 vorgesehenen staatlichen Hilfeleistungen noch ausstand. Für diese Unternehmen wurde die Pflicht zur Beantragung eines Insolvenzverfahrens erst zum 1. Mai 2021 wieder voll eingesetzt. In den Zahlen für Juli 2021 ist, unter anderem aufgrund der Bearbeitungszeit bei den Gerichten, weiterhin keine Trendumkehr bei der Zahl der Unternehmensinsolvenzen zu beobachten.
Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 78,0 Prozent auf 7.164. Der starke Anstieg steht im Zusammenhang mit einem Gesetz zur schrittweisen Verkürzung von Restschuldbefreiungsverfahren von sechs auf drei Jahre. Die Neuregelung gilt für ab dem 1. Oktober 2020 beantragte Verbraucherinsolvenzverfahren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173821-zahl-der-regelinsolvenzen-in-deutschland-steigt-um-6-prozent-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): IW: Privater Konsum bleibt weiter auf Erholungskurs – Ungemach droht von der Inflation – DJN, 12.10.2021
Der private Konsum bleibt in Deutschland laut einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) weiter auf Erholungskurs. Günstige Kaufgelegenheiten, eine stabile Finanzlage und die guten Beschäftigungsaussichten beflügelten die Konsumlaune der Deutschen. Allerdings könnte die Inflation zu einer Konsumbremse werden, warnte der IW.
Der Verbraucherindex, mit dem das IW gemeinsam mit The Conference Board das Vertrauen der Verbraucher misst, stieg im August im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten zwar nur moderat von 106 auf 107 Punkte. Allerdings liegt das nunmehr erreichte Niveau nahe an dem Spitzenwert von Anfang 2018 – damals betrug der Wert 108, wie das IW erklärte. „Das signalisiert für das dritte Quartal 2021 eine fortgesetzte Konsumerholung.“
Auch im Euroraum habe sich das Verbrauchervertrauen positiv entwickelt und die Konsumenten zeigten sich optimistisch. „Die Delta-Variante des Coronavirus scheint die Konsumperspektiven in Europa weniger einzutrüben als in anderen Weltregionen“, so das Fazit des IW.
*** Ungemach droht von der Inflation ***
Die aktuelle Preisentwicklung wirke dem positiven Konsumtrend allerdings entgegen, warnte das Institut. Höhere Energiepreise, Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten, staatliche Mehrbelastungen durch die CO2-Bepreisung und nicht zuletzt die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz trieben derzeit die Preise in die Höhe.
Aus der sich anbahnenden Regierungsbildung erwartet IW-Konjunkturchef Michael Grömling jedoch keine Auswirkungen für die Konsumlaune. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt große Steuererhöhungen insbesondere bei der Mehrwertsteuer anstehen – die würden die Konsumlaune erheblich trüben“, so der Ökonom.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54177247-iw-privater-konsum-bleibt-weiter-auf-erholungskurs-015.htm
Studie: Deutschland bei Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung deutlich über EU-Schnitt – Überblick am Abend / DJN, 14.10.2021
Viele Deutsche werden nach dem Renteneintritt in Zukunft nicht mehr durch jüngere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt ersetzt werden können: Im Jahr 2030 werde die Zahl der 20- bis 64-jährigen Menschen in Deutschland rund 11 Prozent niedriger sein als 2020, wenn keine Migration stattfinde, heißt es in einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Im EU-Schnitt beträgt der Rückgang nur knapp 7 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54205036-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
MINIJOBS (Pressespiegel / DJN, 14.10.2021) – Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, wonach Arbeitgeber geringfügig Beschäftigte nicht entschädigen müssen, wenn sie ihr Unternehmen aufgrund einer Corona-Verordnung zur Eindämmung der Pandemie schließen müssen, dringt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf eine Minijob-Reform. „Tausende Menschen haben ihre Arbeit verloren und sind ohne Anspruch auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld in schlimmer Not gelandet“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Minijobs müssten endlich zu Beschäftigung mit sozialer Absicherung werden. (Funke Mediengruppe)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54196611-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
LOHNFORDERUNGEN (Pressespiegel / DJN, 14.10.2021) – Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat angesichts der hohen Inflationsrate „deutlich spürbare Reallohnsteigerungen“ gefordert. Diese seien notwendig, um den Beschäftigten und ihren Familien zu ermöglichten, den Preisanstieg aufzufangen. „Da die Preissprünge etwa für Lebensmittel, Energie und Benzin insbesondere Menschen mit geringeren und mittleren Einkommen betreffen, beinhalten unsere Tarifforderungen Mindestbeträge, die die Lohnsteigerungen für diese Beschäftigten überdurchschnittlich wirken lassen“, sagte Werneke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (RND)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54196611-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
IG BAU: Einigung im Tarifstreit im deutschen Baugewerbe erzielt – Kompromiss: gestaffelte Inflationsabgeltung bis April 2023 – Überblick am Morgen / DJN, 15.10.2021
Im Tarifstreit im Baugewerbe haben die Gewerkschaft IG BAU und die Arbeitgeber eine Einigung erzielt und Streiks damit vorerst abgewendet. Wie beide Seiten in der Nacht zum Freitag mitteilten, gelang ein Kompromiss in der zweiten Schlichtungsrunde. Im Detail sieht der ausgehandelte Kompromiss für die Beschäftigten im Westen Lohnerhöhungen in drei Schritten vor: 2,0 Prozent zum 1. November, 2,2 Prozent zum 1. April 2022 und noch einmal 2,0 Prozent zum 1. April 2023. Außerdem gibt es eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro. Zusätzlich sind Einmalzahlungen vorgesehen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54209386-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
IG BAU erhöht vor zweiter Schlichtungsrunde im Tarifstreit Druck auf Arbeitgeber – Überblick am Abend / DJN, 12.10.2021
Vor dem Beginn der zweiten Schlichtungsrunde im Tarifkonflikt im Baugewerbe hat die Gewerkschaft IG BAU den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Gewerkschaftschef Robert Feiger sprach am Dienstag von der „wirklich allerletzten Chance“ für die Bauarbeitgeber, sich auf dem Verhandlungsweg auf einen neuen Tarifvertrag zu einigen. „Wenn es jetzt nicht zu einem vernünftigen Abschluss kommt, ist Arbeitskampf angesagt.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54181681-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Verdi sagt Tarifrunde mit privaten Banken ab – Überblick am Abend / DJN, 11.10.2021
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die für Mittwoch angesetzten Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV) abgesagt. „Es gab von der Arbeitgeberseite keinerlei Signale, dass sie ihr bisheriges Angebot nachbessern wollen“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck am Montag. Die Zeichen stünden auf Streik. Der AGV reagierte mit Unverständnis.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54170418-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Tarifverhandlungen für Ärzte in kommunalen Kliniken begonnen – Marburger Bund fordert 5,5 Prozent mehr Gehalt – Überblick am Mittag / DJN, 14.10.2021
In Berlin haben am Donnerstag die Tarifverhandlungen für die rund 55.000 Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern begonnen. Der Marburger Bund fordert 5,5 Prozent mehr Gehalt rückwirkend zum 1. Oktober 2021 sowie Verbesserungen bei den Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften. Die Gewerkschaft will unter anderem die Kliniken stärker in die Pflicht nehmen, Grenzen für Dienste außerhalb der Regelarbeitszeit einzuhalten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54201343-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
SCHULDENBREMSE (Pressespiegel / DJN, 15.10.2021) – Die Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Münchner Ifo-Instituts, Marcel Fratzscher und Clemens Fuest, haben eine einmalige hohe Kreditaufnahme im Jahr 2022 gefordert, aus der eine Rücklage für Zukunftsinvestitionen gebildet werden soll. „Die neue Bundesregierung sollte als oberste Priorität ein Programm für Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und soziale Erneuerung beschließen“, sagte Fratzscher. Eine neue Bundesregierung könne sehr wohl stärkere Zukunftsinvestitionen mit der Schuldenbremse vereinbar machen. (Rheinische Post)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54208223-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
EINKOMMENSTEUER (Pressespiegel / DJN, 12.10.2021) – Der Bund der Steuerzahler fordert wegen der hohen Inflationsrate eine zusätzliche Anpassung des Einkommensteuertarifs 2022 um mindestens drei Prozent. „Für den Einkommensteuertarif 2022 sind bislang nur 1,5 Prozent Inflation zugunsten der Steuerzahler berücksichtigt. Die tatsächliche Inflation wird aber mindestens doppelt so hoch sein“, sagte Verbandschef Reiner Holznagel. „Der Staat würde dann inflationär überhöhte Einkommensteuern kassieren. Das darf nicht sein.“ Die Bundesregierung müsse daher den Tarif zugunsten der Steuerzahler korrigieren. „Nur dann wird die kalte Progression komplett abgebaut“, so Holznagel. (Handelsblatt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173318-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Kommunen erwarten für 2021 Defizit von 7 Milliarden Euro – Überblick am Mittag / DJN, 15.10.2021
Die Städte, Landkreise und Gemeinden warnen vor einer kommunalen Haushaltskrise: Sie rechnen mit sinkenden kommunalen Investitionen und steigenden Defiziten. Die kommunalen Spitzenverbände erwarten bereits in diesem Jahr ein Defizit von 7 Milliarden Euro, wie aus den am Freitag veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage hervorgeht. Die jährlichen Investitionen gehen demnach voraussichtlich bis zum Jahr 2024 um mehr als 5 Milliarden Euro zurück.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54212783-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): Merkel wirbt bei Wirtschaft um EU-China Abkommen – Boom bei Handelsabkommen – DJN, 13.10.2021
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der deutschen Wirtschaft für engere wirtschaftliche Beziehungen mit dem asiatisch-pazifischen Raum geworben. Auch bat sie um Unterstützung für das Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Wichtig sei allerdings eine Diversifizierung in der Region, die mehr sei als China alleine, so Merkel.
China sei zwar Deutschlands wichtigster Handelspartner. „Umso wichtiger ist es, dass wir nicht daran nachlassen, uns für gleiche Wettbewerbsbedingungen, für einen wichtigen Schutz geistigen Eigentums und einen weiteren Abbau von Handelshemmnissen einzusetzen“, sagte Merkel anlässlich der Amtseinführung des neuen Vorsitzenden des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft (APA), Roland Busch. Bislang war Joe Kaeser Vorsitzender. Hier gelte es, das Handelsabkommen zwischen der EU und China auf den Weg zu bringen.
Zwar habe man hier schon einiges erreicht. „Es gibt allerdings erhebliche Schwierigkeiten bei der Ratifikation. Und ich wünsche mir, dass der APA sich auch dafür einsetzt, dieses Abkommen ratifizieren zu können“, erklärte Merkel. Aber es sei klar, dass der asiatisch-pazifische Raum mehr sei als China.
*** Boom bei Handelsabkommen ***
Europa müsse sich zudem fragen, ob man in den Akteuren asiatischer Wachstumszentren eher Konkurrenten oder eher Partner sehe.
„Ich bin überzeugt, dass es jeder Mühe wert ist, sich sowohl dem Wettbewerb zu stellen als auch über einen fairen Wettbewerb dafür einzutreten, dass wir Partner sein können“, so Merkel. „Aus einer besseren Einbindung asiatisch-pazifischer Volkswirtschaften in die internationale Arbeitsteilung erwachsen neue Chancen, von denen alle Beteiligten profitieren können.“
Merkel schlug für Europas Umgang mit dem asiatisch-pazifischen Raum drei Prinzipien vor, mit deren Hilfe man trotz aller Schwierigkeiten die Zusammenarbeit vertiefen könne. Nötig sei ein verlässliches Regelwerk, das für fairen Handel sorgt, eine nachhaltige Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen sowie eine Diversifizierung der Handelspartner.
Denn trotz aller Schwierigkeiten mit asiatisch-pazifischen Partnern, wie etwa China, böte die Region Europa doch große wirtschaftliche Chancen. „Wir erleben, dass die Regeln des globalen Handelns einerseits vielerorts infrage gestellt werden, es andererseits aber geradezu einen Boom bei Handelsabkommen auf bilateraler und regionaler Ebene gibt, besonders im asiatisch-pazifischen Raum“, sagte Merkel.
Bei der Nachhaltigkeit spielten Energiepartnerschaften in den Beziehungen zum asiatisch-pazifischen Raum eine große Rolle. Deutschland wolle zum weltweiten Klimaschutz beitragen, indem man deutschen Unternehmen neue Marktchancen für klimafreundliche Technologien erschließe. Ein Meilenstein sei hier die Zusammenarbeit von Deutschland und Australien im Bereich Wasserstoff, lobte Merkel. Wichtig sei auch, dass die Energiepartnerschaften mit China, Indien, Japan und Korea fortgeführt und intensiviert würden.
„Damit positionieren wir uns als wichtiger Partner beim für die Zukunft so entscheidenden Thema Nachhaltigkeit“, so die Bundeskanzlerin.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54193005-merkel-wirbt-bei-wirtschaft-um-eu-china-abkommen-015.htm
LITHIUM (Pressespiegel / DJN, 12.10.2021) – Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech will schon im nächsten Jahr mit dem Bau der bislang größten Lithium-Fabrik Europas beginnen. Ab 2024 sollen im brandenburgischen Guben, nur rund 60 Kilometer von Teslas Gigafactory entfernt, rund 24.000 Tonnen des weißen Rohstoffs pro Jahr verarbeitet werden – genug für den Bau von 500.000 Elektroautos. Bislang stehen sogenannte „Lithium-Konverter“ fast ausschließlich in China. (Handelsblatt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54173318-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Flughafen Frankfurt mit deutlichem Passagierplus auch im September – Überblick am Morgen / DJN, 13.10.2021
Der Flughafen Frankfurt hat im September rund 3,1 Millionen Fluggäste abgefertigt. Das entspricht einem Plus von 169,1 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Grund für die positive Entwicklung waren weiterhin vor allem touristische Verkehre. Beim Passagieraufkommen wurde damit wie auch schon im August annähernd die Hälfte des Vorkrisenniveaus erreicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54186271-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
ÖSTERREICH
– STATISTIK
Baukosten im September 2021 weiter gestiegen
Transportaufkommen auf Österreichs Straßen 2020 um 7,7% gesunken
Ein Fünftel weniger Pkw-Neuzulassungen im September 2021
Erheblich weniger Abschüsse und Wildverluste in der Jagdsaison 2020/2021
QUELLE: https://www.statistik.at
– PARLAMENTSKORRESPONDENZ
Die Parlamentswoche vom 17. bis 22. Oktober 2021 – Bundesrat, Ausschüsse, internationale Termine, Politik am Ring, Bundesrats-Enquete, Pressekonferenz zum neuen BesucherInnen-Zentrum
QUELLE: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1126/index.shtml
………………
Bundeskanzler Schallenberg ruft zum gemeinsamen Arbeiten auf – Sondersitzung des Nationalrats: Opposition hält ÖVP-Obmann Kurz schwere Vergehen vor – Schallenberg: Politisches Taktieren muss enden – Kogler: Österreich braucht Stabilität – SPÖ: Regierungsumbildung ist eine Farce – ÖVP: Vorwürfe gegen Kurz werden sich als falsch erweisen – FPÖ spricht gesamter Regierung Misstrauen aus – Regierungskrise für Grüne überwunden – NEOS für Abgrenzung und Neustart – 12.10.2021
Blümel: Budget 2022 bringt Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit – Finanzminister Blümel hält Budgetrede im Parlament – Corona-Krise: Budgetäre Verantwortung für nächste Generationen tragen – 2022 – 2025: Schuldenquote Richtung 70% senken – Steuerreform als Beitrag zum Schuldenabbau – Mehr Geld für Bundesheer und Außenministerium – Schuljahr 2023/24: Elektronische Geräte für Unterstufe – Generalsanierung der Festspielhäuser Salzburg und Bregenz budgetiert – 13.10.2021
COVID-19 ließ Staatsschulden 2020 steigen – Nationalrat nimmt Bundesrechnungsabschluss 2020 mehrheitlich zur Kenntnis – SPÖ vermisst Transparenz bei Wirtschaftshilfen – FPÖ: Regierung hat Österreich heruntergewirtschaftet – NEOS: Budgetpolitik ist nicht zukunftsfit – ÖVP weist Kritik an Corona-Hilfen zurück – Grüne: Staatsbudget auf Kurs zur Klimaneutralität – Kraker: Rechnungshof prüft COFAG – 13.10.2021
Nationalrat beschließt Anpassungen zu handelsstatistischen Erhebungen – Debatte über Investitionsschutz und Handelsabkommen Mercosur – Anpassungen zu handelsstatistischen Erhebungen – Beendigung von bilateralen Investitionsschutzverträgen – 13.10.2021
Neu im Verfassungsausschuss: Regierungskommunikation und ORF-Gebühren – SPÖ: Datenlöschung auf Diensthandys soll strafbar werden – FPÖ: Regierung muss ihre Inseratenflut eindämmen – FPÖ fordert Abschaffung der ORF-Gebühren – 15.10.2021
Neu im Innenausschuss: NEOS gegen Einsatz von Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum – 15.10.2021
Opposition bringt Verlangen auf ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss ein – SPÖ, FPÖ und NEOS wollen Korruptionsvorwürfe gegen ÖVP-Regierungsmitglieder klären – Gliederung in vier Beweisthemen – Beratungen im Geschäftsordnungsausschuss binnen acht Wochen – SPÖ: Sümpfe der Korruption trockenlegen – ÖVP zweifelt an Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes – FPÖ sieht „tiefen Staat“, NEOS „türkises System“ – Grüne begrüßen Untersuchungsausschuss – Untersuchungsausschuss soll Korruptionsvorwürfe gegen ÖVP-Regierungsmitglieder klären – 13.10.2021
Kurze Debatte über Untersuchungsausschuss im Nationalrat – Opposition setzt sich bei Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP für Aufklärung ein – 13.10.2021
Sondersitzung des Nationalrats: Misstrauensantrag gegen Finanzminister Blümel abgelehnt – Debatte über SPÖ-Dringliche zu mutmaßlicher Involvierung in Aufträge für Inserate, Umfragen und Studien – Weitere Anträge der Opposition abgelehnt – SPÖ: Blümel als Kurz-Vertrauter weiterhin an den entscheidenden Schaltstellen der Macht – ÖVP: Peinliche Anfrage mit verdrehten Sätzen – FPÖ: Finanzminister ist konkrete Antworten schuldig geblieben – Grüne: Es geht um die Gewährleistung von Aufklärung und Stabilität – NEOS: System Kurz“ steht für Demokratierverrat – 12.10.2021
QUELLE: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/
– MELDUNGEN
Schallenberg als neuer österreichischer Bundeskanzler vereidigt – Überblick am Mittag, 11.10.2021,14:01
Der bisherige österreichische Außenminister Alexander Schallenberg ist als neuer Bundeskanzler seines Landes vereidigt worden. Zwei Tage nach dem Rücktritt seines Vorgängers Sebastian Kurz legte Schallenberg in einer vom Fernsehen übertragenen Zeremonie am Montag in der Wiener Hofburg seinen Amtseid ab. Als Schallenbergs Nachfolger im Außenamt wurde der Diplomat Michael Linhart von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54167325-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Schallenberg tritt Nachfolge von Kurz als Regierungschef in Wien an – Wochenendüberblick / DJN, 11.10.2021, 7:01
Nach dem Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz unter dem Druck von Korruptionsermittlungen tritt der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg am Montag dessen Nachfolge an. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte die Regierungskrise am Sonntagabend nach einem Treffen mit Schallenberg für „beendet“: „Die Arbeit für unser Land kann weitergehen“, sagte Van der Bellen. Kurz war am Samstagabend unter dem Druck der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen zurückgetreten, will aber Chef der konservativen ÖVP bleiben und als Fraktionsvorsitzender ins Parlament wechseln.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54162544-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-09-und-10-oktober-2021-015.htm
Nationalbank veröffentlicht aktuelle Inflationsprognose für 2021 und 2022: Steigende Rohstoffpreise sorgen für höhere Inflation – OeNB erwartet schrittweise Entspannung bereits im Jahr 2022 – Rohstoffpreisbedingter Inflationsanstieg setzte sich weiter fort – OeNB hebt Inflationsprognose für 2021 auf 2,4 % und für 2022 auf 2,2 % an – Teilweise beträchtliche Preisunterschiede bei identischen Produkten im grenznahen Raum – OeNB, 6.10.2021
Seit Jahresbeginn 2021 stieg die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 1,1 % im Jänner auf 3,2 % im August 2021 und erreichte damit den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Dieser Anstieg ist größtenteils auf die markante Zunahme der Rohstoffpreise zurückzuführen, die auch zu einer Aufwärtsrevision der Inflationsprognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) führte. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die OeNB in ihrer aktuellen Inflationsprognose eine HVPI-Inflationsrate von 2,4 %, gefolgt von einem Rückgang auf 2,2 % für 2022. Im Rahmen der Publikation „Inflation aktuell“ untersucht die OeNB immer auch Schwerpunktthemen – dieses Mal wurden Preis- und Inflationsunterschiede bei identischen Produkten in der österreichisch-bayerischen Grenzregion analysiert. Ergebnis: Trotz integrierter Wirtschaft gibt es teilweise beträchtliche Preisunterschiede auf Produktebene im Grenzraum, die im Schnitt wesentlich größer sind als die Preisunterschiede innerhalb eines Landes.
*** Rohstoffpreisbedingter Inflationsanstieg setzte sich weiter fort ***
Die HVPI-Inflationsrate stieg im August 2021 auf 3,2 %, wo sie laut Schnellschätzung von Statistik Austria auch im September 2021 verharrte. Damit erreichte die monatliche Inflationsrate den höchsten Wert seit Dezember 2011. Der Inflationsanstieg im bisherigen Jahresverlauf 2021 ist größtenteils auf den markanten Anstieg der Rohölpreise und damit auf die Energiekomponente im HVPI zurückzuführen. Seit Jahresbeginn stiegen jedoch nicht nur die Energiepreise, sondern auch die Preise vieler nichtenergetischer Rohstoffe deutlich. Dies spiegelte sich in den letzten Monaten auch zunehmend in den steigenden Endverbraucherpreisen nichtenergetischer Industriegüter wider. Zusätzlicher Preisdruck – insbesondere bei langlebigen Konsumgütern – ging zudem von Lieferengpässen sowie Unterbrechungen der Transportketten aus.
*** OeNB hebt Inflationsprognose für 2021 auf 2,4 % und für 2022 auf 2,2 % an ***
Laut aktueller Inflationsprognose der OeNB vom September 2021 wird die HVPI-Inflationsrate für das Jahr 2021 2,4 % betragen, gefolgt von 2,2 % im Jahr 2022. Der Höhepunkt der Inflationsentwicklung wird im dritten Quartal 2021 liegen. So erwartet die OeNB, dass die Inflationsentwicklung in den nächsten Monaten auf hohem Niveau verbleiben wird. Die anhaltende wirtschaftliche Erholung sowie – wenn auch schwächer werdende – Angebotsengpässe werden auch im Jahr 2022 für Preisdruck sorgen. Eine Entspannung wird hingegen auf den Rohstoffmärkten (insbesondere bei den Rohölpreisen, aber auch bei nichtenergetischen Rohstoffpreisen) erwartet. Dies führt dazu, dass die Inflationsrate im Lauf des Jahres 2022 wieder leicht rückläufig sein wird.
*** Teilweise beträchtliche Preisunterschiede bei identischen Produkten im grenznahen Raum ***
Im Schwerpunktthema des unter dem Titel „Inflation aktuell“ publizierten Quartalsberichts der OeNB wurde untersucht, ob und warum internationale Preis- und Inflationsunterschiede auch in Grenzregionen bestehen, die wirtschaftlich und kulturell stark verflochten sind und die auch sonst keine Gründe für Preisunterschiede aufweisen (geringe Distanz, gemeinsamer Wirtschaftraum, ähnliche Konsumpräferenzen). Als Fallstudie diente die österreichisch-bayerische Grenzregion, wobei Preise von Handelsketten, die in den beiden Regionen wirtschaftlich aktiv sind, auf Produktebene verglichen wurden. Auch wenn die Mehrzahl der grenzüberschreitend angebotenen Produkte ähnliche Preise aufweist, lassen sich bei manchen Produkten Preis- und Inflationsunterschiede finden, die deutlich größer sind als die Unterschiede innerhalb eines Landes. So sind die Preise der untersuchten Produkte in Österreich im Durchschnitt um etwa 11 % höher als in Bayern. Die Existenz deutlicher Preisunterschiede bei identischen Produkten im grenznahen Raum zeigt somit, dass Konsumentinnen und Konsumenten offenbar nicht gezielt Einkäufe tätigen, um Preisvorteile dies- und jenseits der Grenze zu nutzen. Dies ermöglicht es den Handelsketten, eine dauerhafte Preisdiskriminierung auch zwischen eng verflochtenen Ländern aufrechtzuerhalten.
QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20211006.html
LANGFASSUNG (23-Seiten-PDF inkl. Schaubilder): https://www.oenb.at/dam/jcr:59699328-3685-4654-99d6-6fade41f8b8f/Inflation%20aktuell_Q3-2021.pdf
Vierte COVID-19-Welle bremst kräftigen Aufschwung – Sektorale Unterschiede – Winterhalbjahr: Unsicherheit durch Pandemie – 2022e-BIP-Wachstum plus 4,8 Prozent – Deutschland (Autoindustrie) leidet stärker unter Lieferkettenproblemen als Österreich (Tourismus, Beherbung) – Arbeitsmakrt im Wandel: aus Arbeitskräfteüberschuss wird Nachfragenot – WiFo, 8.10.2021
Die österreichische Wirtschaft wächst heuer um 4,4% und im nächsten Jahr um 4,8%. Der Konjunkturaufschwung ist zwar äußerst kräftig, es zeigen sich jedoch deutliche sektorale Unterschiede. Die vierte COVID-19-Welle verschärft diese Spreizung zusätzlich.
„Der Konjunkturaufschwung ist zwar äußerst kräftig, es zeigen sich jedoch deutliche sektorale Unterschiede. Während er im produzierenden Bereich zu Materialengpässen führt, sind viele Kinosäle und Hotels noch fast leer. Die vierte COVID‑19-Welle verschärft diese Spreizung zusätzlich“, so der Autor der aktuellen WIFO-Prognose Stefan Schiman.
Die Wertschöpfung in Österreich wuchs im II. Quartal 2021 insbesondere in den krisengeschüttelten Branchen deutlich. Mit der Zunahme des Infektionsgeschehens ab August 2021 schwächte sich das Wachstum aber wieder ab. Die neuerliche COVID‑19-Welle wird den Aufholprozess in bestimmten Dienstleistungsbranchen im IV. Quartal abermals dämpfen. Der Konjunkturaufschwung verläuft demnach sektoral heterogen, ist jedoch insgesamt äußerst kräftig. Auch der Arbeitsmarkt erholt sich zügig, wird durch die vierte COVID‑19-Welle aber vorübergehend einen Rückschlag erleiden. Zugleich wird sich der Preisauftrieb weiter beschleunigen, während die Geldpolitik – der neuen Strategie der EZB entsprechend – expansiv bleibt.
Wie schon nach der ersten COVID‑19-Welle im Frühjahr 2020 kam es in Österreich auch im Mai 2021 zu einem kräftigen Rebound der Wirtschaftsleistung, als die Lockdown-Maßnahmen aufgehoben waren. Dieser Rebound, der von den krisengeschüttelten Branchen getragen wurde, dürfte gemäß vorläufigen Daten etwas kräftiger ausgefallen sein als erwartet. Zugleich war die heimische Wirtschaft zu Jahresbeginn 2021 weniger stark eingebrochen als befürchtet. Das WIFO revidiert daher seine Prognose für 2021 nach oben.
Allerdings schwächt sich das Wirtschaftswachstum mit der erneuten Zunahme des Infektionsgeschehens seit Mitte August 2021 wieder ab, vor allem in der Gastronomie und Hotellerie. Aufgrund des schleppenden Impffortschritts wird die COVID‑19-Pandemie auch im kommenden Winterhalbjahr die Konjunktur dämpfen. Ab dem Frühjahr 2022 dürfte sich das Wachstum dann wieder beschleunigen, weshalb die BIP-Prognose für 2022 nur leicht auf +4,8% gesenkt wird. Für 2021 wird die Wachstumsrate auf +4,4% angehoben, da die Aufwärtsrevisionen im 1. Halbjahr die Abwärtsrevisionen im zweiten überwiegen.
Angebots- wie nachfrageseitig verläuft der Konjunkturaufschwung sehr heterogen. Während die Krise im produzierenden Bereich schon Ende 2020 überwunden war und die kräftige Dynamik dort derzeit zu beträchtlicher Materialknappheit und Preissteigerungen führt, könnte die Wertschöpfung in manchen Dienstleistungen 2021 sogar noch unter das Vorjahresniveau rutschen. Auf der Nachfrageseite expandierten der Warenaußenhandel und die Investitionen, begünstigt durch die Investitionsprämie, früh und deutlich. Der private Konsum wurde hingegen durch die Lockdowns erschwert und wächst daher auf Jahressicht 2021 zögerlicher.
Der Arbeitsmarkt erholt sich seit Jahresbeginn 2021 zügig. Der Abwärtstrend der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit dürfte in den kommenden Monaten zwar kurzfristig unterbrochen werden; im Vorjahresvergleich wird die Arbeitslosigkeit jedoch in beiden Prognosejahren zurückgehen.
Die Wirtschaftspolitik bleibt im Prognosezeitraum expansiv. Dies gilt vor allem für die Geldpolitik, da die EZB den Anstieg der Inflation als vorübergehend ansieht. Fiskalische Stützungsmaßnahmen werden schrittweise zurückgenommen. Die kürzlich präsentierte Steuerreform wird in der vorliegenden Prognose nicht berücksichtigt.
Neben der zukünftigen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik stellen mögliche weitere preistreibende Angebotsschocks auf den Weltmärkten und der künftige Verlauf der COVID‑19-Pandemie wichtige Prognoserisiken dar. Wie die letzten Wochen zeigten, kann das Infektionsgeschehen rasch zu‑, aber auch jäh abnehmen. Dementsprechend ist derzeit nur schwer absehbar, wie sich etwa der Wintertourismus entwickeln wird.
QUELLE: https://www.wifo.ac.at/news/vierte_covid-19-welle_bremst_kraeftigen_aufschwung
SIEHE DAZU:
=> WiFo-Herbsprognose 2021
QUELLE (1:15:24-h-Video): https://youtu.be/9FuL-eOQHpU
Stefan Bruckbauer: Die österreichische Wirtschaft schaltet bei hohem Erholungstempo einen Gang zurück – Unterschiedliche Sektortrends halten an – BIP-Anstieg verlangsamt sich zum Jahresende 2021 hin – UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator sinkt im September auf 4,6 Punkte, liegt jedoch weiter klar über langjährigem Durchschnitt – Unterschiedliche Sektortrends halten an – BIP-Anstieg verlangsamt sich zum Jahresende 2021 hin – Konsum wird 2022 die treibende Kraft – Geldpolitik bleibt locker trotz höherer Inflation – Verbesserung am Arbeitsmarkt wird zäher mit Risiken über den Winter im Dienstleistungssektor – Bank Austria, 15.10.2021
§ Der UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator sinkt im September auf 4,6 Punkte, übertrifft damit jedoch weiterhin deutlich den langjährigen Durchschnitt
§ Auslaufende Nachholeffekte und zunehmende Belastungen durch Produktionsengpässe verlangsamen das Erholungstempo
§ Wachstumsprognose für 2021 und 2022 mit einem BIP-Anstieg um 4,0 Prozent bzw. 5,1 Prozent unverändert hoch
§ Nach dem raschen Rückgang der Arbeitslosenquote auf saisonbereinigt 7,7 Prozent im September könnte im Winter der Trend zwischenzeitlich unterbrochen werden
§ Inflationsrisiken nehmen zu: Ölpreisrückgang sollte 2022 jedoch für Trendwende sorgen
*** UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator sinkt im September auf 4,6 Punkte, liegt jedoch weiter klar über langjährigem Durchschnitt ***
Nach der Hochstimmung in den Sommermonaten lässt der Optimismus in der heimischen Wirtschaft mittlerweile spürbar nach. Mit Herbstbeginn hat die Konjunkturstimmung in Österreich begonnen, sich abzukühlen. Der UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator ist im September auf 4,6 Punkte gesunken. Damit liegt der Indikator allerdings klar über dem langjährigen Durchschnitt und weist damit auf ein weiterhin sehr hohes Erholungstempo der österreichischen Wirtschaft hin. Im Vergleich zur überschießenden Dynamik nach der Beendigung des Lockdowns im Frühjahr hat der Aufwärtstrend jedoch erwartungsgemäß an Schwung eingebüßt, da die starken Nachholeffekte auszulaufen beginnen.
Die Verlangsamung der Konjunktur ist in allen Wirtschaftssektoren spürbar geworden, ausgenommen ist nur der Bau. Aufgrund der vollen Auftragsbücher und einer Entspannung der Probleme in den Lieferketten weht für die Bauwirtschaft wieder etwas stärkerer Rückenwind. Während die Bauwirtschaft mit Herbstbeginn einen Gang zulegen konnte, verlangsamt sich mittlerweile der Aufschwung in der Industrie, da die internationale Unterstützung nachlässt und sich die Engpässe bei der Beschaffung einiger Vormaterialien nicht gelockert haben. Zudem
schwindet der Optimismus in vielen Dienstleistungsbranchen, wie insbesondere dem Gastgewerbe, durch neuerliche Maßnahmen gegen die gestiegenen Infektionszahlen.
*** Unterschiedliche Sektortrends halten an ***
Die sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Wirtschaftssektoren, die die Erholung der österreichischen Wirtschaft aus der Pandemie kennzeichnet, wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Die Erholung am Bau hält ihr Tempo und die Dynamik in der Industrie bleibt trotz Verlangsamung sehr hoch, da abgesehen von Engpässen in den Lieferketten eine starke Nachfrage für anhaltenden Auftrieb sorgen wird. Der Aufschwung im Dienstleistungssektor wird hingegen über den Winter abhängig vom Pandemieverlauf wieder gebremst werden mit
besonders hohen Risiken für die körpernahen Dienstleistungsbranchen.
*** BIP-Anstieg verlangsamt sich zum Jahresende 2021 hin ***
Nach dem kräftigen Rebound im zweiten Quartal dieses Jahres mit einem Anstieg des BIP um 3,5 Prozent zum Vorquartal hat sich mit dem auslaufenden Sommer das Wachstumstempo bereits verlangsamt. Wir gehen für das dritte Quartal von einem BIP-Anstieg um rund 2 Prozent zum Vorquartal aus, der sich zum Jahresende hin weiter verlangsamen sollte. Trotz geringerem Tempo über den Winter wird die Erholung anhalten, so dass wir für 2021 insgesamt mit einem sehr hohen Wirtschaftswachstum von 4,0 Prozent rechnen:
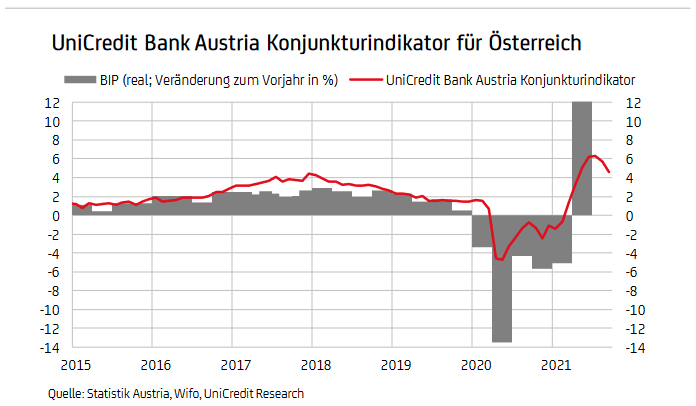
Damit wird die österreichische Wirtschaft rund um den Jahreswechsel 2021/22 den wirtschaft-
lichen Einbruch während der Pandemie wettgemacht haben.
*** Konsum wird 2022 die treibende Kraft ***
Trotz eines langsameren unterjährigen Erholungstempos wird das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr aufgrund eines statistischen Überhangs höher als 2021 ausfallen. Wir erwarten für 2022 einen Anstieg des BIP von 5,1 Prozent, stärker als im heurigen Jahr gestützt auf den privaten Konsum, von dem die bestimmenden Impulse ausgehen werden. Doch auch die Investitionstätigkeit wird – wenn auch etwas geringer als 2021 – den anhaltenden Aufschwung stark mittragen. Zudem wird der Außenhandel 2022 nach zweijähriger Pause wieder positiv zum Wirtschaftswachstum beitragen können.
Der private Konsum sollte die positive Entwicklung aus der zweiten Jahreshälfte 2021 mit ins kommende Jahr nehmen können. Der starke Beschäftigungsanstieg und der deutliche Rückgang der Arbeitslosigkeit unterstützen kräftig. Zudem ist nach zwei rückläufigen Jahren 2022 ein zumindest leichter Anstieg der Reallöhne in Sicht. Darüber hinaus sind vom Rückgang der Sparquote auf Vorkrisenniveau Impulse zu erwarten. Die geplante Steuerentlastung beginnend ab Mitte 2022 wird hingegen im kommenden Jahr noch kaum positive Wirkung entfalten können. Die Investitionstätigkeit wird zwar 2022 nicht mehr die bestimmende Wachstumskraft sein, aber weiterhin deutlich zunehmen. Zum einen ist die Kapazitätsauslastung der heimischen Betriebe bereits überdurchschnittlich hoch, was Erweiterungsinvestitionen nach sich ziehen wird. Des Weiteren unterstützen fiskalische Impulse und die anhaltend günstigen Finanzierungsbedingungen.
*** Geldpolitik bleibt locker trotz höherer Inflation ***
Die Europäische Zentralbank wird ihren unterstützenden geldpolitischen Kurs auch 2022 fortsetzen. Das Krisen-Wertpapier-Kaufprogramm PEPP dürfte im März zwar auslaufen, doch nicht ersatzlos. Wir gehen davon aus, dass das reguläre Kaufprogramm APP infolge aufgestockt und flexibler gestaltet wird, um günstige Finanzierungsbedingungen zu erhalten. Die EZB nähert sich schrittweise dem Ausstieg aus den Notfallmaßnahmen, wird aber vorerst keine Verschärfung der Geldpolitik vornehmen, da der derzeitige Inflationsausbruch als überwiegend temporär eingestuft wird.
Wie die EZB schätzen wir den Inflationsanstieg in Österreich auf mittlerweile über 3 Prozent im Jahresvergleich auch überwiegend als vorübergehend ein, allerdings scheint er sich als hartnäckiger zu erweisen als ursprünglich angenommen. Die durch die Pandemie verursachten Engpässe auf der Angebotsseite werden wahrscheinlich bis weit in das Jahr 2022 hinein anhalten. Vorerst halten wir an unserer Inflationsprognose von 2,4 Prozent für 2021 und 2,1 Prozent für 2022 jedoch fest. Insbesondere der erwartete Rückgang des Ölpreises im Jahresverlauf 2022
dürfte eine Wende des Inflationstrends bewirken. Allerdings haben sich die Prognoserisiken klar nach oben verschoben.
*** Verbesserung am Arbeitsmarkt wird zäher mit Risiken über den Winter im Dienstleistungssektor ***
Das kräftige Erholungstempo der vergangenen Monate hat die Lage am Arbeitsmarkt überraschend schnell verbessert. Im September betrug die saisonbereinigte Arbeitslosenquote nur noch 7,7 Prozent und lag damit nur noch 0,3 Prozentpunkte über dem Jahresdurchschnitt 2019. Angesichts der hohen Anzahl an offenen Stellen ist unmittelbar mit einem weiteren Anstieg der Beschäftigung und gleichzeitigem Rückgang der Arbeitslosenquote zu rechnen.
Trotz der Verlangsamung des Wirtschaftsaufschwungs wird die Arbeitslosigkeit in Österreich vorerst weiter sinken, jedoch nicht mehr so rasch wie bisher. Wir gehen von einem Rückgang der Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2021 auf maximal 8,3 Prozent aus und erwarten für 2022 eine weitere Verringerung auf 7,6 Prozent. Über den Winter könnten Belastungen für einige Dienstleistungsbranchen durch Maßnahmen gegen höhere Infektionszahlen zwischenzeitlich den rückläufigen Trend unterbrechen, der jedoch mit der voraussichtlichen Entspannung der Infektionslage im Frühjahr wieder einsetzen dürfte.
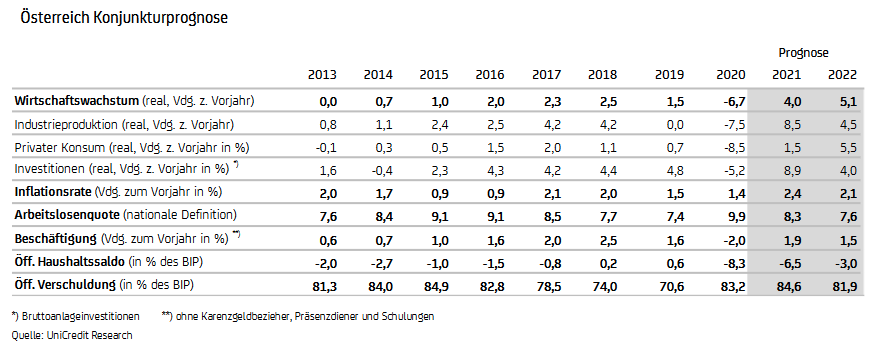
QUELLE: https://www.bankaustria.at/wirtschaft-oesterreich-konjunkturindikator.jsp
LANGFASSUNG (6-Seiten-PDF inkl. Tabelle und Schaubild): https://www.bankaustria.at/files/KI%201021.pdf
Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex – WWWI: 38. und 39. Kalenderwoche 2021 – WiFo, 12.10.2021
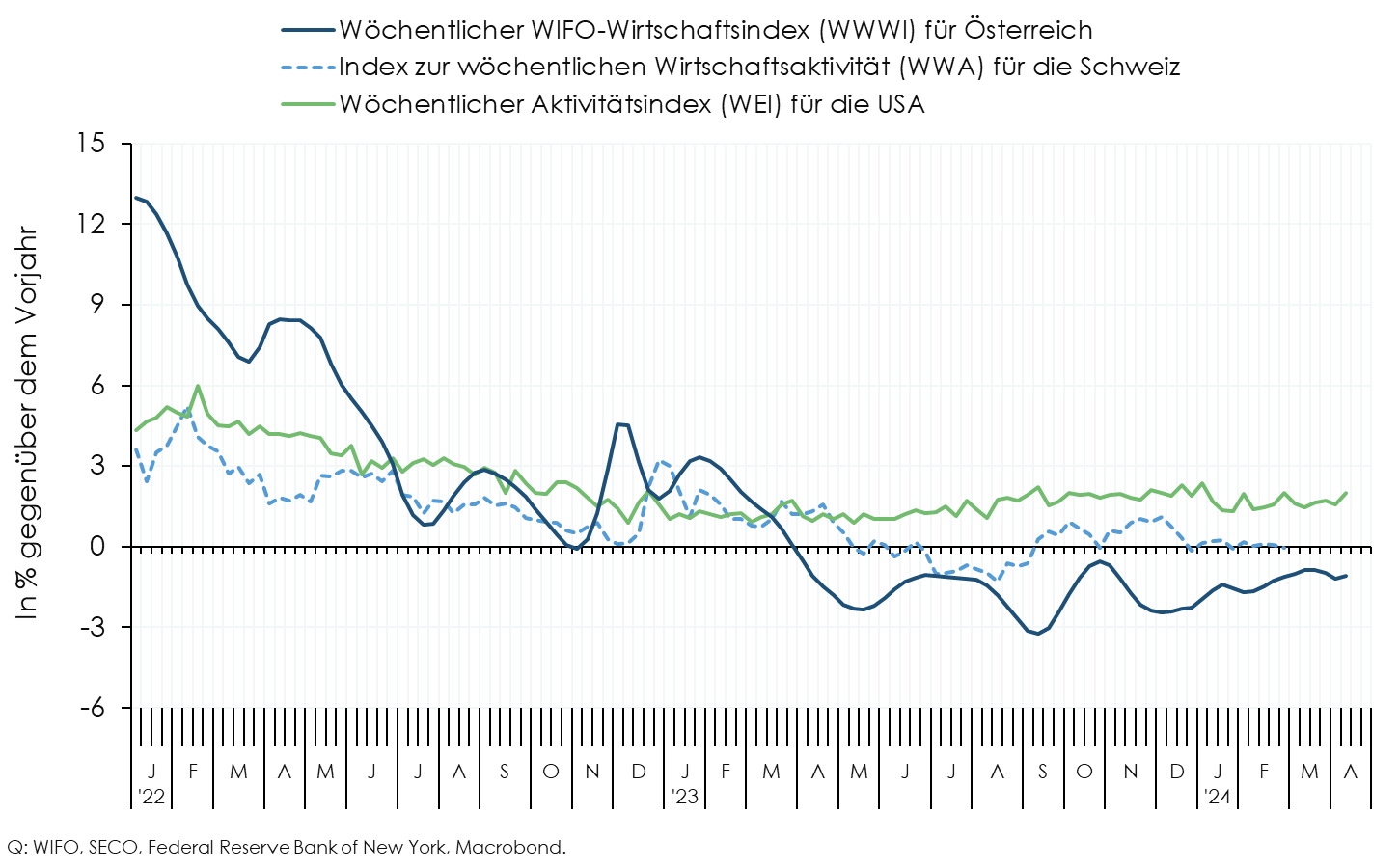
GRAPHIK: https://www.wifo.ac.at/wwadocs/konjunktur/W%C3%B6chentlicherWIFOWirtschaftsindex/WIFO-Konjunkturberichterstattung_W%C3%B6chentlicheWirtschaftsaktivit%C3%A4t.png
Die wöchentliche wirtschaftliche Aktivität gemäß WWWI schwächte sich in den Kalenderwochen 38 und 39 (20. September bis 3. Oktober 2021) weiter ab. Nach vorläufiger Berechnung lag das BIP um 0,5% (Kalenderwoche 38) bzw. 0,9% (Kalenderwoche 39) unter dem Vorkrisenniveau, einer Durchschnittswoche im Jahr 2019 als fixe Referenzperiode.
Gegenüber dem vorläufigen Höhepunkt in der Kalenderwoche 30 verringerte sich das Wachstum damit um 1¾ Prozentpunkte. Im Vergleich zur selben Kalenderwoche im Vorjahr war das BIP um 2,0% bzw. 2,3% höher.
In der jüngsten WWWI-Berechnung wurden die Jahresrechnung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) für das Jahr 2020, einschließlich damit einhergehender Revisionen der vierteljährlichen VGR bis zum II. Quartal 2021, sowie die zuletzt veröffentlichten Monatsstatistiken für Gästenächtigungen, Einzelhandelsumsätze, Warenaußenhandel und Produktionsindizes für die Industrie und die Bauwirtschaft für den Juli bzw. August 2021 berücksichtigt. Der WWWI und seine Teilaggregate wurden für den Zeitraum 1. Kalenderwoche 2019 bis 37. Kalenderwoche 2021 neu geschätzt. Durch das gemäß erster VGR-Jahresrechnung nun niedrigere BIP-Niveau 2020 wird im WWWI auch das Niveau der wöchentlichen BIP-Schätzung für das Jahr 2021 verringert. Damit verschiebt sich auch der Vorkrisenniveauvergleich (WWWI zum Referenzjahresdurchschnitt 2019) nach unten.
Die Bestimmungsfaktoren des WWWI zeigen für die Kalenderwochen 38 und 39 ein gemischtes Bild. Die bargeldlosen Umsätze für den Einzelhandel und den Konsum verbesserten sich etwas. Die Passagierankünfte auf dem Flughafen Wien nahmen im Durchschnitt ab, ebenso sank die Mobilität gemäß Google-Mobilitätsindikatoren, mit Ausnahme der Aufenthalte am Arbeitsplatz, am aktuellen Rand durchwegs. Alle Transportindikatoren im österreichischen Güterverkehr verbesserten sich hingegen. Für die Industrie zeigen sich gemischte Signale. Der temperaturbereinigte Stromverbrauch nahm gegenüber den Vorwochen etwas und die Stickstoffdioxid-Emissionen an Messstationen in der Nähe von Industrieanlagen deutlich ab. Die Arbeitslosigkeit in der Industrie ging aber neuerlich zurück. Letzteres zeigt sich auch in allen anderen Wirtschaftssektoren außer der Beherbergung und Gastronomie. Die Zahl offener Stellen nahm gegenüber den Vorwochen nicht weiter zu, liegt jedoch weiterhin auf äußerst hohem Niveau.
Mit dem Beginn der Feriensaison ab der Kalenderwoche 26 zeigte sich eine weitere Verbesserung der privaten Konsumausgaben; die Lücke zum Vorkrisenniveau 2019 verringerte sich markant. Im Laufe des Sommers schwächte sich die Konsumnachfrage wieder ab. Zuletzt betrug die Lücke zum Vorkrisenniveau 1,1%, womit sich die Dynamik etwas stabilisierte. Sowohl die Reiseverkehrsexporte als auch die -importe verloren in der Nebensaison am aktuellen Rand weiter an Dynamik. Die Warenexporte und -importe liegen jeweils rund 5% über dem Vorkrisenniveau, netto steuert der Warenaußenhandel jedoch nicht zum BIP-Wachstum bei. Auch für die Investitionen wird in Bezug auf das Vorkrisenniveau nur ein geringfügiger BIP-Beitrag geschätzt. Entstehungsseitig zeigt sich eine Abnahme in der Wertschöpfung. Während die Dynamik im produzierenden Bereich nach wie vor günstig ist, liegt die Wertschöpfung im Dienstleistungsbereich, mit Ausnahme des Handels, unter dem Vorkrisenniveau.
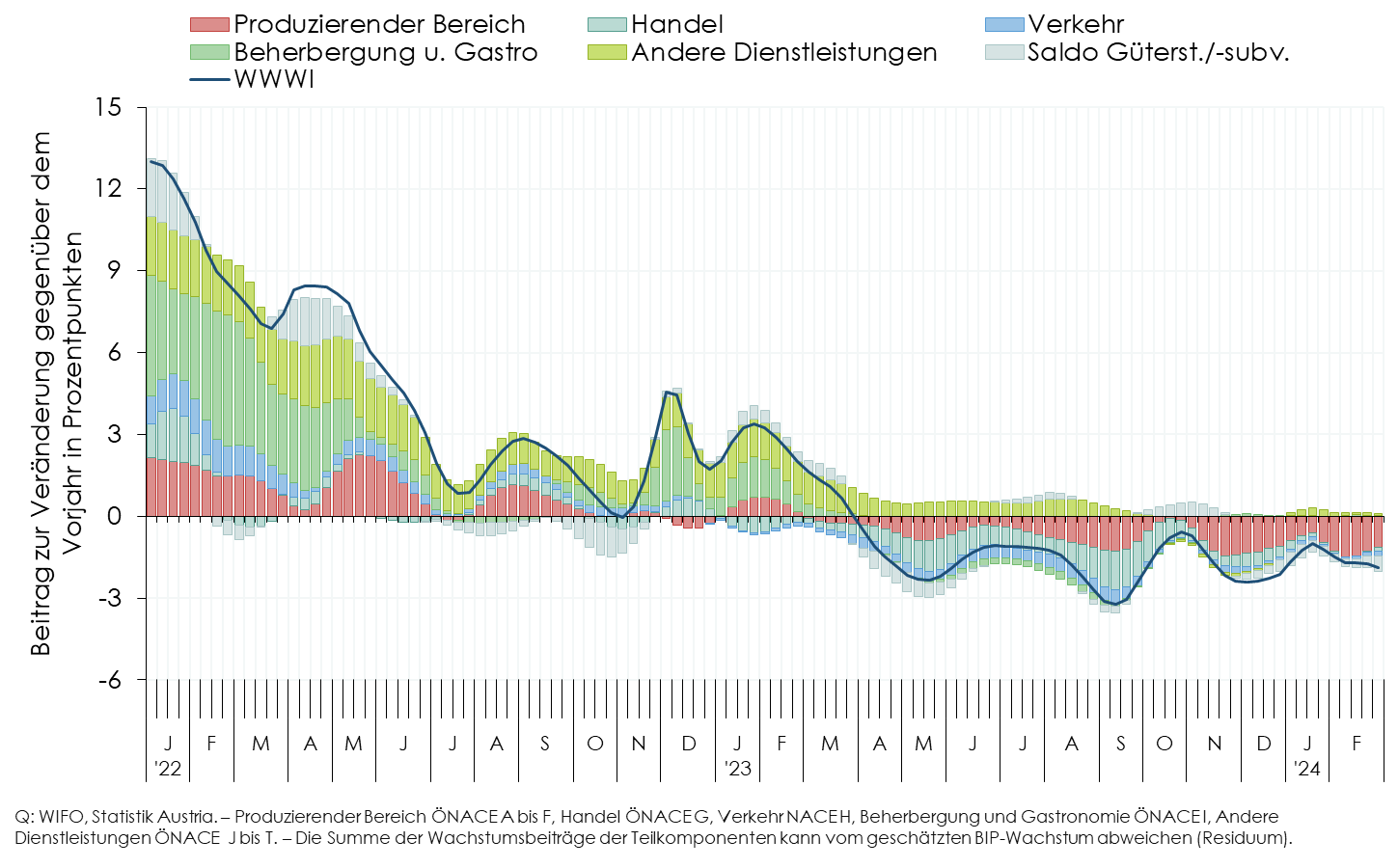
GRAPHIK: https://www.wifo.ac.at/wwadocs/konjunktur/W%C3%B6chentlicherWIFOWirtschaftsindex/WIFO-Konjunkturberichterstattung_WWWI_Beitr%C3%A4geEntstehung.png
QUELLE: https://www.wifo.ac.at/news/woechentlicher_wifo-wirtschaftsindex
Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB KW 36 bis 40 – Wirtschaftsleistung im September knapp über Vorkrisenniveau – OeNB, 14.10.2021
Der Erholungsprozess der österreichischen Wirtschaft hat sich im September fortgesetzt. Das Tempo der Erholung wurde aber durch die globalen Lieferengpässe gedämpft. In den Kalenderwochen 36 bis 40 (6. September bis 10. Oktober 2021) lag die Wirtschaftsleistung erstmals seit Ausbruch der Krise während mehrerer Wochen über dem Vorkrisenniveau, im Durchschnitt um 0,2 Prozent.
Die exportorientierte Industrie leidet weiterhin unter den globalen Liefer- und Transportengpässen. Die Konjunkturdynamik in der Industrie hat sich aber im September nicht weiter abgeschwächt, sondern war im Wesentlichen von einer Seitwärtsbewegung gekennzeichnet. Dies spiegelt sich sowohl in den LKW-Fahrleistungsdaten als auch im Stromverbrauch wider. Das im Vergleich zur Produktion deutlich stärkere Wachstum der Auftragseingänge zeigt jedoch, dass angebotsseitige Beschränkungen weiterhin einer stärkeren Ausweitung der Produktion entgegenstehen.
Daten zu Bargeldeinlieferungen und Zahlungskartenumsätzen zeigen einen leichten Aufwärtstrend bei den realen Konsumausgaben der österreichischen Haushalte. Dieser wird durch die fortschreitende Erholung am Arbeitsmarkt gestützt. Die Zahl der Arbeitslosen ist in der zweiten Septemberhälfte erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder unter dem Vorkrisenniveau gelegen. Der jüngste Anstieg der Inflation auf knapp über 3 % hat jedoch dämpfend auf das Wachstum der realen Konsumausgaben im September gewirkt.
Positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung hat der heimische Tourismus beigetragen. Wie schon im Vormonat zeigen die Schätzungen auf Basis von Zahlungskarten, dass die Zahl der Nächtigungen auch im September wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. Insbesondere ein kräftiges Plus bei den Nächtigungen von Gästen aus Deutschland und den Niederlanden zeichnete für diese positive Entwicklung verantwortlich. Mit dem Ausklingen der Sommersaison gewinnt der Städtetourismus anteilsmäßig wieder an Bedeutung. Das wird die Tourismusentwicklungen in den kommenden Monaten tendenziell wieder dämpfen.
Beim Vergleich zur jeweiligen Vorjahreswoche ergaben sich im zweiten Quartal 2021 aufgrund eines ausgeprägten Basiseffektes stark positive Wachstumsraten (grüne Linie in der Grafik, siehe methodische Erläuterungen weiter unten). Die Basiseffekte werden wieder zunehmend schwächer und in Kalenderwoche 35 lag die Wirtschaftsleistung rund 4 % über dem Wert der entsprechenden Vorjahreswoche.
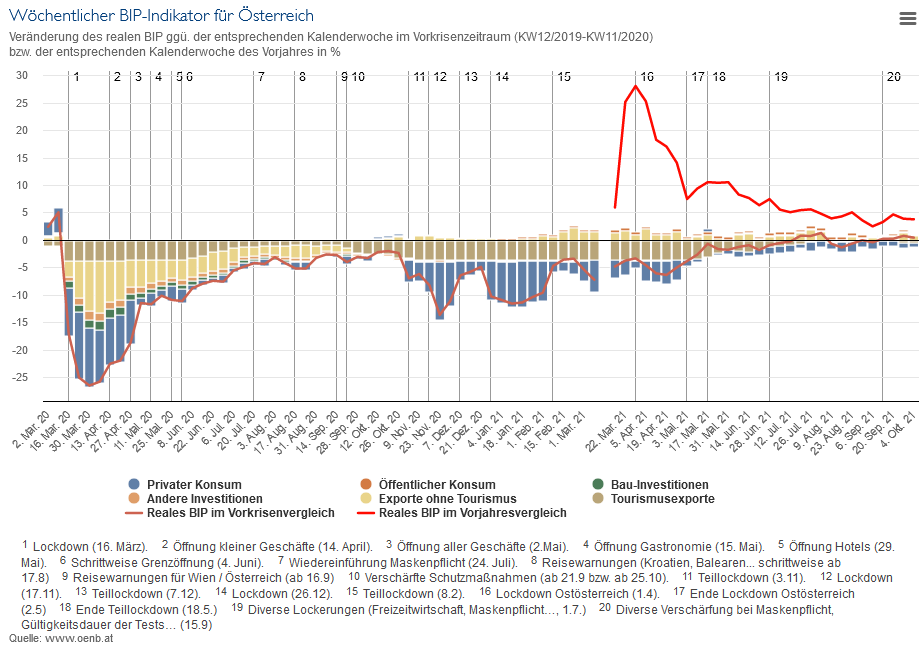
Die interaktive Grafik [funktioniert nur online und] ist durch die Auswahl eines zeitlichen Bereichs zoombar (mit gedrückter linker Maustaste einen Bereich auswählen). Die ursprüngliche Darstellung kann durch „Reset Zoom“ wiederhergestellt werden. Des Weiteren können einzelne Komponenten des BIP-Indikators durch Drücken des entsprechenden Legendeneintrags ein- bzw. ausgeblendet werden.
QUELLE: https://www.oenb.at/Publikationen/corona/bip-indikator-der-oenb.html
SIEHE DAZU:
Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB für die Kalenderwochen 36 bis 40
QUELLE: https://www.oenb.at/dam/jcr:2cd9d702-f1c0-499e-9d1b-f8abfb7f6726/woechentlicher_bip-indikator_KW_36_bis_40_2021.pdf
Daten zum wöchentlichen BIP-Indikator für KW 36 bis 40 (XLSX, 0,1 MB)
QUELLE: https://www.oenb.at/dam/jcr:a0f65a52-4729-4b50-a6ed-4d80b2c700b6/daten_bip-indikator_KW_36-40_2021.xlsx
OeNB-Exportindikator: Exporte im August und September weiterhin deutlich über Vorkrisenniveau
Ergebnisse des OeNB-Exportindikators vom Oktober 2021 – OeNB, 14.10.2021
Laut aktueller Veröffentlichung von Statistik Austria lagen die österreichischen Güterexporte im Juli 2021 nominell um 10,4 % über dem Wert des Vorjahresmonats. Damit war das Exportwachstum nur geringfügig schwächer als im Rahmen des letzten OeNB-Exportindikators erwartet wurde (+11,4 %).
Gemäß den aktuellen Ergebnissen des auf LKW-Fahrleistungsdaten basierenden OeNB-Exportindikators konnte das hohe Niveau der Exporte im August und September (+0,6 % bzw. ‑1,2 % zum Vormonat, saison- und arbeitstägig bereinigt) gehalten werden. Im Jahresabstand ergibt sich ein Wachstum von 17,3 % bzw. 13,5 % (nicht bereinigt). Vergleicht man die Monate August und September 2021 mit den entsprechenden Monaten des Vorkrisenjahres 2019, so zeigt sich, dass der Wert der Exporte (bereinigt um Arbeitstagseffekte) um 10,0 % bzw. 8,3 % darüber liegt. Dieser Effekt dürfte zur Gänze auf ein höheres Exportvolumen zurückzuführen sein. Für das dritte Quartal liegen zwar noch keine Daten vor, aber im zweiten Quartal 2021 sind die Güterexportpreise gegenüber dem zweiten Quartal 2019 um lediglich 0,6 % gestiegen.
Die derzeit verfügbaren Vorlaufindikatoren gaben im September uneinheitliche Signale. Die von der Europäischen Kommission monatlich erhobene Einschätzung der Auftragsbestände ist im September auf -0,1 Punkte gesunken, nachdem sie von Juni bis August auf hohen Werten zwischen fünf und sechs Punkten lag. Der Index der Exportauftragseingänge lt. Unicredit Bank Austria hat hingegen leicht zugelegt und lag im September bei 57,8 Punkten (nach 55,3 im August). Dieser Anstieg zeigt sich auch im Gesamtindex des Einkaufsmanagerindex und spiegelt ein temporäres Anziehen der Industriekonjunktur wider. Dies dürfte auf die Abarbeitung von aufgestauten Auftragsrückgängen zurückzuführen sein. Im Gegensatz zu Entwicklung in Österreich haben die Einkaufsmanagerindizes für die Europäische Union im September ihren Abwärtstrend fortgesetzt. In Summe deuten die Vorlaufindikatoren auf eine Abschwächung der österreichischen Exportkonjunktur im vierten Quartal hin.
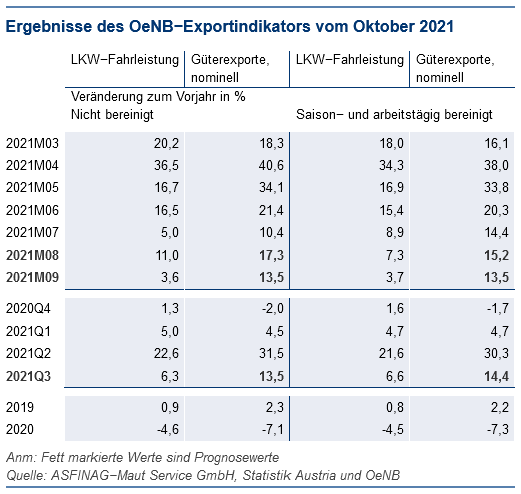
QUELLE: https://www.oenb.at/Geldpolitik/Konjunktur/oenb-exportindikator.html
Steuerreform für 2022 bis 2024 – Ersteinschätzung des WIFO – WiFo, 8.10.2021
Im Rahmen der Pressekonferenz zur Konjunkturprognose für 2021 und 2022 am 8. Oktober 2021 präsentierte WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr auch eine Ersteinschätzung zur Steuerreform für 2022 bis 2024.
Die österreichische Bundesregierung hat Anfang Oktober 2021 eine umfangreiche Steuerreform beschlossen. Diese umfasst einerseits eine substanzielle Abgabenentlastung: Im Vollausbau, der ab 2025 erreicht sein wird, werden die Abgaben insgesamt um knapp 7,8 Mrd. € (1,6% des BIP) gesenkt, die Nettoentlastung beträgt rund 6,1 Mrd. € (1,2% des BIP). Wird die bereits 2020 implementierte Senkung des Eingangssteuersatzes in der Lohn- und Einkommensteuer berücksichtigt, beträgt die Bruttoentlastung ab 2025 etwa 9,5 Mrd. € (1,9% des BIP), netto sinken
die Abgaben um knapp 7,8 Mrd. € (1,6% des BIP). Andererseits werden einige der bestehenden strukturellen Ungleichgewichte im österreichischen Abgabensystem beseitigt. So wird Mitte 2022 eine CO2-Bepreisung eingeführt. Gleichzeitig werden ab Mitte 2022 untere Einkommen (bis zu einem Bruttomonatseinkommen von 2.500 €) durch eine gestaffelte Senkung der Krankenversicherungsbeiträge um bis zu 1,7 Prozentpunkte für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Pensionisten und Pensionistinnen sowie die Erhöhung des Kindermehrbetrages entlastet, während die mittleren und oberen Einkommen von einer Reduktion der Einkommensteuersätze für die zweite Tarifstufe (ab Mitte 2022) und die dritte Tarifstufe (ab Mitte 2023) sowie einer
Anhebung des Familienbonus profitieren.
Ein zentrales Element der Steuerreform ist die Einführung einer CO2-Bepreisung, als ein weiterer Schritt in der erforderlichen Ökologisierung des Abgabensystems. Wie im nationalen deutschen Emissionshandelssystem soll der Preis für 2022 30 € je t CO2 betragen und bis 2025 schrittweise auf 55 € je t CO2 angehoben werden. Ab 2026 soll der fixe Preis durch den Marktpreis in einem Emissionshandelssystem abgelöst werden. Die Einführung der CO2-Bepreisung ist ein wichtiger Schritt für die Erreichung der Klimaziele, aufgrund des relativ niedrigen Preisniveaus ist hier jedoch kurzfristig nur von einer geringen Lenkungswirkung (Emissionsreduktion) auszugehen. In Hinblick auf die Dringlichkeit der Klimakrise wäre insbesondere ein deutlich ambitionierterer Anstieg des Preispfades wünschenswert gewesen. Die Preisdifferenz zum Emissionshandel für Industrie und Energieerzeugung ist zudem groß, was dem Prinzip eines einheitlichen Preises für negative Externalitäten widerspricht.
Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollen an Haushalte über einen regional differenzierten Klimabonus rückvergütet werden. Die Differenzierung umfasst vier Stufen und spiegelt die Qualität des öffentlichen Verkehrs sowie die Siedlungsdichte wider. 2022 soll der Klimabonus für alle Erwachsenen 100 € p. a. in der niedrigsten und 200 € p. a. in der höchsten Stufe betragen, Kinder erhalten jeweils die Hälfte. Er soll in den Folgejahren entsprechend des Anstiegs des CO2-Preises erhöht werden. Durch die CO2-Bepreisung wird es in den nächsten Jahren zu einem höheren Anstieg der Verkehrsausgaben der Haushalte in Regionen mit schlechter Anbindung an den öffentlichen Verkehr kommen, wodurch ein höherer Klimabonus in schlecht erschlossenen, ländlichen Gebieten in einem Übergangszeitraum prinzipiell nachvollziehbar ist. Die konkrete Definition der Klimabonusstufen ist allerdings zu diskutieren. Oberstes Ziel muss es sein, begleitend zur schrittweisen Erhöhung des CO2-Preises den öffentlichen Verkehr österreichweit – aber prioritär in den derzeit wenig oder überhaupt nicht erschlossenen Gebieten – zu verbessern, da die CO2-Bepreisung nur so ihre volle Lenkungswirkung entfalten kann. Die Klassen sollten entsprechend der zukünftigen Entwicklung des öffentlichen Verkehrs angepasst werden.
Um den Anreiz zum Umstieg auf klimafreundlichere Verkehrsmittel zu verstärken, wäre über eine Befristung des Klimabonus zu diskutieren. Eine soziale Differenzierung des Klimabonus ist nicht vorgesehen, was Fragen bezüglich der sozialen Treffsicherheit aufwirft. Allerdings wäre eine zusätzliche Differenzierung administrativ schwierig umzusetzen.
Für Unternehmen soll es ähnlich wie in Deutschland Entlastungen für Härtefälle sowie für von Carbon Leakage betroffene Sektoren geben; auch die Landwirtschaft soll für die Zusatzbelastung für den Agrardiesel entlastet werden. Auch in diesen Bereichen wäre zu überlegen, Maßnahmen zur Abfederung von Belastungen zeitlich zu befristen, um die Anreize zum Umstieg auf klimafreundlichere Antriebssysteme und Produktionsweisen zu erhalten.
Im Lohn- und Einkommensteuertarif wird der Steuersatz in der zweiten Tarifstufe (zwischen 18.000 € und 31.000 € zu versteuerndes Einkommen) Mitte 2022 von 35% auf 30% gesenkt, Mitte 2023 folgt die Senkung des Steuersatzes in der dritten Tarifstufe (zwischen 31.000 € und 60.000 €) von 42% auf 40%. Bereits 2020 war der Eingangssteuersatz von 25% auf 20% gesenkt worden.
Der neue gestaltete Steuertarif wird nicht automatisch entsprechend der Inflation angepasst („Steuertarif auf Rädern“), somit wurde die kalte Progression nicht abgeschafft. Bei der aktuellen Einkommensverteilung und unter dem aktuellen Steuertarif löst jeder Prozentpunkt Inflation knapp 300 Mio. € zusätzlicher Steuereinnahmen aufgrund der kalten Progression aus. Um eine konstante Steuerbelastung der realen Einkommen zu erzielen, sind somit regelmäßige Anpassungen im Steuertarif notwendig.
Ob die aktuelle Entlastung durch die Steuerreform nur die vergangene kalte Progression ausgleicht oder ob es sich um eine tatsächliche (temporäre) Entlastung handelt, hängt wesentlich von der Referenzgröße ab. In den vergangenen Jahren schwankte der Anteil der Lohn- und Einkommensteuereinnahmen zwischen 7,7% und 9% mit einem nur leicht ansteigenden Trend.
Nimmt man diesen längerfristigen Durchschnitt als Referenz, so entlastet die aktuelle Steuerreform deutlich mehr als die akkumulierte vergangene kalte Progression. Geht man jedoch von den jeweiligen Werten nach den Steuerreformen als Referenzgröße aus, kann argumentiert werden, dass die aktuelle Steuersenkung nur eine Abgeltung von vergangener kalter Progression ist. In Anbetracht der deutlich erhöhten Inflationserwartungen für die nächsten beiden Jahren erhöht sich der Druck für eine automatische Indexierung der Tarifstufen bzw. verkürzt sich das Intervall für die Notwendigkeit der nächsten Steuerreform. Bei der Forderung nach
einer Abschaffung der kalten Progression ist jedoch auch noch zu berücksichtigen, dass sämtliche vergangenen Steuerreformen nicht nur die Tarife verändert haben, sondern dass auch Umverteilungsziele implementiert wurden. Eine automatische Indexierung würde den fiskalischen Spielraum für diese Reformaspekte jedenfalls reduzieren.
Die kürzlich präsentierte Steuerreform erhöht durch verschiedene Maßnahmen die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Die meisten Maßnahmen treten Mitte 2022 in Kraft und sind 2022 daher noch nicht voll wirksam. Bei früheren Lohn- und Einkommensteuersenkungen und Änderungen der Sozialbeiträge konnten keine Vorzieh- bzw. Erwartungseffekte festgestellt werden, sodass keine Auswirkungen vor dem tatsächlichen Wirksamwerden der Maßnahmen unterstellt werden. Zudem entlasten einige der Maßnahmen (Tarifänderung der zweiten und dritten Stufe, Ausweitung des Familienbonus) Haushalte mit mittleren und oberen Einkommen stärker, nur die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge sowie die Anhebung des Kindermehrbetrages zielt auf die unteren Einkommen ab. Erstere haben eine geringere Konsumquote, sodass erfahrungsgemäß ein großer Teil der Einkommenserhöhung gespart wird. Der Konsumeffekt wird in den mittleren und oberen Einkommenssegmenten 2022 aber auch konjunkturbedingt geringer ausfallen.
Die Lockdowns im Zuge der COVID-19-Pandemie führten bei Haushalten, die keine krisenbedingten Einkommensausfälle verzeichneten, zu Zwangssparen und Konsumstau. Dieser löst sich nun allmählich auf; für 2022 wird ein äußerst hoher Zuwachs des realen privaten Konsums von 6% erwartet. Damit wird aber vor allem der Kriseneinbruch kompensiert, die krisenbedingten Ersparnisse werden dadurch noch nicht abgetragen. Eine weitere Erhöhung der Nettoeinkommen durch die Steuerreform in dieser Phase wird das bereits sehr hohe Konsumwachstum daher nicht nennenswert weiter beschleunigen, sondern hauptsächlich erneut in die Ersparnisbildung fließen.
Wegen des angenommenen geringen zusätzlichen Konsumeffektes durch die steuerliche Entlastung der privaten verfügbaren Haushaltseinkommen und den Klimabonus ist für 2022 daher auch kaum ein zusätzlicher Preisauftrieb zu erwarten. Aus der CO2-Bepreisung dürfte sich im ersten Jahr ein kleiner Inflationseffekt von rund 0,15 Prozentpunkten ergeben.
Von der Senkung der Körperschaftsteuer ab 2023 sind im kommenden Jahr kaum vorgezogene Investitionen zu erwarten, da diese bereits von der Investitionsprämie und der Einführung der degressiven Abschreibung angeregt wurden. Zudem dämpft das derzeitige Niedrigzinsumfeld die Investitionswirkungen einer Körperschaftsteuersenkung, da Fremdkapital äußerst günstig bleibt. Gleichwohl kann ein reduzierter Körperschaftsteuersatz die Eigenfinanzierungskraft der Unternehmen stärken und über verbesserte Ertragserwartungen Investitionen anregen. Die mittelfristig erwartete konjunkturelle Abschwächung wird jedoch die Investitionsanreize dämpfen.
Vor diesem Hintergrund ist der Zeitpunkt der Körperschaftsteuersatz-Reduktion als positiv zu bewerten, denn 2023 werden die expansiven Effekte der Investitionsprämie auslaufen. Aufgrund der erwarteten geringen zusätzlichen privaten Konsum- und Investitionsgüternachfrage ist folglich für 2022 auch kein nennenswerter zusätzlicher Effekt für das Wirtschaftswachstum zu erwarten.
Insgesamt beinhaltet die beschlossene Steuerreform einige wichtige Ansätze zur Verbesserung der Struktur des österreichischen Abgabensystems: neben dem Ausgleich der kalten Progression sind dies insbesondere die Reduktion der hohen Abgaben auf Arbeit für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie der Einstieg in eine CO2-Bepreisung. Dennoch bleiben wesentliche Strukturdefizite bestehen, die auch für die Zukunft Handlungsbedarf implizieren. So sind Schritte zur Senkung der Lohnnebenkosten für Unternehmen unerlässlich, ebenso wie die Fortsetzung der Bemühungen der letzten Jahre, Arbeitseinkommen gerade im unteren Einkommensbereich
zu entlasten. Der Spielraum für solche Entlastungen kann durch den Abbau von Steuerausnahmen in der Einkommen- und Umsatzsteuer, die stärkere Nutzung bestimmter vermögensbezogener Steuern (eine zeitgemäß ausgestaltete Grundsteuer sowie eine Erbschafts- und Schenkungssteuer) sowie umweltbezogener Steuern ebenso wie einen ambitionierteren CO2-Preispfad vergrößert werden. Dazu gehört auch die Einschränkung ökologisch schädlicher Steuerausnahmen und Förderungen (wie etwa Diesel- und Dienstwagenprivileg sowie die Ökologisierung der Pendlerförderung), die auch deshalb forciert werden sollte, um die Lenkungswirkungen der CO2-Bepreisung zu unterstützen.
Da die Schuldenquote in den kommenden Jahren aufgrund des erwarteten kräftigen Wachstums sowie der weiterhin sinkenden Zinsbelastung relativ rasch abnehmen wird, bestehen kurzfristig Spielräume für die vorgesehene umfangreiche Abgabensenkung, ohne die Verschuldungsvorgaben zu gefährden. Allerdings ist mittelfristig ein erheblicher Investitionsbedarf in einer Reihe wichtiger Zukunftsbereiche (Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz, Kinderbetreuung) gegeben. Zudem ist der demografische Wandel mit steigenden Ansprüchen an die öffentlichen Haushalte verbunden, insbesondere in den Bereichen Alterssicherung, Langzeitpflege und Gesundheitswesen. Die Bundesregierung sollte daher unverzüglich die bestehenden Effizienzpotentiale im öffentlichen Sektor nutzen, um mittel- und langfristig die fiskalische Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen nicht zu gefährden. Besonders relevante Ansatzpunkte sind eine effizientere Gestaltung des föderalen Systems, des Fördersystems und des Gesundheitswesens sowie die forcierte Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters.
Die vollständige Presseunterlage von Josef Baumgartner, Jürgen Bierbaumer, Stefan Ederer, Gabriel Felbermayr, Serguei Kaniovski, Claudia Kettner-Marx, Simon Loretz, Stefan Schiman und Margit Schratzenstaller steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
QUELLE: https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?content-id=1487278189573&rel=de&j-cc-node=news&j-cc-id=1621537952821&reserve-mode=active
LANGFASSUNG (4-Seiten-PDF): https://wifo.ac.at/wwadocs/News/Presseunterlage_Steuerreform_2022-2024_2021_10_08.pdf
Bargeld bleibt weiterhin beliebtestes Zahlungsmittel im Handel – Kontaktlose Kartenzahlungen in der Pandemie signifikant gestiegen – Trend bei Kartenzahlungen beschleunigt – Kleinbeträge werden in bar bezahlt – Allgemeines zur Zahlungsmittelumfrage 2020 – OeNB, 13.10.2021
Die COVID-19-Pandemie hat rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher dazu bewegt, ihr Zahlungsverhalten anzupassen. „Die Pandemie hat unseren Alltag, unsere Arbeitsweise, aber besonders das Konsum- und Zahlungsverhalten der österreichischen Bevölkerung signifikant verändert. Laut jüngster repräsentativer Erhebung der OeNB im Jahr 2020 haben kontaktlose Kartenzahlungen im stationären Handel wesentlich an Bedeutung gewonnen“, sagt Eduard Schock, Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und zuständig für den baren und unbaren Zahlungsverkehr in der Notenbank.
Die Bargeldnutzung ist während der Pandemie um 13 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019[1] zurückgegangen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Anteil des Gesamtwertes der Transaktionen am Point of Sale (POS), der sich von 58 % im Jahr 2019 auf 51 % verringert hat. Trotz einem sehr hohen Zahlungskartenbesitz (97 %) bleibt Bargeld in Österreich weiterhin mit 66 % aller Transaktionen am POS das beliebteste Zahlungsmittel der in Österreich lebenden Menschen.
*** Trend bei Kartenzahlungen beschleunigt ***
Insgesamt scheint die Pandemie aber den Trend zu Kartenzahlungen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern beschleunigt zu haben. Transaktionen mit Debitkarten verzeichnen im Vergleich zu 2019 einen anteilsmäßigen Zuwachs von 10 Prozentpunkten auf 27 %; mit Kreditkarten wurden dagegen lediglich 2 % der Zahlungen abgewickelt. Andere unbare Zahlungsmittel kommen im stationären Handel dagegen kaum zum Einsatz. So wurden lediglich 0,7 % der Transaktionen mit dem Mobiltelefon (z. B. Apple Pay, Blue Code) bezahlt. Erwartungsgemäß ist dieser Anteil bei den unter 30-Jährigen am höchsten und sinkt mit zunehmendem Alter.
Starker Anstieg bei kontaktlosen Debitkartenzahlungen
Der Anteil kontaktloser Debitkartenzahlungen ohne PIN-Eingabe ist gegenüber Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem Jahr 2019 von damals 28 % deutlich um 16 Prozentpunkte gestiegen. „Wir nehmen an, dass dieser Anstieg auf eine gewisse Unsicherheit während der Pandemie und auf die Vereinfachung dieser Zahlungen durch die Erhöhung des Transaktionslimits von 25 EUR auf 50 EUR zurückzuführen ist“, meint Direktor Eduard Schock. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass die Gefahr einer COVID-19-Ansteckung über Bargeld äußerst gering ist.
*** Kleinbeträge werden in bar bezahlt ***
Zusätzlich zeigte die Untersuchung einen Rückgang von Kleinbetragszahlungen unter 10 EUR, die zumeist noch mit Banknoten und Münzen getätigt werden. „2019 waren noch 40 % aller Transaktionen am POS unter 10 EUR, dieser Anteil ist im Jahr 2020 auf 33 % gesunken. Der Anteil der Transaktionen zwischen 10 EUR und 50 EUR stieg hingegen während der Pandemie um sechs Prozentpunkte auf 51 % an. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Werte nach dem Ende der Pandemie weiter entwickeln werden“, meint Matthias Schroth, zuständiger Direktor der OeNB-Hauptabteilung für Bargeld, Beteiligungen und interne Dienste.
*** Zahlungsmittel beim Online-Kauf ***
In der vorliegenden Umfrage geben rund 62 % der Befragten an, in den letzten 12 Monaten Produkte im Internet gekauft oder bezahlt zu haben. Darüber hinaus bestätigt fast ein Drittel der Befragten, seit Beginn der Pandemie deutlich (11 %) oder etwas (19 %) mehr im Internet eingekauft zu haben – allerdings hatte nur knapp 1 % der Befragten zum ersten Mal überhaupt einen Online-Kauf durchgeführt. Etwa die Hälfte (48 %) gibt an, ihr Online-Kaufverhalten nicht verändert zu haben.
Im Online-Handel kommen als anteilsmäßig häufigstes Zahlungsmittel Überweisungen (31 %) bzw. Internetbezahlverfahren (25 %) wie z. B. PayPal und Klarna zum Einsatz. Rund ein Fünftel der Online-Transaktionen wurde mit Kredit- (15 %) oder Debitkarten (6 %) abgewickelt, gefolgt von Lastschriftverfahren mit einem Anteil von 11 %. Bei immerhin 5 % der Bestellungen zahlten die Befragten bar, etwa via Nachnahme bei Lieferung der Ware.
Gleichzeitig ist der Anteil jener, die sich für die Erhaltung von Bargeld in seiner derzeitigen Form aussprechen, in Österreich weiterhin hoch (65 %) und hat sich auch durch COVID-19 kaum verändert. „Daher wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Wahlfreiheit ihres Zahlungsmittels garantieren“, betont OeNB-Direktor Schock, „und setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Bargeld sowie eine flächendeckende Versorgung der österreichischen Bevölkerung ein.“
*** Allgemeines zur Zahlungsmittelumfrage 2020 ***
Im Rahmen des OeNB-Barometers ließ die OeNB bereits zum fünften Mal durch das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) eine österreichweite Umfrage zum Zahlungsverhalten privater Haushalte (Frauen und Männer ab dem 15. Lebensjahr) durchführen. Die Studie besteht aus zwei Teilen: einem Fragebogen zum Zahlungsverhalten (Teil 1) und einem Zahlungstagebuch (Teil 2). Die Feldphase erstreckte sich mit Unterbrechungen von Anfang September 2020 bis April 2021. Die Ergebnisse sind repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundesland für das Zahlungsverhalten der in Österreich lebenden Personen. Insgesamt wurden 2.552 Personen befragt, wovon knapp die Hälfte (1.260) das Zahlungstagebuch für sieben Tage ausgefüllt hat.
QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20211012.html
SIEHE DAZU:
Christiane Dorfmeister, Dominik Höpperger, Andrea Pölzlbauer, Codruta Rusu:
Bargeld immer noch gefragt, kontaktlose Kartenzahlungen auf dem Vormarsch – OeNB-Studie liefert neue Erkenntnisse über Zahlungsverhalten während COVID-19-Pandemie – OeNB, 13.10.2021
*** Hat die COVID-19-Pandemie zu einer drastischen Änderung des Zahlungsverhaltens der Österreicherinnen und Österreicher geführt? ***
Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Neuauflage einer OeNB-Studie aus dem Jahr 2016, in der das Zahlungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher erneut untersucht wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass Bargeld zwar immer noch das beliebteste Zahlungsmittel am POS (Point of Sale) in Österreich bleibt, aber auch, dass vor allem kontaktlose Kartenzahlungen massiv an Bedeutung gewonnen haben. Die COVID-19-Pandemie hat den Trend zu unbaren Zahlungsmitteln noch beschleunigt.
*** Allgemeines zur Zahlungsmittelumfrage 2020 ***
Im Rahmen des OeNB-Barometers ließ die OeNB bereits zum fünften Mal durch das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) eine österreichweite Umfrage zum Zahlungsverhalten privater Haushalte (Frauen und Männer ab dem 15. Lebensjahr) durchführen. Die Studie besteht aus zwei Teilen: einem Fragebogen zum Zahlungsverhalten (Teil 1) und einem Zahlungstagebuch (Teil 2). Die Feldphase erstreckte sich mit Unterbrechungen von Anfang September 2020 bis April 2021. Die Ergebnisse sind repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundesland für das Zahlungsverhalten der in Österreich lebenden Personen. Insgesamt wurden 2.552 Personen befragt, wovon knapp die Hälfte (1.260) das Zahlungstagebuch für sieben Tage ausgefüllt hat.
*** Anmerkungen zur Methode ***
…
*** Hauptergebnisse: Bedeutung der COVID-19-Pandemie ***
Die Interpretation der Ergebnisse der Zahlungsmittelstudie 2020/2021 muss jedenfalls vor dem Hintergrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen erfolgen. Laut der jüngsten Konsumerhebung von Statistik Austria1 sind die Konsumausgaben im Zeitraum März bis Juni 2020 um 13,5 % niedriger als im Jahresdurchschnitt. Betroffen davon waren erwartungsgemäß vor allem jene Sektoren, die aufgrund der COVID-19-Maßnahmen ihre Geschäftstätigkeit vorübergehend einstellen mussten: Gastronomie (–55,9 %), Geschäfte für Bekleidung (–30,3 %), Ausgaben für Dienstleistungen und Mobilität wie für Sport-, Kultur- oder Freizeitveranstaltungen (‑41,4 %), Körper- und Schönheitspflege (–38,7 %) und Treibstoff (–32,5 %). Insgesamt brach laut OeNB-Prognose der private Konsum im vergangenen Jahr massiv um 9,4 %2 ein. Unter den genannten betroffenen Branchen ist in der Gastronomie, dem Bekleidungs- und auch im Freizeit- und Kultursektor die Bargeldnutzung verhältnismäßig sehr hoch.
Rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher gibt außerdem an, während der COVID-19-Pandemie weniger Bargeld verwendet zu haben. Die überwiegende Mehrheit davon beabsichtigt, dies auch nach Ende der COVID-19-Krise beizubehalten. Dabei waren schriftliche Hinweise an der Kassa, Durchsagen im Supermarkt oder Medienberichte bzw. andere Informationshinweise für rund ein Fünftel der Befragten ausschlaggebend, öfter ein anderes Zahlungsmittel verwendet zu haben. …
QUELLE (inkl. Schaubilder): https://www.oenb.at/Presse/thema-im-fokus/bargeld-kartenzahlungen.html
Forschungsdaten: Neues „Mikrodatenzentrum“ im Ministerrat beschlossen – Statistik Austria stellt Daten zur Verfügung – Forschungseinrichtungen dürfen Daten nicht speichern Science-APA, 13.10.2021
Der Startschuss zur angekündigten Forschungsdaten-Plattform bei der Statistik Austria unter dem Titel „Austrian Micro Data Center“ (AMDC) wurde am Mittwoch im Ministerrat auf den Weg gebracht. Mit der Einrichtung soll nach dem Jahreswechsel begonnen werden, im ersten Jahr 2022 sind für das AMDC 505.000 Euro vorgesehen. Der Datenzugang „soll ausschließlich auf wissenschaftliche Zwecke beschränkt sein“ und alle Datenschutzvorgaben erfüllt werden.
Für die Etablierung des bereits im Regierungsprogramm angekündigten Vorhabens sind Änderungen im Bundesstatistik- und dem Forschungsorganisationsgesetz notwendig. Im Vorfeld hatte es zahlreiche Stellungnahmen zu dem Gesetzesentwurf gegeben. Während die Initiative von Wissenschaftseinrichtungen einhellig begrüßt wurde, meldeten etwa Datenschutzorganisationen Bedenken an.
Die Grundidee besteht darin, dass über die bei der Statistik Austria angesiedelte neue Plattform jene öffentlichen „Register“, die dort schon ausgewertet werden, auch für die Grundlagenforschung zur Verfügung stehen. Beim neuen „Mikrodatenzentrum“ soll der Zugang zu „verknüpfbaren anonymisierten“ Registerdaten „ausschließlich auf wissenschaftliche Zwecke beschränkt sein“, heißt es im Ministerrats-Vortrag. Die Statistik Austria „hat die Daten für den Zugang so aufzubereiten, dass von der wissenschaftlichen Einrichtung die Daten nicht einem Unternehmen oder einer natürlichen Person zugeordnet werden kann“.
*** Statistik Austria stellt Daten zur Verfügung ***
Österreich vollziehe hier einen Schritt, den andere innovative Forschungsnationen bereits seit längerem gesetzt hätten, heißt es in den Erläuterungen zu den Novellen. Zugang etwa auf Informationen aus dem Melderegister oder dem Bildungsstandregister beantragen können wissenschaftliche Einrichtungen, wie Universitäten und andere Hochschulen, sowie zum Beispiel die Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Austrian Institute of Technology (AIT), Wirtschaftsforschungsinstitute, die Gesundheit Österreich GmbH oder Forschungsabteilungen in der öffentlichen Verwaltung bzw. die Nationalbank oder der Budgetdienst des Parlaments.
Die Statistik Austria stellt im ersten Schritt die von ihr selbst erhobenen Informationen für die Forschung zur Verfügung. In weiterer Folge könnten zusätzliche staatliche Datenbanken folgen. Dazu braucht es eine Verordnung des Wissenschaftsministeriums in Kooperation mit dem für das Register zuständigen Ministerium.
*** Forschungseinrichtungen dürfen Daten nicht speichern ***
Bei einem Antrag einer Forschungsinstitution mit einer konkreten Forschungsfrage erstellt die Statistik Austria einen speziell darauf zugeschnittenen Datensatz. Informationen aus verschiedenen Quellen, die verknüpft werden, erhalten eine Art Stempel, der den Forschern die Zuordnung zueinander erlaubt, ohne dass auf konkrete Personen oder Firmen rückgeschlossen werden kann. Die Daten werden in einem eigenen Online-Arbeitsraum nur dem Antragsteller zur Verfügung gestellt. Die Daten verbleiben trotz des virtuellen Zuganges bei der Statistik Austria, die Berechnungen machen die Wissenschafter per Fernzugriff. Die Vertreter der Forschungseinrichtung dürfen die Daten nicht bei sich lokal speichern oder abfotografieren. Verstöße werden strafrechtlich sanktioniert und können je nach Schwere auch zu einem Ausschluss der Forschungsorganisation selbst führen, heißt es.
Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wertet die Einführung des AMDC, für das die Kosten im Jahr 2025 auf 552.000 Euro steigen sollen, als „wichtigen Meilenstein für die empirisch arbeitende Forschung“. Man habe „die Balance gefunden zwischen der Sicherstellung des Datenschutzes und der Nutzung wertvoller Informationen, um eine evidenzbasierte Politik zu fördern und der Wissenschaft Akzente zu ermöglichen.“
Für den Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas, hat „gerade die Corona-Pandemie gezeigt, dass bei der Datenlage in Österreich durchaus Luft nach oben besteht“. Mit dem AMDC werde „ein wichtiger Schritt für die empirische Wirtschafts- und Sozialforschung in Österreich und auch für mehr evidenzbasierte Entscheidungen in der Politik“ gesetzt, so der Chef der Bundesanstalt, deren fachliche Leitung durch die Gesetzesnovellen in ihrer Unabhängigkeit gestärkt werden soll. Außerdem wird durch die Neuerungen die verstärkte Nutzung neuartiger Daten aus digitalen Quellen, wie etwa aus computergestützten Warenwirtschaftssystemen (Scannerdaten) oder Verkehrsüberwachungssystemen, sowie Satellitendaten oder Daten zur Nutzung des Internets, von Telekommunikation oder Energie zur Statistikproduktion geregelt.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/7251581301226237215
KOMMENTARE AUS FREMDEN FEDERN
Paola Subacchi: Finanzkrise «Made in China» – Kann China die Evergrande-Krise eindämmen und verhindern, dass ihre Folgen die globalen Finanzmärkte belasten? – Wie das Fed 2008 – Regierung interveniert regelmässig – Schaden für den Renminbi – Wird das Rettungsnetz halten? – Project Syndicate / Finanz & Wirtschaft, 12.10.2021
Während sich der Internationale Währungsfonds und die Weltbank auf ihre Jahrestagung am Donnerstag und Freitag vorbereiten, richten sich alle Augen auf Evergrande, Chinas zweitgrössten Immobilienentwickler, der offenbar nicht in der Lage ist, seine Schulden in Höhe von 300 Mrd. $ bei Banken, Anleihengläubigern, Mitarbeitern und Lieferanten zurückzuzahlen. Da der Immobilienriese am Rande des Bankrotts steht, ist die Welt gezwungen, ein Szenario in Betracht zu ziehen, das sie zuvor nie ernsthaft in Erwägung gezogen hat: eine Finanzkrise «Made in China».
Beobachter haben schnell Parallelen zwischen dem Evergrande-Debakel und früheren Krisen gezogen. Einige vergleichen es mit dem Zusammenbruch der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers 2008, der eine massive Banken- und Finanzkrise ausgelöst hatte. Andere erinnern an den Beinahezusammenbruch des Hedge Fund Long-Term Capital Management 1998, der nur durch eine Rettungsaktion des Fed zum Schutz der Finanzmärkte abgewendet werden konnte. Wieder andere verweisen auf den Zusammenbruch der japanischen Immobilienblase in den Neunzigerjahren.
In all diesen Fällen führte die Kombination aus übermässiger Verschuldung und überbewerteten Vermögenswerten zu Instabilität. Aufgrund der Besonderheiten des chinesischen Banken- und Finanzsystems, das von der Politik und nicht von den Märkten bestimmt wird, bietet jedoch keiner dieser Fälle einen wirklichen Einblick in die Situation im Haus Evergrande.
*** Regierung interveniert regelmässig ***
Während ein Land wie die USA eine Rettungsaktion durchführen kann, wenn ein finanzieller Zusammenbruch bevorzustehen scheint, interveniert China regelmässig auf den Kapitalmärkten und toleriert nur wenige Risiken für die finanzielle Stabilität. Chinas Währungsbehörden sind daher sehr versiert im Umgang mit den finanziellen Schwierigkeiten inländischer Unternehmen, schützen die in Not geratenen Unternehmen vor einer Ansteckung, sorgen für niedrige Kreditkosten und bieten selektive Rettungsmassnahmen an.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich die chinesischen Behörden in der Planung solcher Rettungsaktionen mit der Frage herumschlagen, ob ein Unternehmen wirklich too big to fail ist, wie es die US-Behörden in den Tagen vor dem Konkurs von Lehman Brothers taten. China würde lieber ein moralisches Risiko eingehen, als die Finanzstabilität zu gefährden.
Daher kann man wohl davon ausgehen, dass China sich einschalten wird, um den Zusammenbruch von Evergrande zu verhindern. Dennoch wird dieser Vorfall in Chinas Wirtschaft zwei grosse Spuren hinterlassen.
*** Schaden für den Renminbi ***
Erstens wird das Vertrauen ausländischer Investoren, die nicht geschützt sind, einen kleinen Schlag erleiden, besonders auf Chinas Offshore-Kreditmarkt, der den Risiken von Evergrande besonders ausgesetzt ist. Die Renditen von Chinas Junk-Dollar-Anleihen sind auf etwa 15 % gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit etwa einem Jahrzehnt.
Seit seiner Einrichtung 2010 ist der Offshore-Markt für Chinas Strategie, den Renminbi zu einer liquiden und frei verwendbaren internationalen Währung zu machen, von zentraler Bedeutung, da er die Umgehung der inländischen Kapitalkontrollen ermöglicht. Ausländische Investoren sind jedoch äusserst vorsichtig, was den Handel mit auf Renminbi lautenden Vermögenswerten auf diesem Markt angeht. Die Evergrande-Saga wird ihre Bedenken zumindest vorläufig noch verstärken und China zwingen, seine Renminbistrategie zu überdenken.
Die zweite Narbe wird sich Chinas Realwirtschaft zuziehen. Auf den Immobiliensektor entfallen fast 30% des chinesischen BIP, verglichen mit 19% in den USA. Die Wertschöpfung des Immobiliensektors trägt etwa 6,5% zum chinesischen BIP bei. Berücksichtigt man die indirekten Beiträge, wie z.B. die Anlageinvestitionen, so ist der Beitrag des Sektors zum chinesischen Wachstum sogar noch grösser.
*** Wie das Fed 2008 ***
Die Implosion von Evergrande könnte daher schwerwiegende Folgen für Beschäftigung und Wachstum haben. Sollte sie einen Rückgang der Aktien- und der Immobilienpreise auslösen – Wohnimmobilien machen immerhin 78% des chinesischen Vermögens aus, verglichen mit 35% in den USA –, könnten auch das Vertrauen der Konsumenten und damit die Nachfrage Schaden nehmen.
Die Frage ist, ob China in der Lage sein wird, die Evergrande-Krise einzudämmen und zu verhindern, dass ihre Folgen auf die globalen Finanzmärkte übergreifen. Bislang hofft man jedenfalls, dass es das Problem einzudämmen vermag. Selbst wenn Evergrande zusammenbricht, so die Logik, ist das chinesische Banken- und Finanzsystem robust und widerstandsfähig genug, um dies zu verkraften. Darüber hinaus wäre die politische Reaktion auf eine allfällige Instabilität höchstwahrscheinlich wirksam und würde in Geschwindigkeit und Umfang dem Vorgehen des Fed im Jahr 2008 zur Stützung des US-Bankensystems entsprechen. Mehrere politische Instrumente, einschliesslich geld- und fiskalpolitischer Lockerungen, stehen zur Verfügung.
Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die politische Reaktion nicht hinter den Ereignissen zurückbleibt, da politische Erwägungen das Handeln behindern könnten. In diesem Fall würde der Rest der Welt die Auswirkungen zu spüren bekommen.
*** Wird das Rettungsnetz halten? ***
Seit der globalen Finanzkrise von 2008 hat sich Chinas Finanzsystem zu einem der grössten der Welt entwickelt, mit Finanzanlagen in Höhe von fast 470% des BIP. Es hat sich durch Investitionsströme und direkte Kreditvergabe stärker mit dem Rest der Welt verflochten. Doch obwohl das chinesische Finanzsystem inzwischen systemrelevant ist, ist nicht klar, ob das internationale Finanzsicherheitsnetz – das von multilateralen Finanzinstitutionen, besonders dem IWF, bereitgestellt wird – ausreichend ausgeweitet wurde, um dies zu berücksichtigen.
Dieses Sicherheitsnetz beläuft sich derzeit auf schätzungsweise 2,7 Bio. $ (auf der Grundlage der sofort verfügbaren Finanzmittel, ohne die im Voraus gebundenen Mittel). Das ist weniger als die Devisenreserven Chinas, die derzeit etwa 3,2 Bio. $ betragen. Würde dies ausreichen, um im Fall einer systemischen Krise «Made in China» eine Katastrophe abzuwenden? Würden die USA – der Hauptanteilseigner des IWF – überhaupt zustimmen, dass der Fonds angemessene Hilfe und Mittel zur Verfügung stellt, um eine solche Krise zu bewältigen?
Zum Glück ist dieses Szenario noch unwahrscheinlich, doch es ist nicht von vornherein auszuschliessen – denn wie viele unwahrscheinliche Ereignisse sind in den letzten zwei Jahrzehnten eingetreten? Zumindest sollte uns die Evergrande-Krise aus unserer Selbstgefälligkeit in Bezug auf globale Finanzrisiken aufrütteln. Wir müssen unsere Widerstandsfähigkeit verbessern, statt die multilaterale Finanzarchitektur zu politisieren. Wenn China von einer systemischen Finanzkrise getroffen wird, müssen wir wissen, wer einspringen wird, um den Rest der Welt zu retten, und wie.
PAOLA SUBACCHI ist Professorin für internationale Wirtschaft am Queen Mary Global Policy Institute der Universität London.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/eine-finanzkrise-made-in-china/
DOSSIER – ÖSTERREICHISCHE REGIERUNGKRISE UND KANZLERROCHADE, TEIL 2
INHALT
- Quellenmaterial
- ANORDNUNG DER DURCHSUCHUNG UND DER SICHERSTELLUNG VOM 23.9.2021
- VERNEHMUNGSPROTOKOLL SEBASTIAN KURZ VOM 5.9.2021
Live-Berichterstattung - Liveticker: Misstrauensanträge der Opposition abgelehnt – ORF, 12.10.2021, 9:43 bis 16:02
- Live-Blog: So geht es nach dem Rücktritt von Kurz weiter – Kabinett Schallenberg im Parlament – APA/Vienna.at, 7.10.2021, 15:47 bis 12.10.2021, 15.55
- Live-Blog – ORF – 9.10.2021, 19:10 bis 22:48
Kommentare pars pro toto - Matthias Strolz: Warum Sebastian Kurz nie mehr Kanzler wird und ein kollektiver Heilungsprozess beginnt – Ein Volk führt sich ins Verderben, wenn Korruption, Lüge und Kaltschnäuzigkeit als gesellschaftlicher Standard installiert werden – Auf Strich und Faden angelogen – Narzissmus oder Entschlossenheit? – Korrupter Lebenswandel
Meldungen in chronologischer Abfolge - Korruptionsaffäre: Dokumentiert: Die Chat-Protokolle der Causa Kurz – Wie schwerwiegend sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Sebastian Kurz und andere Beschuldigte? – Der Standard, 16.10.2021
- CAUSA KURZ: DIE #CHATPROTOKOLLE. Eine Lesung des Burgtheater-Ensembles – Burgtheater / Youtube, 16.10.2021
- ÖVP-Affäre: WKStA hat Kurz-„Auslieferung“ beantragt – ORF, 14.10.2021
- Debatte: Was kommt auf die ÖVP noch zu? – debatte.ORF, 14.10.2021
- Kurz als Abgeordneter angelobt – Opposition übt scharfe Kritik an Budgetentwurf – „Größte Mogelpackung der Zweiten Republik“ – Blümel verteidigte Budget – „Ansage in Richtung Zukunft“ – ORF, 14.10.2021, 9:31 und 12:01
- ÖVP-Affäre: Meinungsforscherin Beinschab enthaftet – Daten „in größerem Umfang“ gelöscht? – Bis vor Kurzem Umfragen veröffentlicht – Schlagabtausch Opposition – ÖVP – „Keinerlei Informationsweitergabe“ – „Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? – Meinungsforscher distanzieren sich von Beinschab – „Mutmaßlicher Kriminalfall schockierend“ – ORF, 14.10.2021, 9.12 und 10:42
- Schallenberg in der ZIB2: Politisch „ganz starker Konsens“ mit Kurz – Auf „erfahrene“ Köpfe verlassen – „Schallenberg will Vertrauen wieder herstellen“ – „Wieder in die Substanz kommen“ – ORF, 13.10.2021
- DEBATTE: ÖVP-Affäre: Welche Folgen hat der Rückzug von Kurz? – debatte.ORF, 12.10.2021
- Blümel hält Budgetrede im Nationalrat – ORF, 12.10.2021, 23:06
- ÖVP-Affäre: Nach Festnahme Debatte über Razzien – „Keinerlei Informationsweitergabe“ – „Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? – WKStA: Keine Informationen „zu laufenden Ermittlungen“ – Warten auf weitere Vorgangsweise – ORF, 12.10.2021, 21:43
- NR: Schallenberg entschuldigt sich für „Weglegen“ von Akten – ORF, 12.10.2021, 16:53
- Meinungsforscherin festgenommen – Weitere Entwicklung noch offen – „Die Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? – Das „Beinschab-Österreich-Tool“ – „Die Kosten packst Du dann in die Studie“ – Von 2016 bis 2020 587.400 Euro – Suche nach Studien im Finanzministerium – ORF, 12.10.2021, 12:21/17:12
- Antritt und Abrechnung: Selten intensiver Tag im Nationalrat – Aufregung nach Kollaps – Scharfe Attacken auf Kurz und Schallenberg – Bild der Skrupellosigkeit – Wöginger lobt Kurz – SPÖ-„Dringliche“ an Blümel – Linhart bekennt sich zu starker EU – ORF, 12.10.2021, 16:52
- Sitzung des Nationalrates am 12.10.2021 – Mediathek / Parlament.at, 12.10.2021
Regierungserklärung: Schallenberg will Kurz-Kurs halten – Will eng mit Kurz zusammenarbeiten – Kogler würdigt ÖVP ausdrücklich – Kogler stärkt Justiz den Rücken – Dringliche Anfrage zum „System Kurz“ – ORF, 12.10.2021, 12:10 - Regierungserklärung von Bundeskanzler Alexander Schallenberg – Bundeskanzleramt / Youtube, 12.10.2021
- Mikl-Leitner: „Chats nicht so stehen lassen“ – „Allen voran Niederösterreich verpflichtet“ – NOe.ORF.at, 12.10.2021, 11:44
- Ruf nach Handylöschverbot für Amtsträger – ORF, 12.10.2021, 11:07
- Platter rückt von Kurz ab – Häme und Kritik der Opposition – Häme und Kritik der Opposition – ORF, 12.10.2021, 9:52
- Mikl-Leitner stellt sich erneut hinter Kurz – noe.ORF.at, 8.10.2021, 14:12
…oooOOOooo…
Quellenmaterial
– ANORDNUNG DER DURCHSUCHUNG UND DER SICHERSTELLUNG VOM 23.9.2021
Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung … /1683 – Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstafsachen und Korruption, 23.9.2021 / Beschluss der Anordung am 29.9.2021 / Anordnung der Durchführung am 4.10.2021 [Die Hausdurchsuchungen erfolgten am Mittwoch, dem 6.10.2021]
QUELLE (104-Seiten-PDF): https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3piZKDZjZGbF9IRQ2X9/view
– VERNEHMUNGSPROTOKOLL SEBASTIAN KURZ VOM 5.9.2021
Vernehmungsprotokoll Sebastian Kurz vom 5.9.2021
QUELLE: https://drive.google.com/file/d/1CxC16RX392STtKpmjeitqlMYfnDJrnmR/view
Live-Berichterstattung
Liveticker: Misstrauensanträge der Opposition abgelehnt – ORF, 12.10.2021, 9:43 bis 16:02
QUELLE: https://orf.at/live/5097-Misstrauensantraege-der-Opposition-abgelehnt/
Live-Blog: So geht es nach dem Rücktritt von Kurz weiter – Kabinett Schallenberg im Parlament – APA/Vienna.at, 7.10.2021, 15:47 bis 12.10.2021, 15.55
QUELLE: https://www.vienna.at/live-blog-so-geht-es-nach-dem-ruecktritt-von-kurz-weiter/7152265
Live-Blog – ORF – 9.10.2021, 19:10 bis 22:48
QUELLEN: https://orf.at/live/5095-Kurz-kuendigt-Rueckzug-aus-Kanzleramt-an/
Kommentare pars pro toto
Matthias Strolz: Warum Sebastian Kurz nie mehr Kanzler wird und ein kollektiver Heilungsprozess beginnt – Ein Volk führt sich ins Verderben, wenn Korruption, Lüge und Kaltschnäuzigkeit als gesellschaftlicher Standard installiert werden – Auf Strich und Faden angelogen – Narzissmus oder Entschlossenheit? – Korrupter Lebenswandel – Kommentar der anderen / Der Standard, 10.10.2021
Der ehemalige Neos-Chef Matthias Strolz analysiert in einem Gastkommentar den Rückzug Sebastian Kurz‘.
Schritt für Schritt. Es werden schwierige Monate für Österreich. Wir brauchen als Bürgerinnen und Bürger gute Nerven, Großmut, Geduld und einen scharfen Blick
Die türkis-grüne Koalition wird weitermurksen. Ein wechselseitiges Vertrauen als gemeinsame Basis gibt es nicht mehr. Es wird ein Einander-Belauern und -Verletzen, manchmal werden auch gemeinsame Dinge gelingen. Schlussendlich werden wir 2022 neu wählen.
Sebastian Kurz ist als Kanzler Geschichte. Es wird ihm nicht gelingen, in dieses Amt zurückzukehren. Dies will er noch nicht akzeptieren. Das kann man nach menschlichem Ermessen auch nicht erwarten – psychologische Verdauungsprozesse dieser Art brauchen Zeit. Diese wird er und seine Partei bekommen.
Die Kurz-Gang will nicht weichen. Auch das ist nachvollziehbar. Wohin sollen sie gehen? Einige von ihnen werden schlussendlich für Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit womöglich ins Gefängnis wandern, andere ins Ausland. Sämtlichen Top-RepräsentantInnen droht die soziale Beschämung.
*** Auf Strich und Faden angelogen ***
Auch für die Kurz-Wählerinnen und Wähler ist es nicht einfach, sich einzugestehen, dass sie auf Strich und Faden getäuscht und angelogen, ja missbraucht wurden. Manche werden daher von ihrem Trugbild vorerst nicht ablassen, manche nie. Dieses Verhalten ist ein Echo auf andere Enttäuschungen oder gar Lebenslügen, die uns als Menschen so passieren; oder wir zulassen.
Mit Sebastian Kurz wurde eine Kunstfigur Kanzler. Diese Figur hat nun tiefe Risse, die über die Zeit weit aufklaffen werden. Die Einblicke in das Innere, die wir dabei erhalten, werden in den kommenden Monaten und Jahren für viel Enttäuschung, Beklemmung und Wut sorgen. Weite Teile des Landes werden sich in einer Art Katerstimmung befinden. Es wartet ein kollektiver Trauer- und Heilungsprozess auf uns. Wie konnte uns das passieren – schon wieder!? (vgl. Haider, Grasser, Strache … um nicht noch weiter in die Vergangenheit zu gehen).
*** Narzissmus oder Entschlossenheit? ***
Narzissmus verbirgt sich gerne hinter gespielter Freundlichkeit, Genialität und Entschlossenheit. Aber es gilt Abraham Lincolns Erkenntnis: „Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen.“ Immer mehr Leute erkennen, dass die Menschenverachtung der Kurz-Gang auch für sie persönlich gilt.
Die erste Welle der Einblicke offenbarte uns im Frühjahr wilde Aggressions- und Dominanzfantasien gepaart mit Erniedrigungspraktiken und Unterwerfungsgesten (Vergleiche: die Frauen als „leicht steuerbare Weiber“; „ich liebe meinen Kanzler“; abfällige Erpressung von Würdenträgern der Kirche, mit denen sie vordergründig gerne Hochglanzfotos machen). Die überhöht erotisch geladenen Chat-Verläufe zeigten, dass hier Politik aus rein kompensatorischen Ego-Motiven und pathologischer Bedürftigkeit betrieben wird.
Schlüssel zur persönlichen Macht
Es wird immer klarer: Es sind politisch Halbstarke, einer Regierung unwürdig. Die Freundlichkeit und das Zuhören sind gespielt – nach Maßgabe von Optimierung und Professionalität. Die neue Welle an Chats lässt erkennen: Kurz & Co halten auch die Wählerinnen und Wähler für „Arsch“ und „(alte) Deppen“. Erträglich sind die Leute in Stadt und Land für sie nur, weil sie den Schlüssel zur persönlichen Macht und Karriere repräsentieren. Die Überambitionierten sind auf Stimmenmaximierung angewiesen, um ihre persönlichen Machtfantasien zu befriedigen.
Ob ihrer Kaltschnäuzigkeit und Brutalität war es in ihrer Welt dann auch nur logisch, die Wahlen 2017 und 2019 mit illegalen (gerichtlich bestätigt) und mutmaßlich korrupten Praktiken zu bestreiten. Folglich ist es in weiteren Schritten gleichsam zwingend, so weit wie möglich die demokratische Mühsal abzustreifen. Der Weg in den autoritären Staat hat bei Kurz & Co keinen ideologischen Hintergrund, sondern rein karriereoptimierendes Kalkül. Daran lässt sich erahnen, wie egal ihnen Land und Leute sind.
*** Korrupter Lebenswandel ***
Doch unsere liberale Demokratie ist resilient genug, all diese Erschütterungen auszuhalten. Wir als Bevölkerung sind klar genug, um zu begreifen, dass sich ein Volk selbst ins Verderben führt, wenn wir diese krankhafte Übersteigerung des Machtanspruchs zulassen, wenn wir Korruption, Lüge und Kaltschnäuzigkeit als gesellschaftlichen Standard installieren. In Alltagskategorien gegossen: Was sollten wir unseren Kindern sagen, wenn sie sich einem korrupten und verlogenen Lebenswandel zuwenden? Sie würden uns antworten: „Aber das macht man doch so. Damit – und nur damit – ist man doch erfolgreich, oder!?“
Der gesunde Menschenverstand, der uns innewohnende Gemeinschaftssinn und die menschliche Instanz des Gewissens sagen uns, dass wir in diesem Zustand nicht ankommen wollen – weder individuell noch kollektiv. Und daher wird Sebastian Kurz nie mehr Kanzler werden.
MATTHIAS STROLZ ist Unternehmer und Autor. Er war von 2012 bis 2018 Chef der Neos.
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000130321299/warum-sebastian-kurz-nie-mehr-kanzler-wird-und-ein-kollektiver
Meldungen in chronologischer Abfolge
Renate Graber, Fabian Schmid: Korruptionsaffäre: Dokumentiert: Die Chat-Protokolle der Causa Kurz – Wie schwerwiegend sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Sebastian Kurz und andere Beschuldigte? – Der Standard, 16.10.2021
Auf 104 Seiten hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Hausdurchsuchungen in Bundeskanzleramt, Finanzministerium und in der ÖVP-Zentrale begründet. Gegen zehn Beschuldigte wird strafrechtlich ermittelt. Grundlage der Vorwürfe sind Chatnachrichten, die die Beteiligten miteinander ausgetauscht haben. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Hier dokumentieren wir die relevantesten (und orthografisch unveränderten) Chatnachrichten aus den Ermittlungsakten. Zu Ihrer eigenen Meinungsfindung, aber auch zum Teilen mit Freunden, die sich noch nicht in der Tiefe mit den Vorwürfen befasst haben.
Verfahrenskomplex Inseratenaffäre
Im Rahmen der Ermittlungen zu dieser Causa fanden am 6. Oktober die aufsehenerregenden Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, in der Parteizentrale der Bundes-ÖVP und im Finanzministerium statt. Der Verdacht, es sei zu Inseratenkorruption in Medien der Brüder Fellner gekommen, richtet sich auch gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Ermittlungen basieren auf hunderten Chats, die bei der Auswertung von Thomas Schmids Handys aufgepoppt waren. Neben Kurz, dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, und Pressesprechern im Finanzministerium spielen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (vor und nach ihrer Amtszeit zwischen Dezember 2013 und Dezember 2017 Meinungsforscherin) sowie deren langjährige Mitarbeiterin B. wichtige Rollen. B. soll die Umfragen durchgeführt haben.
All das soll bereits 2016 begonnen haben, heißt es in der Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu den Hausdurchsuchungen.
Über Familienministerin Karmasin nimmt das Team rund um Kurz 2016 Kontakt zu Wolfgang und Helmuth Fellner auf. Laut WKStA wollen die Beteiligten eine Medien- und Inseratenkooperation eingehen und Umfragen finanzieren, die von Karmasins Ex-Mitarbeiterin B. erstellt werden sollen. Karmasin selbst zögert anfangs noch, weshalb Schmid den Ex-ÖVP-Chef Michael Spindelegger („Spindi“) auf sie ansetzt. Dann übernimmt Kurz selbst. Die WKStA wird das später folgendermaßen einordnen: Kurz habe Karmasin „zur Tathandlung überredet“.
[In der Folge werden Chats wiedergegeben und kurz kommentiert.]
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000130406824/dokumentiert-die-chat-protokolle-der-causa-kurz
SIEHE DAZU:
=> SONNTAGSFRAGE: Absturz: ÖVP im Umfrage-Keller – Strache mit 34 % top – Kern besser als »Django« – OE24 (Österreich), 7.1.2021
Wäre heute Sonntag eine Nationalratswahl, die FPÖ von Heinz-Christian Strache würde sie locker gewinnen. In der aktuellen Research-Affairs-Umfrage für ÖSTERREICH (500 Interviews vom 3. 1. –5. 1. 2017) käme die FPÖ auf 34 Prozent. Das ist Platz 1, auch wenn die Strache-Partei einen Punkt im Vergleich zum Dezember 2016 verliert. Die SPÖ legt einen Punkt auf 27 % zu. Nicht gut geht es der ÖVP: Sie bleibt bei 18 %, bei einer Wahl wäre das historischer Tiefstand.
[Ab hier folgen Schaubilder und Text im Wechsel.]
„Welche Partei würden Sie bei einer Nationalratswahl wählen?“
ÖVP ist mit Personal-Debatten beschäftigt
Doch warum geht es den Schwarzen so schlecht? Research-Affairs-Chefin Sabine Beinschab: „Die ÖVP hat mit Abschaffung der kalten Progression oder Arbeitszeitflexibilisierung keine schlechten Themen. Allerdings ist sie zu sehr mit Personaldebatten beschäftigt.“ Man wisse nicht einmal, wer bei der nächsten Wahl antreten werde.
Tatsächlich hat der amtierende Parteichef Mitterlehner einen schweren Stand. ÖSTERREICH stellt „Django“ auf den Umfrage-Prüfstand: …
Im direkten Vergleich mit SPÖ-Kanzler Kern wird Mitterlehner in jeder Kategorie geschlagen: Kern sei demnach sympathischer, kompetenter. 45 % sagen, der SPÖ-Chef sitze fest im Sattel, bei Mitterlehner sind das nur 13 %. 57 % sehen Kern als nächsten Spitzenkandidaten, Mitterlehner nur 14 %. Eine Kanzlerwahl entschiede Kern mit 47 zu 12 % für sich. …
Research Affairs analysiert: ›VP würde von Kurz-Wechsel profitieren‹
ÖSTERREICH: Warum liegt die FPÖ so stabil vorne?
Sabine Beinschab: Die FPÖ hat leicht verloren – das könnte mit dem Konflikt zwischen Parteichef Strache und ORF-Moderator Armin Wolf zu tun haben, bei dem Strache nicht sehr kompetent aussah. Dass die FPÖ so gut liegt, liegt an der Schwäche der Koalition.
ÖSTERREICH: Aber die SPÖ konnte etwas zulegen.
Beinschab: Sie hat sich von der CETA-Diskussion erholt, Kanzler Kern konnte zuletzt mit Themen wie dem Pensions-Hunderter punkten.
ÖSTERREICH: Und die ÖVP?
Beinschab: Die ÖVP hat mit Abschaffung der kalten Progression oder Arbeitszeitflexibilisierung gute Themen. Aber sie ist mit Personaldebatten beschäftigt und liegt deshalb auf einem – man muss es so sagen – historischen Tiefstand.
Österreich: Wie sehr könnte ihr ein Wechsel zu Sebastian Kurz helfen?
[Hier bricht die Wiedergabe der Site ab.]
QUELLE: https://www.oe24.at/oesterreich/politik/absturz-oevp-im-umfrage-keller/264736058
CAUSA KURZ: DIE #CHATPROTOKOLLE. Eine Lesung des Burgtheater-Ensembles – Burgtheater / Youtube, 16.10.2021
Eine Kooperation von Der Standard & Burgtheater
ab 16.10.2021, 10 Uhr
Mit Regina Fritsch, Daniel Jesch, Christoph Luser, Dörte Lyssewski, Robert Reinagl & Nils Strunk sowie Chefredakteur Der Standard Martin Kotynek und Burgtheaterdirektor Martin Kušej
Videoproduktion: Der Standard
Redaktion: Der Standard
Künstlerische Umsetzung: Burgtheater
Korruption und Betrug – gegen Sebastian Kurz und weitere Beschuldigte ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie gründet ihre Vorwürfe auf Chat-Nachrichten. Wir lesen diese vor! Gemeinsam mit der STANDARD-Redaktion setzen wir die Chats in den Kontext. Damit Sie sich selbst ein Bild von all den Vorgängen machen können. Die Ensemblemitglieder des Burgtheaters Regina Fritsch, Daniel Jesch, Christoph Luser, Dörte Lyssewski, Robert Reinagl und Nils Strunk schlüpfen in die Rollen von Sebastian Kurz, Thomas Schmid und anderen.
QUELLE (19:31-min-Video): https://www.youtube.com/watch?v=jyof-WQQN58
ÖVP-Affäre: WKStA hat Kurz-„Auslieferung“ beantragt – ORF, 14.10.2021
Kaum angelobt, ist Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach Informationen der APA schon mit einem „Auslieferungsantrag“ der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) konfrontiert. Formal wird der Nationalrat ersucht, dass die Ermittlungen gegen den nunmehrigen ÖVP-Klubobmann fortgesetzt werden können.
Aus dem ÖVP-Klub hieß es dazu gestern Abend auf APA-Anfrage, dass man das Begehren nicht nur unterstütze, sondern auch froh darüber sei, dass dieses so rasch eingebracht worden sei. Dadurch werde es zügig die Möglichkeit geben, die Vorwürfe gegen Kurz zu widerlegen.
Die Erlaubnis zur Fortsetzung der Ermittlungen wird wohl schon in einer der kommenden Plenarsitzungen gegeben werden, da Kurz zum Zeitpunkt der Vorwürfe kein Abgeordneter war und damit kein Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Mandatar bestehen kann.
Ermittelt wird gegen den früheren Regierungschef wegen Untreue und Bestechlichkeit in der neuen Inseratenaffäre. Dazu gibt es Ermittlungen wegen falscher Zeugenaussage im U-Ausschuss. Kurz bestreitet alle Vorwürfe vehement.
Graf wegen Maskenverstoßes „ausgeliefert“
Der Nationalrat beschloss unterdessen die „Auslieferung“ des freiheitlichen Abgeordneten Martin Graf. Zustimmung kam nur von den Koalitionsfraktionen. Ersucht um die Zustimmung zur behördlichen Verfolgung hatte der Wiener Magistrat wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232778/
Debatte: Was kommt auf die ÖVP noch zu? – debatte.ORF, 14.10.2021
Gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen Umfeld laufen Ermittlungen, in der Inseraten-Causa gab es zuletzt eine Festnahme. Bald wird neben der Justiz auch ein parlamentarischer U-Ausschuss den Fall untersuchen. Was bedeutet das für die Türkisen? Was kommt auf die ÖVP noch zu?
QUELLE: https://debatte.orf.at/stories/1818634/
Kurz als Abgeordneter angelobt – Opposition übt scharfe Kritik an Budgetentwurf – „Größte Mogelpackung der Zweiten Republik“ – Blümel verteidigte Budget – „Ansage in Richtung Zukunft“ – ORF, 14.10.2021, 9:31 und 12:01
Der Donnerstag steht im Nationalrat ganz im Zeichen der Debatte über das am Mittwoch von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vorgestellte Budget. In einer besonders pünktlich begonnenen Sitzung wurde gleich am Anfang Altkanzler und Neo-Klubobmann Sebastian Kurz (ÖVP) als Abgeordneter angelobt.
Als erster Redner hieß ihn der nunmehr stellvertretende ÖVP-Klubobmann August Wöginger willkommen. Mit einem Donnerstagfrüh veröffentlichten Facebook-Video nahm Kurz zuvor erstmals seit seinem Rückzug als Kanzler am Wochenende öffentlich Stellung. Er sprach von einer „emotionalen Achterbahnfahrt für viele“ in den vergangenen Tagen mit Gefühlen von „Enttäuschung, Resignation, Wut“.
Das könne er „sehr gut nachvollziehen“. Auch ihm sei es so gegangen. Es gehe nun um eine stabile Regierung, deshalb habe er am Wochenende einen Schritt zur Seite gemacht. „Ich bin kein Schattenkanzler“, so Kurz. Er wolle als Klubobmann seinen Beitrag leisten und die Arbeit der Regierung unterstützen.
Kurz erwähnte auch die Vorwürfe gegen sich, ohne auf Details einzugehen. Es seien einige Chatnachrichten im Umlauf, „die ich nie geschrieben habe“. Zu denen, die er selbst geschrieben hatte, meinte er: „Ich verstehe absolut, dass man an den Bundeskanzler besondere Erwartungen hat, was die Wortwahl betrifft. Aber genauso wie ich zu Hause nicht im Anzug herumlaufe, bin ich nicht nur Politiker, sondern auch ein Mensch – mit Fehlern und Emotionen. Ja leider auch mit Formulierungen, die ich öffentlich nicht verwenden würde. Ich habe mich bereits öffentlich entschuldigt und ich bedauere sie auch.“
Diese Chats würden nun gezielt an die Öffentlichkeit gespielt, um der Volkspartei zu schaden. Kurz: „Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nicht irgendetwas Strafrechtliches zuschulden kommen lassen.“ Das werde er auch beweisen. Er kritisierte, dass seiner Ansicht nach die Chats mit strafrechtlichen Vorwürfen vermischt würden. Die Vorwürfe wolle er nun entkräften.
Offen bleibt, wie Kurz seine Rolle als Klubobmann anlegen will. Er bat in dem Video jedenfalls um Unterstützung. Diese muss er auch aktiv suchen, denn der Rückhalt in den Ländern schwand in den vergangenen Tagen. Der „Kurier“ (Donnerstag-Ausgabe) berichtete, dass Kurz am Dienstag und Mittwoch stundenlang mit den ÖVP-Landeschefs und hohen ÖVP-Funktionären in den Ländern telefoniert habe.
Als Abgeordneter genießt Kurz zunächst Immunität. Das Parlament kann aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein Parlamentarier der Justiz ausgeliefert wird. Zudem hatte Kurz angekündigt, auf seine Immunität verzichten zu wollen.
*** Opposition übt scharfe Kritik an Budgetentwurf ***
Die türkis-grüne Koalition bekam für Budget und Steuerreform reichlich Kritik zu hören. Die SPÖ sprach in der Ersten Lesung von vergebenen Chancen, die FPÖ von einer Mogelpackung und NEOS von erstaunlicher Ambitionslosigkeit. Gänzlich anders sah das am Tag nach Blümels Budgetrede die Koalition. Das Budget wandert nun in den Budgetausschuss. Im Plenum beschlossen wird es im November.
„Dieses Budget wäre eine Chance gewesen. Diese Chance wurde vergeben“, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Weichen zu stellen oder sich den großen Herausforderungen der Zeit zu stellen sei in diesem Haushalt nicht abgebildet. Auch würden die arbeitenden Menschen nicht entlastet, vielmehr müssten sie sich die Steuerreform selber zahlen. „Eine wirkliche Entlastung sieht anders aus“, außerdem komme sie zu spät.
*** „Größte Mogelpackung der Zweiten Republik“ ***
FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sprach erneut von der „größten Mogelpackung der Zweiten Republik“ und einem „Schwurbelbudget“. Die Erzählung von Entlastung und ökologischen Lenkungseffekten sei bar jeder Effizienz. Soziale Gerechtigkeit gebe es nicht, die Steuerreform bringe einer Mindestpensionistin gerade einmal 50 Cent pro Tag.
Den dringend notwendigen Teuerungsausgleich gebe es auch nicht, solle die Steuerreform doch erst Mitte nächsten Jahres starten. Geld werde nur für „sinnlose Inserate der Marke Selbstbeweihräucherung“ hinausgeworfen.
Auf Koalitionsseite sah man das naturgemäß anders. Wöginger meinte, das Budget sei „die Grundlage für die kommende Zeit“, sei nachhaltig, sichere Stabilität und unterstütze den Wirtschaftsaufschwung nach der Pandemie. „Hier wird jetzt Klimaschutz mit Hausverstand gemacht“, meinte er auch zur geplanten Steuerreform und lobte die Erhöhung des Familienbonus, die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge und der Körperschaftssteuer. Nur Positives konnte auch Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer erkennen, denn: „Wir investieren, wir modernisieren und wir reformieren.“
*** Blümel verteidigte Budget ***
Finanzminister Blümel verteidigte Mittwochabend in der ZIB2 seinen Budgetentwurf. Hauptthema sei die Steuerreform gewesen. Es seien nicht alle Probleme gelöst, man werde an den anderen Themen arbeiten. So soll auch die Abschaffung der kalten Progression noch in dieser Legislaturperiode erledigt werden.
Zur Kritik, der Preis für CO2 sei zu gering, um einen Klimaeffekt zu haben, meinte Blümel, bei der CO2-Bepreisung habe man zunächst einen Einstieg geschafft. Zudem werde eine Vielzahl von Förderungen finanziert, die ebenfalls Effekte haben würden. Schon in seiner Budgetrede zuvor im Nationalrat hatte Blümel gesagt, das Budget sei eine
*** „Ansage in Richtung Zukunft“ ***
Das Budget 2022 wandert nach der Ersten Lesung zur weiteren Behandlung inklusive Expertenhearing in den Budgetausschuss; im Plenum beschlossen werden soll es am 18. November.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232647/
ÖVP-Affäre: Meinungsforscherin Beinschab enthaftet – Daten „in größerem Umfang“ gelöscht? – Bis vor Kurzem Umfragen veröffentlicht – Schlagabtausch Opposition – ÖVP – „Keinerlei Informationsweitergabe“ – „Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? – Meinungsforscher distanzieren sich von Beinschab – „Mutmaßlicher Kriminalfall schockierend“ – ORF, 14.10.2021, 9.12 und 10:42
Die im Zusammenhang mit der ÖVP-Korruptionsaffäre um die Partei und Altkanzler Sebastian Kurz festgenommene Meinungsforscherin Sabine Beinschab ist enthaftet worden. Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag mitteilte, wurde kein Antrag auf U-Haft gestellt.
„In der Inseratenaffäre liegen bei der vor Kurzem festgenommenen Person die zum Zeitpunkt der Festnahme angenommenen Haftgründe nicht mehr vor“, sagte ein WKStA-Sprecher. Deswegen habe die WKStA vor Ablauf der 48-Stunden-Frist keinen U-Haft-Antrag gestellt.
Auf die Frage, ob es seit der Festnahme grundsätzlich weitere Ermittlungsschritte von der WKStA gegeben habe, sagte der Sprecher, dass in diesem Ermittlungsstadium die Ermittlungen nicht stillstünden, „weitere Zwangsmaßnahmen jedoch nicht gesetzt wurden“.
Beinschab war Dienstagfrüh an ihrer Privatadresse wegen Verdunkelungsgefahr festgenommen worden, wobei die Festnahmeanordnung ein Richter bewilligt hatte. Im Anschluss soll sie – offiziell nicht bestätigten – Informationen der APA zufolge im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) vernommen worden sein.
Dass vor der nunmehr erfolgten Enthaftung kaum bzw. keine gesicherten Informationen zur Einvernahme nach außen drangen, nährte in Anwaltskreisen Spekulationen, Beinschab könne sich womöglich auf die Kronzeugenregelung eingelassen haben und umfassend aussagen. Belege in diese Richtung gibt es aber nach wie vor nicht.
*** Daten „in größerem Umfang“ gelöscht? ***
Beinschab steht im Verdacht, gemeinsam mit ihrer Kollegin und Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin frisierte Umfragen für die Tageszeitung „Österreich“ erstellt zu haben, die Kurz bzw. der ÖVP zugutegekommen sein sollen. Zudem soll sie Scheinrechnungen gestellt haben. Damit werden ihr Beitragstäterschaft zu Untreue und Bestechung vorgeworfen. Für Beinschab gilt die Unschuldsvermutung.
Die Festnahme war offenbar wegen Verdunkelungsgefahr erfolgt: Beinschab soll am Tag vor der Hausdurchsuchung am Mittwoch vergangener Woche die Festplatte ihres Computers gelöscht haben – sie soll, wie die „Presse“ berichtete, „Serverdaten in größerem Umfang gelöscht“ haben. In Medien wurde nach dem „Presse“-Bericht die Frage aufgeworfen, ob die hinter der Affäre stehenden Hausdurchsuchungen vorab verraten worden sein könnten.
Beinschab ist Gründerin des Marktforschungsinstituts Research Affairs, das seit vielen Jahren die Umfragen für die Mediengruppe „Österreich“ durchgeführt hat. Die beschuldigte Gruppe um Ex-Kanzler Kurz nannte die Umfrageplatzierungen „Beinschab-Österreich-Tool“. Auch für alle weiteren Beschuldigten, darunter Karmasin, gilt die Unschuldsvermutung.
*** Bis vor Kurzem Umfragen veröffentlicht ***
Unklar ist bisher, inwieweit Beinschab in den vergangenen Jahren – also in jenen, die nicht mehr durch Chats dokumentiert sind – politisch gefällige Studienergebnisse geliefert hat. Dass sie weiterhin sowohl für das Finanzministerium als auch für die „Österreich“-Mediengruppe gearbeitet hat, ist bekannt. So veröffentlichte „Österreich“ etwa erst im August zwei Research-Affairs-Umfragen binnen einer Woche, wonach sich einmal 90 und einmal 69 Prozent aller Österreicher für die Abschiebung von straffälligen Afghanen aussprechen.
2020 und 2021 veröffentlichte Beinschab aber auch mehrere ihrer Ergebnisse selbst als Aussendung via OTS. Die Aussendungen haben Titel wie „ÖsterreicherInnen sprechen sich für den Ankauf von Sputnik V aus“, „ÖsterreicherInnen sprechen sich gegen eine Erleichterung des Zugangs zur Staatsbürgerschaft aus“ und „ÖsterreicherInnen sprechen sich klar für Druck auf unwillige Arbeitslose aus“ und decken sich im Wesentlichen mit ÖVP-Positionen bei damals aktuellen Debatten. Wer die Studien in Auftrag gegeben hat, geht aus den Aussendungen nicht hervor. Auf ihrer Website werden sie als „Eigenstudie“ bezeichnet.
*** Schlagabtausch Opposition – ÖVP ***
Auf das Gerücht, wonach die Hausdurchsuchungen vorab verraten worden sein könnten, folgte zuletzt ein Schlagabtausch zwischen Opposition und ÖVP, bei dem das Innenministerium jede Informationsweitergabe dementierte. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch forderte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) auf, sofort zu den im Raum stehenden Vorwürfen Stellung zu nehmen.
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sprach in Bezug auf den „Presse“-Artikel von einem „Skandal der Sonderklasse“: Es bestehe „kein Zweifel, dass die Meinungsforscherin den Tipp aus dem türkisen System hatte“. Stephanie Krisper von NEOS ortete ein „türkises System“ im Innenministerium – diese „Sümpfe“ müsse man „endlich trockenlegen“.
*** „Keinerlei Informationsweitergabe“ ***
Vonseiten des Ressorts habe es „keinerlei Informationsweitergabe“ gegeben, teilte das Innenministerium Dienstagabend in einer ORF.at vorliegenden Stellungnahme mit. Das Ministerium verwies auf die „besondere Stellung“ des bei der WKStA-Amtshandlung „unterstützend“ tätig gewesenen BAK. Durch das BAK-Gesetz verankert habe dieses „keinerlei Berichtspflicht innerhalb des Bundesministeriums für Inneres – auch nicht an die Ressortleitung“, so das Ministerium, dem zufolge das BAK zudem „erst kurzfristig vor den Durchsuchungen informiert“ worden sei.
Zur Verteidigung Nehammers war zuvor auch die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gabriela Schwarz ins Feld gezogen. Die am Mittwoch vergangener Woche erfolgten Hausdurchsuchungen seien „im Vorfeld durch Medienanfragen an ihre Partei publik geworden“, hieß es in einer Aussendung, in der Schwarz auch auf ihre eigene Pressekonferenz vom 28. September verwies.
„Wir haben tagelang unmissverständliche Anfragen von Journalistinnen und Journalisten über bevorstehende Hausdurchsuchungen im Umfeld der Volkspartei erhalten“, so Schwarz: „Dass SPÖ und FPÖ nun vereint versuchen, den Innenminister anzupatzen“, sei „nicht nur völlig realitätsfremd, sondern auch vollkommen absurd.“
*** „Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? ***
Hinweise auf eine anstehende Amtshandlung habe Beobachtern zufolge auch ein genauer Blick auf die Ordnungsnummern des Casinos-Ermittlungsaktes nahegelegt. Laut „Presse“ wurde der Termin für die Hausdurchsuchungen aber auch mehrfach verschoben. „Am 4. Oktober wurden Exekutive und Innenministerium informiert, dass die Razzia zwei Tage später stattfinden soll“, heißt es in der Zeitung.
Die „Presse“ berichtete zudem, dass es auch in der „Österreich“-Mediengruppe Versuche gegeben habe, Daten professionell löschen zu lassen. Mehrere Cybersecurity-Firmen seien angefragt worden, Daten aus Clouds und Messenger-Diensten zu löschen. Begründet wurde das mit einem Sicherheitsleck. Chefredakteur Niki Fellner sprach laut „Presse“ von einem „groben Missverständnis“. Man habe Ende August einen schwerwiegenden Fall von Cyberkriminalität im Haus entdeckt, bei dem versucht worden sei, hohe Rechnungsbeträge auf ein US-Konto umzuleiten. Ob Daten dann tatsächlich gelöscht wurden, ließ Fellner laut „Presse“ offen.
*** Meinungsforscher distanzieren sich von Beinschab ***
Der Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Österreichs (VdMI) distanzierte sich unterdessen von Beinschab. Weder sie noch Karmasin seien je VdMI-Mitglieder gewesen, so VdMI-Vorsitzende Edith Jaksch. Beinschab wollte vor Jahren Mitglied werden, sei aber abgelehnt worden.
„Die jetzt vorliegende Causa ist schockierend und erfordert eine Klarstellung unserer Branche. Weder die festgenommene Sabine Beinschab noch die als Beschuldigte geführte Sophie Karmasin waren je Mitglied beim VdMI, weder mit der BB Research Affairs GmbH noch der KARMASIN RESEARCH & IDENTITY GMBH“, teilte Jaksch in einer schriftlichen Stellungnahme mit.
*** „Mutmaßlicher Kriminalfall schockierend“ ***
Der „mutmaßliche Kriminalfall“ sei „schockierend“ und von der Branche zu trennen, so Jaksch. Der Fall untergrabe aber „in keiner Weise die Qualität und Seriosität unserer Branche“. „Unsere Qualitätskriterien sind streng, klar und verbindlich.“ Wer sich diesen Kriterien nicht in all seinen Marktforschungsprojekten unterwirft, könne kein Mitglied im VdMI werden.
Das Gallup-Institut erklärte unterdessen auf seiner Website „aus gegebenem Anlass“, dass Karmasins langjährige Mitarbeiterin Beinschab „wenige Monate nach dem Eigentümerwechsel des Instituts“ am 11. April 2015 „fristlos entlassen“ wurde. Gallup-Geschäftsführer Michael Nitsche, der das Institut von Karmasin übernommen hat, sagte dazu gegenüber der „Kronen Zeitung“: „Das hat nichts mit den aktuellen Ereignissen zu tun. Es gab andere gute Gründe. Aus arbeitsrechtlichen Gründen kann ich nicht ins Detail gehen.“
QUELLE: https://orf.at/stories/3232651/
Schallenberg in der ZIB2: Politisch „ganz starker Konsens“ mit Kurz – Auf „erfahrene“ Köpfe verlassen – „Schallenberg will Vertrauen wieder herstellen“ – „Wieder in die Substanz kommen“ – ORF, 13.10.2021
Neo-Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat in der ZIB2 seine viel kritisierten Aussagen, wonach er die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für falsch hält, verteidigt. Er habe großes Vertrauen, dass sich die Vorwürfe gegen Kurz in Luft auflösen werden, sagte Schallenberg. Sein Ziel sei jetzt, die Regierungsarbeit fortzusetzen und nach den turbulenten Tagen wieder Ruhe in die Innenpolitik zu bringen.
Zunächst musste sich Schallenberg aber vor allem den von Armin Wolf gestellten Fragen zum Verhältnis zu Altkanzler Kurz stellen. Er sei weiterhin „absolut“ der Meinung, dass die Vorwürfe falsch seien.
Das sei seine persönliche Meinung, damit nehme er die Ergebnisse der Ermittlungen nicht vorweg, und er sei auch der Meinung, dass es für einen Kanzler passend sei, sich derart zu äußern. Er habe aber „vollstes Vertrauen“ in die Justiz. Schallenberg hatte die umstrittenen Aussagen in seiner ersten kurzen Ansprache nach seiner Angelobung als Kanzler getätigt.
Auf die Frage, ob Kurz die moralische Integrität hat, um wieder Kanzler zu werden, antwortete Schallenberg mit „sicher“. Der neue Kanzler sieht auch keinen Grund, sich für die ÖVP-Chats, die Kurz zum Rücktritt gezwungen haben, zu entschuldigen, wie das Bundespräsident Alexander Van der Bellen getan hat. Spekulationen gab es darüber, wie lange Schallenberg im Amt des Bundeskanzlers bleiben werde – befeuert unter anderem durch einen Tweet der Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die schrieb, Schallenbergs Amt sei „zeitlich befristet“, bis die Vorwürfe gegen Kurz aufgeklärt seien. Später löschte Köstinger den Tweet wieder.
Die Frage, ob und wann Kurz wieder Kanzler werden könne, werde man aber dann beantworten, wenn eine Entscheidung anstehe, so Schallenberg in der ZIB2. Auch wenn er und Kurz völlig unterschiedliche Menschen seien, gebe es in der politischen Ausrichtung einen „ganz, ganz starken Konsens“. Als Kurz ihn gefragt hatte, ob er das Kanzleramt übernehmen wolle, habe er ein „gewisses Verantwortungsgefühl“ verspürt, die politische Krisensituation zu bewältigen. „Ich hatte das Gefühl, dass Nein für mich persönlich keine Option war“, so Schallenberg.
Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) im ORF-Interview mit Armin Wolf
ORF
Schallenberg arbeitet übrigens nicht im Kanzlerbüro von Kurz, dem berühmten Kreisky-Zimmer. Er bevorzugt einen helleren Ort. Der Kanzler ließ folglich allerdings keine Rückschlüsse auf seine politische Zukunft zu. „Nun, das ist persönlicher Geschmack“, sagte er. „Ich war schon, als ich in der Übergangsregierung Minister war, im anderen Trakt des Bundeskanzleramts. Da sind hellere Zimmer.“ Es sei „einfach eine persönliche Entscheidung“ gewesen.
*** Auf „erfahrene“ Köpfe verlassen ***
Auf die Frage, ob das „System Kurz“ jetzt weiterregiere, sagte Schallenberg, wenn man im „System Kurz“ das „Regierungsprogramm und die Leute, die das gewissenhaft umsetzen“, sehe, „dann ja.“ Weitere Rochaden, etwa bei Ministerinnen und Ministern sowie beim Personal, soll es nicht geben, ließ der Bundeskanzler durchblicken.
Mehrmals betonte Schallenberg, dass Kurz die Entscheidung zum „Schritt auf die Seite“ selbst getroffen habe und ihm diese „großen Respekt“ abringe. Veränderungen im Regierungsteam will Schallenberg nicht vornehmen, auch beim Mitarbeiterstab im Bundeskanzleramt will er sich auf „erfahrene Köpfe verlassen“, die auch der Regierungspartner kenne.
Änderungen würden nur weitere Unruhe bringen. Konkret angesprochen auf den Leiter der Stabsstelle Medien im Bundeskanzleramt, Gerald Fleischmann, und Kurz-Sprecher Johannes Frischmann sagte Schallenberg, dass sie sich nun im Urlaub befänden. Mehr wollte er dazu nicht sagen. Die beiden werden in der Inseratenaffäre als Beschuldigte geführt.
*** „Schallenberg will Vertrauen wieder herstellen“ ***
Schallenberg betonte, man sei weiter in einer innenpolitisch schwierigen Lage. Aber die Regierung habe beim Ministerrat in der Früh schon bewiesen, dass sie „handlungswillig und handlungsfähig“ sei, sagte er unter Verweis auf die Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).
Zu Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) habe er eine gute Gesprächsbasis. Es gebe beiderseitiges Bemühen, die Arbeit weiterzuführen. Dass das Vertrauen erschüttert worden sei und dass das nicht über Nacht verschwinde, sei klar. Das gelte es, Schritt für Schritt wiederaufzubauen, das sei auch eine Mammutaufgabe, so der Kanzler. Man muss dem Ganzen Zeit geben und schauen, dass sich „Staub und die Emotion“ legen.
*** „Wieder in die Substanz kommen“ ***
Es gelte jedenfalls, das Regierungsprogramm abzuarbeiten und „wieder in die Substanz“ zu kommen, so Schallenberg. Auf konkrete politische Fragen, etwa zur weiteren Bekämpfung des Coronavirus, Maßnahmen für den Arbeitsmarkt sowie das in den letzten Tagen vieldiskutierte Thema der Regierungsinserate und Medienförderung wollte sich Schallenberg noch nicht festlegen. Er sei erst kurz im Amt und werde das mit seinen Ministerinnen und Ministern besprechen.
In puncto Impfung sei „in Wirklichkeit doch jeder von uns einzeln aufgerufen“, Überzeugungsarbeit zu leisten. „Das kann nicht nur alleine die Bundesregierung betreffen“, so Schallenberg. Dennoch sprach er sich dafür aus, dass es weiterhin auch eine öffentliche Wahrnehmungskampagne geben müsse vonseiten der Bundesregierung, „um die Menschen dazu zu bringen, dass sie impfen gehen“.
Der Politologe Peter Filzmaier und die „profil“-Journalistin Eva Linsinger waren sich bei der Analyse im Anschluss des Interviews in der ZIB2 einig, dass Schallenberg seine Rolle als Kanzler noch finden müsse. Dazu gehöre auch, so Linsinger, sich von Kurz zu emanzipieren.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232627/
DEBATTE: ÖVP-Affäre: Welche Folgen hat der Rückzug von Kurz? – debatte.ORF, 12.10.2021
ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat in der durch Ermittlungen gegen ihn ausgelösten Regierungskrise die Konsequenzen gezogen. Er zog sich als Bundeskanzler zurück, bleibt aber als ÖVP-Klubobmann der Tagespolitik erhalten. Wie wird der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) mit Kurz als Klubobmann umgehen? Und was bedeutet das alles für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Rechtsstaat und Politik?
QUELLE: https://debatte.orf.at/stories/1818576/
Blümel hält Budgetrede im Nationalrat – ORF, 12.10.2021, 23:06
Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hält heute im Nationalrat seine zweite Budgetrede. Von der Regierung beschlossen wird der Finanzplan für 2022 und die kommenden Jahre davor im ersten Ministerrat mit dem neuen Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP).
Schwerpunkt des Budgets ist die ökosoziale Steuerreform mit dem CO2-Preis, dem Klimabonus und der Lohnsteuersenkung. Die Staatsschulden dürften dank des starken Wirtschaftswachstums deutlich rascherer sinken als erwartet.
Der Weg zur Budgetrede war einigermaßen holprig. Wegen der durch die Korruptionsermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausgelösten Regierungskrise war bis zum Wochenende nicht einmal klar, ob der Bundeshaushalt für 2022 überhaupt beschlossen wird. Damit wäre auch die Steuerreform in der Luft gehangen.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232438/
ÖVP-Affäre: Nach Festnahme Debatte über Razzien – „Keinerlei Informationsweitergabe“ – „Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? – WKStA: Keine Informationen „zu laufenden Ermittlungen“ – Warten auf weitere Vorgangsweise – ORF, 12.10.2021, 21:43
In der ÖVP-Inseratenaffäre gibt es mit der Festnahme der Meinungsforscherin Sabine Beinschab den nächsten Paukenschlag. Für Spekulationen sorgte im Anschluss das Schweigen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Auf die von Medien aufgeworfene Frage, ob die hinter der Affäre stehenden Hausdurchsuchungen vorab verraten worden sein könnten, folgte am Dienstagabend zudem ein Schlagabtausch zwischen Opposition und ÖVP.
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch forderte per Aussendung Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) auf, sofort zu den im Raum stehenden Vorwürfen Stellung zu nehmen. „Wenn sich herausstellt, dass Personen aus dem Innenministerium unter dem ehemaligen ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer bevorstehende Hausdurchsuchungen verraten haben, zeigt das einmal mehr, dass das türkise System alles versucht, um Aufklärung zu verhindern“, wie Deutsch mit Verweis auf einen entsprechenden Medienbericht weiter mitteilte.
Geht es nach FPÖ-Generalsekretär Karl Schnedlitz, liefere der hier angesprochene „Presse“-Artikel „einen Skandal der Sonderklasse“. Schnedlitz zufolge bestehe „kein Zweifel, dass die Meinungsforscherin den Tipp aus dem türkisen System hatte“. Zudem sei es „besorgniserregend zu beobachten, wie jeden Tag mehr Details über dieses türkise System an die Öffentlichkeit gelangen“, so Schnedlitz, demzufolge Nehammer „endgültig nicht mehr tragbar“ sei. Stephanie Krisper von NEOS ortet in diesem Zusammenhang ein „türkises System“ im Innenministerium – und diese „Sümpfe“ müsse man „endlich trockenlegen“.
*** „Keinerlei Informationsweitergabe“ ***
Vonseiten des Ressorts habe es „keinerlei Informationsweitergabe“ gegeben, teilte das Innenministerium am Abend in einer ORF.at vorliegenden Stellungnahme mit. Das Ministerium verweist in dieser zudem auf die „besondere Stellung“ des bei der WKStA-Amtshandlung „unterstützend“ tätig gewesenen Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK). Durch das BAK-Gesetz gesetzlich verankert habe dieses „keinerlei Berichtspflicht innerhalb des Bundesministeriums für Inneres – auch nicht an die Ressortleitung“, so das Ministerium, demzufolge das BAK zudem „erst kurzfristig vor den Durchsuchungen informiert“ worden sei.
Zur Verteidigung Nehammers zog zuvor auch die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gabriela Schwarz ins Feld. Die am Mittwoch vergangener Woche erfolgten Hausdurchsuchungen seien „im Vorfeld durch Medienanfragen an ihre Partei publik geworden“, heißt es dazu in einer Aussendung, in der Schwarz auch auf ihre eigene Pressekonferenz vom 28. September verweist.
„Wir haben tagelang unmissverständliche Anfragen von Journalistinnen und Journalisten über bevorstehende Hausdurchsuchungen im Umfeld der Volkspartei erhalten“, so Schwarz: „Dass SPÖ und FPÖ nun vereint versuchen, den Innenminister anzupatzen“, sei „nicht nur völlig realitätsfremd, sondern auch vollkommen absurd“.
*** „Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? ***
Hinweise auf eine anstehende Amtshandlung hätten Beobachtern zufolge durchaus ein genauer Blick auf die Ordnungsnummern des Casinos-Ermittlungsaktes nahegelegt. Darauf verweist in der ZIB2 der Wirtschaftsstrafrechtsexperte Robert Kert von der Wirtschaftsuniversität Wien. Laut „Presse“ sei der Termin für die Hausdurchsuchungen aber auch mehrfach verschoben worden. „Am 4. Oktober wurden Exekutive und Innenministerium informiert, dass die Razzia zwei Tage später stattfinden soll“, heißt es in der Zeitung.
Die „Presse“ berichtet zudem, dass es auch in der „Österreich“-Mediengruppe Versuche gegeben haben soll, Daten professionell löschen zu lassen. Mehrere Cybersecurity-Firmen seien angefragt worden, Daten aus Clouds und Messengerdiensten zu löschen. Begründet wurde das mit einem Security-Leak. Chefredakteur Niki Fellner spricht laut „Presse“ von einem „groben Missverständnis“. Man habe Ende August einen schwerwiegenden Fall von Cyberkriminalität im Haus entdeckt, bei dem versucht worden sein soll, hohe Rechnungsbeträge auf ein US-Konto umzuleiten. Ob Daten dann tatsächlich gelöscht wurden, ließ Fellner laut „Presse“ offen.
*** WKStA: Keine Informationen „zu laufenden Ermittlungen“ ***
Von der WKStA gab es bis zum späten Abend indes weiter weder eine Bestätigung der Festnahme noch über eine etwaige Beschuldigtenvernehmung Beinschabs. Laut der APA hieß es dazu am Nachmittag lediglich, dass man „derzeit“ keine Informationen „zu laufenden Ermittlungen“ bekannt gebe.
Grund für die Verschwiegenheit der WKStA könnte sein, dass die Befragungen Beinschabs zur angeblichen Festplattenlöschung, möglicherweise aber auch darüber hinaus nicht beendet waren. Darauf deutete laut APA etwa auch hin, dass die Rechtsvertreterin der Meinungsforscherin am Nachmittag telefonisch nicht erreichbar und somit womöglich bei einer etwaigen Beinschab-Befragung anwesend war.
*** Warten auf weitere Vorgangsweise ***
Grundsätzlich kann eine einer Straftat dringend tatverdächtige Person bei Vorliegen entsprechender Haftgründe 48 Stunden angehalten werden, wobei die Unterbringung in der Regel zunächst in der Arrestzelle eines Polizeikommissariats erfolgt. Ist eine weitere Haft erforderlich, muss der bzw. die Festgenommene binnen 48 Stunden dem zuständigen Gericht – im konkreten Fall dem Wiener Landesgericht für Strafsachen – übergeben werden.
Das Gericht prüft dann, ob gegebenenfalls gelindere Mittel angeordnet werden können oder ob Untersuchungshaft verhängt wird. Einen Antrag auf Verhängung der U-Haft über Beinschab hat die WKStA nach APA-Informationen am Dienstag noch nicht gestellt.
Beinschab werden in der ÖVP-Affäre Untreue als Beteiligte und Bestechung als Beteiligte vorgeworfen. Laut WKStA soll sie Auftragsumfragen erstellt und dafür auch Scheinrechnungen gestellt haben. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232429/
NR: Schallenberg entschuldigt sich für „Weglegen“ von Akten – ORF, 12.10.2021, 16:53
Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich heute nach seinem ersten Auftritt als neuer Regierungschef via Twitter „für das Weglegen“ der bei der heutigen Sondersitzung im Nationalrat von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger überreichten Unterlagen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) entschuldigt.
Die Vorgangsweise werde „von einigen als Respektlosigkeit gegenüber der unabhängigen Justiz bzw. Beate Meinl-Reisinger gesehen“, wie Schallenberg dazu weiter mitteilte – beides sei „keineswegs meine Intention gewesen und es tut mir leid, wenn dieser Eindruck entstanden ist“.
Konkret überreichte Meinl-Reisinger dem neuen Kanzler die WKStA-Anordnung zur Hausdurchsuchung. In ihrer Rede forderte die NEOS-Chefin Schallenberg zuvor auf, die Details der im Raum stehenden WKStA-Vorwürfe zu studieren. Schallenberg war an den überreichten Akten allerdings wenig interessiert und legte den Papierstapel flott neben dem Tisch auf den Boden.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232406/
SIEHE DAZU:
=> Tweet von Alexander Schallenberg – Twitter, 12.10.2021, 14:52
QUELLE: https://twitter.com/a_schallenberg/status/1447907922802003976
Meinungsforscherin festgenommen – Weitere Entwicklung noch offen – „Die Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? – Das „Beinschab-Österreich-Tool“ – „Die Kosten packst Du dann in die Studie“ – Von 2016 bis 2020 587.400 Euro – Suche nach Studien im Finanzministerium – ORF, 12.10.2021, 12:21/17:12
Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab ist laut Informationen des „Standard“ am Dienstag festgenommen worden. Ihr werden in der ÖVP-Affäre Untreue als Beteiligte und Bestechung als Beteiligte vorgeworfen. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) soll sie Auftragsumfragen erstellt und dafür auch Scheinrechnungen gestellt haben. Die Festnahme erfolgte offenbar aus Verdunkelungsgefahr: Sie soll kurz vor der Hausdurchsuchung vergangene Woche die Festplatte ihres Computers gelöscht haben.
Auch die „Presse“ berichtet von der Festnahme und schreibt, dass kurz vor der Hausdurchsuchung am 6. Oktober „Serverdaten in größerem Umfang gelöscht“ worden sein sollen. Laut Ö1 dementierte Beinschabs Anwältin die Festnahme nicht. Offenbar löste die Festnahmen „hochgradige Nervosität“ bei anderen Verdächtigen aus, wie die APA unter Berufung auf Wiener Anwaltskreise berichtete.
Auf Anfrage der APA teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nur mit, man dürfe „grundsätzlich in laufenden Ermittlungsverfahren Anfragen zu konkreten Ermittlungsmaßnahmen nicht beantworten“. Eine Presseerklärung – eine solche hatte es am vergangenen Mittwoch nach den Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, dem Finanzministerium und der ÖVP-Zentrale gegeben – sei „derzeit nicht geplant“.
*** Weitere Entwicklung noch offen ***
Grund für die Verschwiegenheit der WKStA könnte sein, dass die Befragungen Beinschabs zur angeblichen Festplattenlöschung noch im Gang sind und die Verdachtslage somit noch nicht abschließend geklärt ist. In diesem Fall wäre derzeit noch offen, ob Beinschab nach dem Ende ihrer Einvernahme wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Grundsätzlich kann eine einer Straftat dringend tatverdächtige Person bei Vorliegen entsprechender Haftgründe 48 Stunden angehalten werden, wobei die Unterbringung in der Regel zunächst in der Arrestzelle eines Polizeikommissariats erfolgt.
*** „Die Presse“: Datenlöschung auch bei „Österreich“? ***
„Die Presse“ berichtet indes, dass die Razzia vorab verraten worden sein könnte. Der Termin sei mehrfach verschoben worden. „Am 4. Oktober wurden Exekutive und Innenministerium informiert, dass die Razzia zwei Tage später stattfinden soll“, heißt es in der Zeitung. Und die „Presse“ berichtet auch, dass es in der „Österreich“-Mediengruppe Versuche gegeben haben soll, Daten professionell löschen zu lassen.
Mehrere Cybersecurity-Firmen seien angefragt wurden, Daten aus Clouds und Messengerdiensten zu löschen. Begründet wurde das mit einem Security-Leak. Chefredakteur Niki Fellner spricht laut „Presse“ von einem „groben Missverständnis“. Man habe Ende August einen schwerwiegenden Fall von Cyberkriminalität im Haus entdeckt. Bei dem versucht worden sein soll, hohe Rechnungsbeträge auf ein US-Konto umzuleiten. Ob Daten dann tatsächlich gelöscht wurden, ließ Fellner laut „Presse“ offen.
*** Das „Beinschab-Österreich-Tool“ ***
Beinschab soll gemeinsam mit ihrer Kollegin Sophie Karmasin die Vereinbarung rund um die angeblich zugunsten der für Kurz und die ÖVP frisierten Umfragen mit umgesetzt und anschließend „Scheinrechnungen gelegt“ haben. Beinschab ist Gründerin des Marktforschungsinstituts Research Affairs, das seit vielen Jahren die Umfragen für die Mediengruppe „Österreich“ durchgeführt hat.
Die beschuldigte Gruppe um Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz nannte die Umfrageplatzierungen „Beinschab-Österreich-Tool“. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
Umfragen mit Schmid besprochen
Die umfangreiche Auswertung der WKStA veranschaulicht auch, dass die Meinungsforscherinnen mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, im Detail vorab in der Tageszeitung Österreich erschienene Umfragen vor der Nationalratswahl im Herbst 2017 besprachen.
„Es wird diesmal wieder eine Themenfrage eher mit SPÖ-Themen gestellt. Soll ich unsere Themen vom letzten Mal ergänzen?“, fragte Beinschab Schmid, der das bejahte. Am 24. August 2017 schickte Helmuth Fellner, in der Mediengruppe Österreich für das Kaufmännische zuständig, Schmid die „Österreich“-Titelseite mit einer Research-Umfrage zur Wahl, die dieser umgehend Stefan Steiner – bis Anfang 2018 ÖVP-Generalsekretär – mit den Worten „Bist du mit dem Österreich Aufmacher heute zufrieden für die Mobilisierung der eigenen“ schickte, worauf er ein Smiley erntete.
*** „Die Kosten packst Du dann in die Studie“ ***
Mitte August 2017 gab Schmid bei Beinschab eine Umfrage zu noch unentschlossenen Wählern in Auftrag, unmittelbar nachdem diese einen mit knapp 62.000 Euro dotierten Forschungsauftrag des Finanzministeriums zum Thema Betrugsbekämpfung erhalten hatte. Beinschab schickte Schmid ihre Fragestellungen und bat um Freigabe, die dieser nach Rücksprache mit Steiner erteilte. Bereits einen Tag später übermittelte Beinschab Schmid die Ergebnisse.
Im Dezember 2016 schrieb Beinschab an Schmid: „Lieber Herr Schmid! Was ich noch fragen wollte: kann ich den Betrag für die Erhebung bei der qualitativen Studie dazu rechnen?“ Schmid bejahte das. Und in einem anderen Chat schrieb Schmid: „“Die Kosten für die offenen (Studien, Anm.) packst Du dann in die Studie zur Betrugsbekämpfung rein.“ Beinschab darauf: „Du meinst Betrugsbekämpfung + die 3 Wellen eine Rechnung?“ Schmid: „Ich erkläre Dir das nach meiner Rückkehr persönlich.“
*** Von 2016 bis 2020 587.400 Euro ***
Detailliert aufgelistet wird im Analysebericht der WKStA der Wert der Aufträge des Finanzministeriums an Beinschab. Laut den Angaben summierte sich der „Förderbetrag“ für diverse Studien in den Jahren 2016 bis 2020 auf 587.400 Euro. Größter Auftrag war (von September 2016 bis Jänner 2018) eine „Studie“ zur „Budgetpolitik“ für 156.000 Euro. Bisher letzter Auftrag im November/Dezember 2020 war eine „Bewertung des Corona-Hilfspakets aus Sicht der Bevölkerung und von Unternehmen“ (fast 56.000 Euro).
Damals war Schmid schon nicht mehr im Finanzministerium. Im September 2017 hatte Schmid um Rechnungen unter einem Firmennamen gebeten, in dem weder Ex-ÖVP-Ministerin Karmasin noch Beinschabs Name vorkommen sollten. „Für die Angaben bei parlamentarischen Anfragen wäre das hilfreich“, textete Schmid damals an die Meinungsforscherin.
*** Suche nach Studien im Finanzministerium ***
Laut dem Chef der Finanzprokuratur und ehemaligen Innenminister Wolfgang Peschorn beauftragte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) die interne Revision mit der Prüfung der in der Inseratenaffäre von der WKStA erhobenen Vorwürfe. Bei dieser Prüfung sei die Finanzprokuratur unterstützend tätig, sagte Peschorn. Mehrere Medien berichten, dass im Finanzministerium derzeit die fraglichen Studien gesucht werden.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232239/
SIEHE DAZU:
=> Der Standard – Artikel
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000130365838/in-inseratenaffaere-beschuldigte-meinungsforscherin-b-offenbar-festgenommen
=> Die Presse -Artikel 1
QUELLE: https://www.diepresse.com/6046449/fall-kurz-wurde-razzia-verraten
=> Die Presse Artikel 2
QUELLE: https://www.diepresse.com/6046148/causa-kurz-meinungsforscherin-festgenommen
Antritt und Abrechnung: Selten intensiver Tag im Nationalrat – Aufregung nach Kollaps – Scharfe Attacken auf Kurz und Schallenberg – Bild der Skrupellosigkeit – Wöginger lobt Kurz – SPÖ-„Dringliche“ an Blümel – Linhart bekennt sich zu starker EU – ORF, 12.10.2021, 16:52
Die Sondersitzung zur ÖVP-Affäre und die Regierungserklärung des neuen Kanzlers Alexander Schallenberg (ÖVP) haben für eine ungewöhnlich dichte und aufgewühlte Debatte gesorgt: Schallenberg bot allen Parteien seine Kooperation an, sorgte zugleich mit scharfer Kritik an Misstrauensanträgen für heftigen Einspruch. ÖVP und Grüne betonten, zusammenarbeiten zu wollen, doch die Beziehung ist spürbar gestört. Die Opposition rechnete mit dem „türkisen System Kurz“ ab. Die beiden Misstrauensanträge wurden erwartungsgemäß abgelehnt.
Schallenberg machte bei seiner Regierungserklärung zum Auftakt klar, dass er den Kurs seines Vorgängers Sebastian Kurz (ÖVP), der über die ÖVP-Affäre rund um mit Steuergeld finanzierte Inserate stürzte, fortsetzen wird. Basis für seine Arbeit wird das Regierungsprogramm sein, das er zügig abarbeiten will. Ob Migrations-, Arbeitsmarkt- oder CoV-Politik, Schallenberg will den eingeschlagenen Weg beibehalten. Als Botschaft wolle er aussenden, dass die Hand in Richtung des Koalitionspartners ausgestreckt sei, um die in den vergangenen Tagen entstandenen Gräben zu überwinden und die inhaltlich erfolgreiche Arbeit der Regierung fortzusetzen.
Freilich hatten sich Schallenberg und der grüne Vizekanzler Werner Kogler während des ganzen Tages auf der Regierungsbank nur selten etwas zu sagen. Wie abgekühlt zumindest die Stimmung zwischen den Koalitionsparteien ist, zeigte sich auch daran, dass bei Rednerinnen und Rednern des Koalitionspartners nicht, wie sonst üblich, geklatscht wurde.
Doch auch der Opposition streckte Schallenberg die Hand rhetorisch entgegen, sorgte bei eben dieser aber sofort für lautstarken Unmut, als er „mutwillige Aktionen“ wie den (SPÖ-)Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geißelte. Diese Initiative sei „beim besten Willen nicht zu verstehen“. Das sorgte bei vielen der Redner der Oppositionsparteien für heftige Entrüstung. Sie pochten auf die Unabhängigkeit des Parlaments, dem der Kanzler nichts vorzugeben habe.
Für Kritik und Aufregung vor allem in den sozialen Netzwerken sorgte auch, dass Schallenberg den Hausdurchsuchungsbefehl, den NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihm in Papierform zur Lektüre aushändigte, kurz danach betont achtlos hinter sich auf dem Boden ablegte. Stunden später entschuldigte sich Schallenberg auf
Vizekanzler Kogler gab sich versöhnlich gegenüber der ÖVP, stärkte aber auch der Justiz den Rücken.
*** Aufregung nach Kollaps ***
Für Aufregung sorgte dann nachmittags der Kollaps der SPÖ-Abgeordneten Eva Maria Holzleitner am Rednerpult. Sie kam aber nach kurzer medizinischer Betreuung wieder zu Bewusstsein und wurde aus dem Saal geleitet – die Debatte ging weiter.
*** Scharfe Attacken auf Kurz und Schallenberg ***
Noch wesentlich deutlicher wurde die Opposition, die nicht nur Kurz, sondern auch Schallenberg hart attackierte. Dass dieser nach seiner Unschuldserklärung für den Vorgänger auch noch den Misstrauensantrag gegen Blümel kritisiere, stehe ihm nicht zu, meinte SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl ereiferte sich, dass sich Schallenberg anmaße, das Parlament zu belehren. Ein eigener Misstrauensantrag der Freiheitlichen gegen die gesamte Regierung fand bei den anderen Fraktionen keine Zustimmung. Der SPÖ-Misstrauensantrag gegen Blümel wurde mit den Stimmen von ÖVP und Grünen abgelehnt.
Der neue Kanzler habe gleich in seiner ersten Rede „einen moralischen Absturz“ geschafft, ätzte Kickl: „Ein Begräbnis für eine millionenfache Erwartungshaltung“, so Kickl zu Schallenbergs Auftritt. Reue, Einsicht, Demut seien Dinge, die es gebraucht hätte: „Nichts ist gekommen, weil sie zutiefst verhabert sind. Sie sind einer von dieser Partie.“
Auch für Rendi-Wagner hat der Kanzler schon am ersten Tag viel Vertrauen verspielt: „Wer blind folgt, kann nicht führen.“ Die SP-Chefin forderte Schallenberg auf, eine Trennlinie zu ziehen: „Die heutige Regierungsumbildung ist eine Farce, weil die Fäden zieht weiter Kurz.“
Das empfahl auch NEOS-Fraktionschefin Beate Meinl-Reisinger. Sie adressierte an Schallenberg: „Sie haben es in der Hand, sich an das türkise System zu klammern und mit dem unterzugehen, aber dass Sie das Land mitreißen, werden wir nicht zulassen.“
*** Bild der Skrupellosigkeit ***
Alle drei Oppositionschefs nützten die Gelegenheit, noch einmal mit Kurz abzurechnen. Für Rendi-Wagner zeigen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein „Bild der Skrupellosigkeit und des Machtmissbrauchs“. Die Fakten seien erschütternd und sprengten Maßstäbe.
Machtgier und Machtmissbrauch, schwere Korruption, Respektlosigkeit, Niedertracht, Heuchelei – diese Mischkulanz sei das, was die türkise Welt zusammenhalte, so Kickl. Meinl-Reisinger meinte zum Kurz-Umfeld, dieses stehe für ein Sittenbild des moralischen Verfalls.
*** Wöginger lobt Kurz ***
Ganz anders war die Einschätzung des für Kurz scheidenden ÖVP-Klubchefs August Wöginger. Der nannte seinen baldigen Nachfolger nämlich einen „großen Staatsmann“. Dieser habe das Land nach vorne gebracht, und Wöginger ist auch überzeugt, dass sich die Vorwürfe gegen Kurz als falsch herausstellen werden. Schallenberg ist für ihn „der Richtige zum richtigen Zeitpunkt“.
Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sagte, die Regierungskrise sei überwunden. Nun müsse eine Phase des Zur-Ruhe-Kommens folgen. Die nächste Zeit müsse geprägt sein vom Wiederaufbau des Vertrauens auch zwischen den Koalitionspartnern und den Parteien im Parlament insgesamt.
*** SPÖ-„Dringliche“ an Blümel ***
Hoch ging es dann nochmals bei der Dringlichen Anfrage der SPÖ her. Sie war ursprünglich an Kurz gerichtet, nach dessen Rücktritt richtete sie die SPÖ aber gegen Finanzminister Blümel, den SPÖ-Mandatar Jan Krainer nahe genug an Kurz angedockt sah.
Wenn die ÖVP nach Bekanntwerden des „Ibiza“-Videos den Wunsch nach Abgang von Herbert Kickl (FPÖ) als Innenminister damit begründet habe, dass der ja die Ermittlungen gegen seine Parteifreunde behindern könnte, müsste jetzt wohl auch der jetzige Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) abtreten, betonte Krainer. Ohnehin sollte für Krainer die gesamte ÖVP-Regierungsmannschaft zurücktreten, weil sie Kurz weiter die Mauer mache.
Blümel sah das erwartungsgemäß anders. In seiner Replik meinte er, Österreich bräuchte jetzt Stabilität und Verantwortung. Er hoffe, dass sich die Opposition wieder bewusst werde, dass Verantwortung für das Land auch anders gehe als mit bewussten Vorverurteilungen.
*** Linhart bekennt sich zu starker EU ***
Eher im Schatten stand der erste Auftritt des neuen ÖVP-Außenministers Michael Linhart. Linhart, der sich zu einer starken EU bekannte, versprach für seine Amtsführung „Verbindlichkeit“ bei klaren inhaltlichen Positionen. Er versichere, dass man in der Welt weiterhin die Stimme erheben werde für friedliche Lösungen, für Menschenrechte, „gegen jegliche Form des Antisemitismus“ und für eine starke transatlantische Partnerschaft.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232398/
124. Sitzung des Nationalrates am 12.10.2021 – Mediathek / Parlament.at, 12.10.2021
QUELLE: https://www.parlament.gv.at/MEDIA/play.shtml?GP=XXVII&ITYP=NRSITZ&INR=124&INR_TEIL=1&DEBATTE=300&DEBATTE_TEIL=1
SIEHE DAZU:
=> Pars pro toto: Kickl-Rede im Nationalrat: sieht Grüne als „Lebensverlängerer“ – krone.tv NEWS/Youtube, 12:10.2021
„Family business as usual“, sei nun „die einzige Agenda, die nun abgearbeitet wird“, von Stabilität und Neubeginn sei „nicht einmal ansatzweise“ etwas zu erkennen, richtete FPÖ-Klubchef Herbert Kickl der ÖVP aus. Die Grünen würden nun nur noch als „Lebensverlängerer“ fungieren.
QUELLE (17:05-min-Video): https://www.youtube.com/watch?v=iFUNaRDpF-Q
Regierungserklärung: Schallenberg will Kurz-Kurs halten – Will eng mit Kurz zusammenarbeiten – Kogler würdigt ÖVP ausdrücklich – Kogler stärkt Justiz den Rücken – Dringliche Anfrage zum „System Kurz“ – ORF, 12.10.2021, 12:10
Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei seiner Regierungserklärung am Dienstag im Nationalrat klargemacht, dass er den Kurs seines Vorgängers Sebastian Kurz (ÖVP) fortsetzen wird. Basis für seine Arbeit werde das Regierungsprogramm sein, das er zügig abarbeiten wolle, so Schallenberg, der allen Parteien die Zusammenarbeit anbot, gleichzeitig aber den Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) scharf kritisierte.
Ob Migrations-, Arbeitsmarkt- oder Coronavirus-Politik, Schallenberg will den eingeschlagenen Weg beibehalten. Dass er das Amt nun übernommen hat, schilderte er wie am Vortag als Überraschung. Doch als ihn Kurz nach seiner Bereitschaft gefragt habe, sei ihm klar gewesen: „Zögern ist keine Option.“ Als Botschaft wolle er aussenden, dass die Hand in Richtung des Koalitionspartners ausgestreckt sei, um die in den vergangenen Tagen entstandenen Gräben zu überwinden und die inhaltlich erfolgreiche Arbeit der Regierung fortzusetzen.
Doch auch der Opposition streckte Schallenberg die Hand rhetorisch entgegen, sorgte bei ebendieser aber sofort für lautstarken Unmut, als er „mutwillige Aktionen“ wie den angekündigten (SPÖ-)Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geißelte. Diese Initiative sei „beim besten Willen nicht zu verstehen“.
*** Will eng mit Kurz zusammenarbeiten ***
Neuerlich war es Schallenberg wichtig hervorzuheben, dass er mit Kurz eng kooperieren werde. Dieser sei schließlich der Obmann und Klubchef der Volkspartei, die mit ihm die vergangenen beiden Wahlen gewonnen habe. Auch in besonderen Zeiten würden demokratiepolitische Grundsätze nicht außer Kraft gesetzt.
Inhaltlich nannte der neue Kanzler in seiner knapp zehnminütigen Rede die ökosoziale Steuerreform als ein Herzstück der Regierungsarbeit. Man werde auch den Weg der Modernisierung mit mehr Mitteln für Bildung, Forschung und Digitalisierung fortsetzen. Auf dem Arbeitsmarkt setzt Schallenberg darauf, dass alle, die das könnten, auch einen Beitrag leisten müssten.
„Konsequent fortsetzen“ will der Regierungschef wenig überraschend „unseren Weg“ bei Migration und Integration. Das gelte auch für die Außenpolitik, die er selbst bisher verantwortet hat. Seinem heute ebenfalls präsentierten Nachfolger Michael Linhart (ÖVP) streute er als „supererfahrenem außenpolitischen Profi“ schon einmal Rosen.
*** Kogler würdigt ÖVP ausdrücklich ***
Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gab sich versöhnlich gegenüber der ÖVP, stärkte aber auch der Justiz den Rücken. „Wir stimmen überein, dass die Republik Österreich in dieser Situation Stabilität, Verlässlichkeit und Orientierung braucht“, sagte Kogler. Nun gehe es darum, das Richtige zu tun, und zwar das, was im Regierungsprogramm stehe. In den letzten Tagen haben man freilich „zugegeben einige Bewährungsproben“ hinter sich gebracht.
Trotz Tadels in Schallenbergs Antrittsrede am Tag davor umarmte Kogler den Koalitionspartner in seiner Rede und sprach der ÖVP „Dank und Anerkennung“ aus. Denn es sei sicher nicht leicht gewesen, solche Entscheidungen zu treffen, aber sie seien letztlich rasch und im Interesse der Republik getroffen worden, meinte Kogler zum Wechsel im Kanzleramt.
Zudem zollte Kogler auch Kurz persönlich ausdrücklich Respekt für dessen Rückzug als Kanzler. Der Vizekanzler dankte aber auch den Klubobleuten der Fraktionen, die ebenfalls bereit gewesen seien, für Stabilität zu sorgen. Neuwahlen wären aus seiner Sicht keine gute Lösung gewesen, erinnerte er etwa daran, dass es nun wichtig sei, das Budget zu beschließen.
*** Kogler stärkt Justiz den Rücken ***
Der Vizekanzler sprach aber auch die Justiz an, die von der ÖVP immer wieder angegriffen wird. „Lassen wir die Justiz arbeiten, lassen wir sie unabhängig ermitteln“, appellierte Kogler einmal mehr. Es sei gut, dass sich die Justiz offensichtlich nicht beeinflussen lasse. Es sei ein Missverständnis, dass man einzelne Institutionen nicht kritisieren dürfe.
Der Punkt sei, Zurufe zu unterlassen, die die Justiz generell infrage stellen. Wenn eine Anordnung zur Hausdurchsuchung von einem unabhängigen Richter genehmigt wurde, sei das „nicht nichts“ – wenn es einem nicht passe, gebe es im Rechtsstaat entsprechende Rechtsmittel, statt den Rechtsstaat zu „attackieren“.
*** Dringliche Anfrage zum „System Kurz“ ***
Eigentlich wurde die Sondersitzung auf Begehr der gesammelten Opposition einberufen, um Kurz als Kanzler das Misstrauen auszusprechen. Stattdessen wird es nun eine Dringliche Anfrage der SPÖ nach der Regierungserklärung geben, die sich am Tag vor seiner Budgetrede an Finanzminister Blümel als „Teil des Systems Kurz“ richtet. Die Sozialdemokraten haben dazu einen Misstrauensantrag gegen den Ressortchef in Aussicht gestellt.
In der Begründung der „Dringlichen“ wird noch einmal kräftig mit Kurz abgerechnet. Die jüngsten Enthüllungen zeigten „ein desaströses Sittenbild der türkisen Truppe rund um Sebastian Kurz“. Dieser habe ein System aufgebaut, das Machterhalt als einziges Ziel kenne. Alle türkisen Minister seien Regierungsmitglieder von Kurz’ Gnaden, nur ihm verpflichtet und loyal. Das „System Kurz“ bestehe so auch trotz des „Seitentritts“ des ÖVP-Chefs unverändert weiter.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232247/
=> Regierungserklärung von Bundeskanzler Alexander Schallenberg – Bundeskanzleramt / Youtube, 12.10.2021
QUELLE (9:55-min-Video): https://www.youtube.com/watch?v=lBCsDC_yfLc
Mikl-Leitner: „Chats nicht so stehen lassen“ – „Allen voran Niederösterreich verpflichtet“ – NOe.ORF.at, 12.10.2021, 11:44
Anlässlich der Angelobung des neuen Bundeskanzlers findet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einem Facebook-Video klare Worte zur ÖVP-Affäre. „Die Chats zeichnen ein Bild, das wir so nicht stehen lassen wollen und können“, so Mikl-Leitner.
Nachdem die Landeshauptleute Sebastian Kurz zunächst noch weiter im Amt des Bundeskanzlers sehen wollten, werden nun vermehrt kritische Stimmen laut. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) etwa hatte sich Donnerstagabend stellvertretend für die ÖVP-Landeshauptleute vor die Kameras gestellt, um Kurz den Rücken zu stärken. Es gebe aber „schwerwiegende Vorwürfe, die man nicht wegwischen kann“, beurteilte Platter die Sache am Dienstag anders – mehr dazu in Platter geht weiter auf Distanz zu Kurz (tirol.ORF.at; 12.10.2021). Auch aus Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich kamen zuletzt kritische Stimmen.
Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stellte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe rund um den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz hinter ihren Parteichef. Sie forderte Aufklärung und pochte auf die Unschuldsvermutung, die für alle Menschen zu gelten habe – mehr dazu in Mikl-Leitner stellt sich erneut hinter Kurz (noe.ORF.at; 8.10.2021).
*** „Allen voran Niederösterreich verpflichtet“ ***
In ihrem jüngsten Facebook-Video ging Mikl-Leitner hingegen auf Distanz: „Klar ist, dass die Vorwürfe aufgeklärt werden müssen. Die Chats zeichnen ein Bild, das wir so nicht stehen lassen wollen und können“, sagte die Landeshauptfrau.
Es sei gut, dass die Arbeit auf Bundesebene weitergehe, und dass Sebastian Kurz dies mit seinem Schritt zur Seite möglich gemacht habe, so Mikl-Leitner, die die Bundesregierung dann an ihre Aufgaben für die nächsten Wochen und Monate erinnerte, vor allem in den Bereichen Verkehr, Steuerreform sowie Gesundheits- und Pflegeausbildung. Auch die Corona-Krise sei noch nicht überstanden und der Aufschwung habe sich noch nicht verfestigt. Abschließend stellte die Landeshauptfrau klar, wo die Prioritäten in ihrer Arbeit liegen. Sie sei „allen voran Niederösterreich verbunden und verpflichtet“, sagte Mikl-Leitner.
QUELLE: https://noe.orf.at/stories/3125375/
Ruf nach Handylöschverbot für Amtsträger – ORF, 12.10.2021, 11:07
Die NGO Forum Informationsfreiheit (FOI) und NEOS fordern wegen Ermittlungen gegen Amtsträger bzw. Spitzenpolitiker – begonnen bei der Casinos-Affäre – ein Löschverbot für Handydaten von Amtsträgerinnen und -trägern der Republik.
Dazu wäre eine Änderung des Strafgesetzbuches notwendig. Bisher ist es nur strafbar, Beweismittel während Strafverfahren zu vernichtet. Von NEOS gibt es einen Initiativantrag für das Anti-Lösch-Ansinnen.
Es sei das Gebot der Stunde, ein effektives Informationsfreiheitsgesetz zu beschließen, das den Namen auch verdiene, so FOI. „Es gilt nicht nur, Amtsmissbrauch und Korruption in Zukunft zu verhindern, sondern auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Verwaltung zurückzugewinnen. Das geht nur mit echter Transparenz und echter öffentlicher Kontrolle“, so FOI-Vorstand Mathias Huter in einer Aussendung.
Ein neues Dokumentationsgesetz solle zudem Amtsträgern der Republik zur Nutzung beruflicher Kommunikationsgeräte verpflichten und das Löschen von Nachrichten auf offiziellen Geräten und Kanälen unter Strafe stellen.
Ein Transparenzgesetz wie das Informationsfreiheitsgesetz könne keine Nachvollziehbarkeit sicherstellen, wenn Amtsträger ihre Kommunikation über private Handys und E-Mail-Konten führen dürfen und Daten einfach ohne Konsequenzen vernichten können.
„Vor allem Messenger-Apps oder Software mit ‚Auto-burn‘-Funktion, wie sie zuletzt in Ministerien angeschafft oder angedacht worden sein sollen, sind daher ein absolutes No-Go im Verwaltungsbereich. Auch das Löschen beruflicher Terminkalender darf es in Zukunft nicht mehr geben“, so Huter.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232203/
Platter rückt von Kurz ab – Häme und Kritik der Opposition – Häme und Kritik der Opposition – ORF, 12.10.2021, 9:52
Tirols Landeshauptmann Günther Platter ist nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz (beide ÖVP) als Bundeskanzler auf Distanz zu ihm gegangen. Obwohl Platter Kurz noch vor wenigen Tagen im Amt sehen wollte, fand er nun, dass die Vorwürfe doch zu schwer wiegen würden.
Das sagte er der „Tiroler Tageszeitung“ (Dienstag-Ausgabe). Er forderte, dass der neue Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) die Regierung „ohne Einflussnahme nach seinen Vorstellungen führen“ kann, und betonte, „ein Schwarzer“ zu sein. Nach der Wahl von Kurz zum Klubobmann im Nationalrat sei es wichtig, „dass künftig, unabhängig von persönlichen Befindlichkeiten, jede und jeder ihrer bzw. seiner Rolle nachkommt“, sagte Platter.
Für Schallenberg gelte nun, dass er die „notwendigen Weichenstellungen trifft, um die Eigenständigkeit der Politik und seiner Regierung klar zu definieren“. Er erwarte sich nach der Regierungskrise Ruhe, über Neuwahlen sollte man sich keine Gedanken machen.
Platter hatte sich Donnerstagabend stellvertretend für die ÖVP-Landeshauptleute vor die Kameras gestellt, um Kurz den Rücken zu stärken. Es gebe aber „schwerwiegende Vorwürfe, die man nicht wegwischen kann“, sagte Platter jetzt. Für den Landeschef waren die bekanntgewordenen Chats sowie das Sichabzeichnen einer Koalition aus Grünen, SPÖ, FPÖ und NEOS ausschlaggebend dafür, dass er für einen Rücktritt von Kurz als Bundeskanzler war. Platter hielt außerdem fest, dass er „ein Schwarzer“ sei. Er habe „schon immer andere Anschauungspunkte gehabt“ als die türkise ÖVP.
Härter mit Kurz ins Gericht ging der schwarze Tiroler Arbeitskammer-Präsident Erwin Zangerl. Kurz solle sich komplett zurückziehen, forderte er. „Es wird jetzt schon von einem Schattenkanzler Sebastian Kurz geredet“, kritisierte Zangerl: „Für einen Neuanfang in der ÖVP und in der Bundesregierung sollte alles absolut besenrein übergeben werden.“
*** Häme und Kritik der Opposition ***
Häme und Kritik für Platter hatten indes die Tiroler FPÖ und die Liste Fritz übrig. „Platters plötzliche Abkehr vom getreuen ‚Kurzianer‘ lässt jedes Chamäleon vor Neid erblassen“, meinte FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. Tirols oberster Blauer erinnerte Platter daran, dass er „den widerwärtigen politischen Kuhhandel eingefädelt hat und Kurz zum Klubobmann gemacht hat, anstatt ihn in die politische Wüste zu schicken“. „Platter hat jede – auch nur die geringste rudimentär vorhandene – Glaubwürdigkeit in den vergangenen Tagen absolut verloren“, so Abwerzger.
„ÖVP-Landeshauptmann Platter ist der Inbegriff eines politischen Opportunisten. Vergangenen Donnerstag ist er noch hinter dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz gestanden, am Freitag neben Kurz und heute stellt er sich schon gegen Kurz“, nahm auch-Liste Fritz-Chefin Andrea Haselwanter-Schneider Platter ins Visier. Und sie bemühte die Astrologie. Platter sei im Sternzeichen Zwilling, dem man nachsage, „besonders anpassungsfähig, flexibel, beeinflussbar und flatterhaft zu sein“. „Dieser astrologische Befund beschreibt das Tiroler Blatt im Wind besonders gut“, so Haselwanter-Schneider.
*** Mikl-Leitner: „Chats nicht so stehen lassen“ ***
Neben Platter nahm auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einem Facebook-Video zur ÖVP-Affäre Stellung: „Die Chats zeichnen ein Bild, das wir so nicht stehen lassen wollen und können“, so Mikl-Leitner – mehr dazu in noe.ORF.at.
QUELLE: https://orf.at/stories/3232130/
SIEHE DAZU:
=> Interview: Platter geht auf Distanz zur türkisen Bundes-ÖVP und warnt Kurz – Landeshauptmann Platter fordert für Neo-Kanzler Schallenberg Eigenständigkeit in seinem politischen Handeln. Deutliche Warnung an Kurz – Tiroler Tageszeitung, 12.10.2021, 18:01 (aktualisierte Fassung)
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.tt.com/artikel/30803293/platter-geht-auf-distanz-zur-tuerkisen-bundes-oevp-und-warnt-kurz
Mikl-Leitner stellt sich erneut hinter Kurz – noe.ORF.at, 8.10.2021, 14:12
Die Fronten zwischen der ÖVP und den Grünen bleiben verhärtet. In Niederösterreich sprechen sowohl Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als auch die Grüne Landessprecherin Helga Krismer von einer schwierigen Situation. Mikl-Leitner stellt sich aber erneut hinter Kurz. ….
QUELLE: https://noe.orf.at/stories/3124959/