Views: 109
UPDATE 6.9.2021: in der Rubrik „INTERNATIONALES“ wurde die von SENTIX nachgereichte Meldung zum verdüsterten Konjunkturausblick eingefügt und im Abschnitt „FÜR DEN EILIGEN LESER“ eingeflochten.
Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – ganz ähnlich wie in den letzten Wochen hier bald mehr als nur oft festgehalten: – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball noch immer “supertoll” geht – Dieses Noch gewinnt mit Blick auf die Meldungslage der vergangenen Woche weiter an Schärfe: in die optimistischen Töne staatsnaher Beobachter gibt es noch stärkere Zeichen der Eintrübung als in der vorvergangenen Woche vor allem in den USA, der jüngste Inflationsanstieg wird zum wiederholten Male von offiziellen Stellen als vorübergehend aufgefasst. Doch treten Stimmen hinzu, die die Gefahr einer kommenden Stagflation an die Wand malen (=> COMMENT und KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER). Der Konjunkturausblick hat sich zudem bereits zum vierten Mal verdüstert, so der SENTIX Konjunkturindex. Auch die Corona-Pandemie spielt weiterhin eine Rolle. Die Gefahr in Form des Delta-Virus ist weiterhin bedeutungsvoll (=> COVID-19 Dashboard der Johns Hopkins University). Wie aufgeregte Debatten um Maßnahmen und Impfmanagement zeigen, herrscht eine irrlichternde Besorgnis weiterhin bei Gesundheitsexperten und in der Politik.
Aus den Sonderthemen ragen die Frage um die afghanischen Flüchtlinge und der Dauerbrenner Vermögens- und Erbschaftssteuern hervor. Afghanistans benachbarte Turkstaaten fürchten den Import islamistischer Vorstellungen in ihre Länder und schotten sich ab. Auch Österreichs Bundesregierung sagt Nein zur Aufnahme dieser Flüchtlinge und möchte gemeinsam mit der Europäischen Union die Turkstaaten zur Flüchtlingsaufnahme bewegen; indessen ruft EU-Kommissar Asselborn zur Front gegen Österreichs ablehnender Haltung und den derzeitigen EU-Vorsitz von Slowenien auf, das ebenfalls gegen die Flüchtlingsaufnahme votiert. Interessante Hintergrundinformationen zum Problem stellen die Beiträge “Afghanistan: Ein zerklüftetes Land” (Mit offenen Karten Reupload, ARTE, 2017) und “Die geographische Verbreitung des Islam und Islamismus” (Mit offenen Karten, ARTE, 2020) dar. Zur Vermögens- und Erbschaftssteuern melden sich wirtschaftsnahe Stimmen ablehnend, umverteilungsaffine Stimmen dagegen zustimmend zu Wort. Eine neue Studie, päsentiert zur Tagung der Zentralbanken in Jackson Hole, sieht als Ursache der „savings glut“, dem Überhang an Sparguthaben, die Bündelung von „Geld“ bei Reichen. Daraus, so schlussfolgern die Studienautoren, erhellt sich, dass die Reichen Verursacher des Niedrigzins seien. Für weitere kontroverse Diskussionen ist Stoff gegeben.
FAZIT: Neben optimistischen Ausblicken auf weiteres Wirtschaftswachstum gibt es zunehmend Zeichen einer harzenden Wirtschaft; noch handelt es ich um eine Art Jammern auf hohem Niveau; möglicherweise entwickelt sich aus der Inflation eine länger währende Stagflation (=> COMMENT und KOMMENTAR AUS FREMDEN FEDERN). Bremsend wirkt sich abermals die Pandemie mit steigenden Neuinfektionszahlen und ansteigenden Hospitalisierungen COVID-19-Erkrankter aus. Doch die Hoffnung stirbt bekanntnlich zuletzt: der Chef der deutschen Kassenärzte wähnt die Pandemie im Frühjahr 2022 beendet. Zündstoff für weitere Diskussionen liefern das Problem um afghanische Flüchtlinge und der Dauerbrenner Vermögens- und Erbschaftssteuern, denen sich die These um Reiche als angebliche Verursacher des Niedrigzins hinzugesellt.
…oooOOOooo…
ÜBERSICHT
- UMWELT
- INTERNATIONAL: Bericht: Schifffahrt hinterlässt großen ökologischen Fußabdruck
- INTERNATIONAL: Artenvielfalt: Bedrohungskarte zeigt besonders gefährdete Regionen
- INTERNATIONAL: Rund ein Drittel aller Baumarten weltweit vom Aussterben bedroht
- BRASILIEN verzeichnet im August 28.000 Brände im Amazonas-Regenwald
- ÖSTERREICH: Prioritäten-Liste zur Restauration zerstörter Ökosysteme Österreichs
GESELLSCHAFT - China verbietet Reality-Talentshows: Regierung gegen „abnormale Ästhetik“ und „verweichlichte Männer“
BILDUNG - GROSSBRITANNIEN: Brexit-Schlag für britische Unis: Nur noch halb so viel EU-Studenten
- DEUTSCHLAND: Weniger Hochschulabschlüsse im Corona-Jahr 2020 laut Statistische Bundesamt (Destatis) – Unterschiedliche Rückgänge je nach Studienabschluss und Studienfach
CYBERKRIMINALITÄT - 83 von 100 Firmen rechnen mit Cyber-Attacke – 3.600 Unternehmen befragt: „Cyber Risk Index“ von Trend Micro attestiert hohe Gefährdungslage
- Umfrage: IT-Sicherheit im Homeoffice kommt bei vielen Firmen zu kurz
- Risiken beim Online-Banking: Kriminelle buchen hohe Summe ab
MIGRATION und SICHERHEIT - TURKSTAATEN: Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan: Angst vor „islamistischem Virus“: Warum Afghanistans Nachbarn keine Flüchtlinge wollen – Russland ebenfalls mit verschlossenen Türen
- USBEKISTAN – DEUTSCHLAND: Usbekistan sichert Maas Hilfe bei Evakuierungen Deutschen, Ortskräften und Schutzbedürftigen zu – Zurückweisung afghanischer Flüchtlinge an den Grenzen
- PAKISTAN – Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Pakistans Botschafter in Deutschland der Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem Nachbarland eine Absage erteilt
- EUROPÄISCHE UNION will mit Hilfen für afghanische Nachbarländer große Migrationsbewegung abwenden
- EUROPÄISCHE UNION: Vor dem Sondertreffen der EU-Innenminister zu Afghanistan hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Widerstand gegen den EU-Vorsitz Sloweniens und gegen Österreich aufgerufen
- UNGARN – FLÜCHTLINGE: Ungarn stellt sich klar gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Afghanistan und sieht sich in seiner Haltung der Abgrenzung von 2015 bestätigt
- ÖSTERREICH für starkes EU-Engagement in Nachbarstaaten Afghanistans – EU stärkt humanitäre Hilfe und die Stabilisierungsarbeit in der Nachbarschaft
- ÖSTERREICH lehnt jede weitere Aufnahme von Afghanen ab
UNGLEICHHEIT und NIEDRIGZINS – VERMÖGENSSTEUER – ERBSCHAFTSSTEUER - Sind die Reichen schuld an den niedrigen Zinsen? Die These sorgt derzeit für viel Zündstoff – Das Zinsniveau sinkt seit Jahrzehnten. Erklärt wird der Trend oft mit der Alterung der Bevölkerung in Industriestaaten. Drei Ökonomen erheben Einspruch. Sie rücken die Ungleichheit der Einkommen ins Zentrum. Stimmt ihre These, hätte dies weitreichende Folgen – Zu viele Spargelder – Babyboomer taugen nicht zur Erklärung – Ein sich selbst verstärkender Prozess
- Studie: Vermögenssteuer bringt wenig und bremst die Konjunktur
- BDI: Höhere Erbschaftsteuer würde Familienunternehmen die Luft nehmen
- DIW-Studie: Superreiche jetzt noch reicher
- Würde eine Reichensteuer wirklich die Ungleichheit abbauen? – Der Hintergrund- Die politische Debatte rund um die Vermögensteuer – Und was sagen die Ökonomen? – Weiterführende Informationen zum Thema
- Österreich: Sozialstaat und Umverteilung gewinnen an Bedeutung
INTERNATIONAL - SENTIX Konjunkturindex: Vierter Rückgang in Folge!
- TECH-LOBBYISMUS – Die zehn größten Technologiekonzerne haben laut einer neuen Studie zuletzt 32,75 * Millionen Euro im Jahr für Lobbyarbeit ausgegeben und damit mehr als jede andere Branche
Studie: Globale Autoindustrie mit Rekordgewinnen im ersten Halbjahr - Zahl der Demenzkranken steigt laut WHO rasant – Je älter man wird, desto höher das Risiko auf Demenz – Länder nicht vorbereitet
BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Das Grundvertrauen verbessert sich
- USA Top, Hongkong Flop – China hält Finanzmärkte in Atem
- China plant neue Börse in Peking
- US-Börsenaufsicht erwägt Verbot von Payment for Order Flow-Wertpapierhandel
- ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen im DAX
ZENTRALBANKEN
– EUROPÄISCHE UNION / EZB - Nachfrage von Banken nach EZB-Liquidität auf Rekordtief
- Morgan Stanley: EZB bestätigt monatliches PEPP-Volumen
- EZB-Vizepräsident De Guindos deutet planmäßiges Ende von PEPP an
- Holzmann: EZB kann über Reduzierung von Pandemieprogrammen diskutieren
- Lagarde: Euroraum-BIP Ende 2021 auf Vor-Corona-Niveau – DJN, 1.9.2021
- Wirtschaft entwickelt sich besser als erwartet – dpa-AFX, 1.9.2021
– DEUTSCHLAND / Deutsche Bundesbank - Hans Bentzien: EZB/Weidmann: Risiko zu hoher Inflation nicht ausblenden
USA - Defizit in der US-Handelsbilanz etwas stärker als erwartet gesunken
- EIA: US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet
- US-Inflationserwartungen fallen nicht
- Chicagoer Einkaufsmanagerindex im August kräftig und stärker als erwartet gesunken
- ISM-Index für US-Industrie steigt überraschend im August
- Markit: US-Industrie zeigt im August nachlassende Tendenz
- Auftragseingang der US-Industrie im Juli gestiegen
- USA: Bauausgaben steigen im Juli stärker als erwartet
- USA: Schwebende Hausverkäufe fallen überraschend
- Hauspreise steigen immer stärker – Case-Shiller-Index steigt im Juni um 19,1 Prozent auf Jahressicht
- USA: Häuserpreise steigen im Juni im Vergleich zum Vormonat schwächer als erwartet
- Stimmung der US-Verbraucher trübt sich stärker als erwartet ein
- ADP: US-Privatsektor schafft weitaus weniger Stellen als erwartet
- US-Produktivität steigt im zweiten Quartal um 2,1 Prozent
- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe kräftig gesunken
- Bostic: Anstieg der Zwangsräumungen könnte Aufschwung belasten
- Kreise: US-Justizministerium bereitet weitere Wettbewerbsklage gegen Google vor
BRASILIEN - Brasiliens BIP schrumpft im ersten Quartal leicht
CHINA - China: ‚Caixin‘-Stimmungsindikator für die Industrie enttäuscht ebenfalls
- Delta-Variante belastet überraschend Stimmung in Chinas Unternehmen – Hoffnung auf Wirtschaftserholung im vierten Quartal
- Autoverkäufe in China gehen kräftig zurück
- ELEKTROMOBILITÄT – Die Zeiten, in denen die Exporthoffnungen chinesischer Autohersteller wie Landwind und Brilliance krachend im Crashtest zerschellten, sind vorbei. Stattdessen sichern sich die neuen Elektroauto-Produzenten aus der Volksrepublik Bestnoten wie zuletzt das E-Modell Polestar 2.
JAPAN - Japans Industrieproduktion im Juli gesunken – Aber Aussichten positiv – Arbeitslosenrate sinkt leicht im Juli – Pandemiefolgen: Erholung der Wirtschaft wird noch Jahre dauern
INDIEN - Indiens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal mit Rekordrate infolge des Basiseffekts
TÜRKEI - Türkische Wirtschaft im zweiten Quartal stark erholt
GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger stark ein als erwartet
SCHWEIZ - Kof-Konjunkturbarometer sinkt markant – Wirtschaftsleistung noch immer überdurchschnittlich
- SCHWEIZER BANKEN – Die Konsolidierungswelle im Lager der Schweizer Privatbanken beschleunigt sich laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG und der Hochschule St. Gallen.
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Euroraum-Inflation steigt im August auf 3,0 Prozent – Kerninflation steigt deutlich von 0,7 auf 1,6 Prozent
- European Labour Market Barometer erhält zweiten Dämpfer in Folge
- Wirtschaftsstimmung im Euroraum sinkt im August nach Rekordhoch
- Markit: Dynamik der Eurozone-Industrie lässt im August nach
- Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Juli auf 7,6 Prozent
ITALIEN - Italien: Jahresteuerung zieht im August kräftig auf 2,6 Prozent an
- Italiens Wirtschaft gewinnt im Frühjahr wie erwartet an Fahrt
SPANIEN - Spanien kündigt Erhöhung des Mindestlohns zum dritten Mal binnen zwei Jahren an
FRANKREICH - Französische Inflation steigt im August mit 2,4 Prozent auf höchsten Stand seit fast drei Jahren
- Frankreichs BIP-Wachstum für 2021Q2 von 0,9 auf 1,1 Prozent gegenüber Vorquartal revidiert
DEUTSCHLAND - Kassenärzte-Chef rechnet mit Ende der Pandemie im Frühjahr
- Die deutsche Inflation ist nur halb so dramatisch
- COMMENT: Inflation des Geldes bedeutet Geldwert-Entwertung, damit Kaufkraftverlust. Problem jeder Inflation ist, dass sich die Effekte eines Kaufkraftverlustes das Geld sozusagen merkt.
- Deutsche HVPI-Inflation steigt im August auf 3,4 Prozent
- Bundesländer melden für August weiter steigende Preise – Anstiege der Jahresteuerung zwischen 3,6 und 4,2 Prozent
- IW: Bei weiter steigender Inflation Umverteilungskämpfe
- Deutsche-Bank-Chef Sewing kritisiert Negativzins und „Basel 4“
- DIW: BIP dürfte im dritten Quartal um gut 1 Prozent steigen
- HWWI erwartet verhaltene Erholung der deutschen Wirtschaft
- Markit: Lieferengpässe bremsen deutsche Industrie im August
- Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie empfindlich verschlechtert – Lieferenpässe magerln Autohersteller
- VDMA: Gute Weltkonjunktur sorgt für volle Auftragsbücher
- Deutsche Flughäfen erreichen 40 Prozent des Vorkrisenniveaus – Vor allem kurze Inladsfülge und lange Interkontinentalflüge betroffen
- Kräftiges Umsatzminus für deutschen Einzelhandel im Juli
- Ifo-Institut: Materialengpass auf dem Bau geht weiter zurück
- Handwerksbetriebe kämpfen mit zunehmend umfangreicher gestörten Lieferketten und steigenden Materialengpässen – Impfrate sollte steigen – Unbekannter Impfstatus der Mitarbeiter behindert Auftragsannahmen – Arbeitsmarktprobleme: ausgeschriebene Lehrlingsstellen bleiben zu gut zwei Fünftel unbesetzt
- Allianz: Corona-Hilfen überkompensieren Probleme europäischer KMU – Insolvenzgefährdung gesunken
- Deutsche Tarifverdienste steigen im zweiten Quartal schneller
- TARIFKONFLIKTE – Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 2021 deutlich zugenommen.
- MINDESTRENTE (Pressespiegel / DJN, 31.8.2021) – Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fordert die Einführung einer Mindestrente, um eine weiter steigende Altersarmut in Deutschland zu verhindern.
- Nach gescheiterter einstweiliger Verfügung der Bahn: Lokführerstreiks dauern an – Weiter keine Kompromiss-Signale
- Bahn macht GDL neues Angebot
- Vor dem dritten GDL-Streik: Unternehmen und Fahrgäste planen um – Folgen für Unternehmen: hoher Personalaufwand und hohe Kosten – DBB: Stau von 200 bis 200 Zügen in Spitzenzeiten – Flexible Umweglösungen gesucht – 43 Prozent des Gütertransports werden durch die Bahn abgewickelt – Gefahrgüter müssen per Bahn transportiert werden, darunter viele der Chemieindustrie – „Strek gegen das Klima“: Umschichtung auf Schiff- und LKW-Transporte
- BA: Nachfrage nach Arbeitskräften wächst weiter
- Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im August trotz Sommerpause – Lage am deutschen Arbeitsmarkt besser als erwartet – Kurzarbeiterzahlen sinken – Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen nahmen zu
- Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im August auf 2,58 Millionen
- Heftige Kritik an Einführung von Online-Hinweisportal für Steuerbetrug
- Umfrage: Acht von zehn Bürgern halten Schuldenbremse für richtig
ÖSTERREICH
– STATISTIK
Umsatzplus von 20,3% bei den Dienstleistungsunternehmen im 2. Quartal 2021; dennoch deutlich unter dem Vorkrisenniveau
Austrian Recovery Barometer – Wirtschaft gelingt Turnaround im 2. Quartal 2021
Produktion tierischer Erzeugnisse 2020 weiterhin hoch; Verbrauch von Fleisch und Eiern rückläufig
Rinderbestand bleibt 2021 im Jahresvergleich stabil, leichtes Plus an Schweinen
– MELDUNGEN - „Times“-Uni-Ranking: Erstmals zwei Austro-Unis unter Top 200
- Inflation im August 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 3,1%
- Sozialstaat und Umverteilung gewinnen an Bedeutung
– UNTERNEHMEN
Ölkonzern OMV sieht sich vor großem Wandel
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Eric Schmidt: Die KI-Revolution und der Wettbewerb mit China – Die Gefahr des techno-autoritären Modells – Die richtigen Standards setzen – Koalition entwickelter Demokratien – Den Wandel gestalten
- Nouriel Roubini: The Stagflation Threat Is Real – There is a growing consensus that the US economy’s inflationary pressures and growth challenges are attributable largely to temporary supply bottlenecks that will be alleviated in due course. But there are plenty of reasons to think the optimists will be disappointed
…oooOOOooo…
UMWELT
INTERNATIONAL: Bericht: Schifffahrt hinterlässt großen ökologischen Fußabdruck – ROUNDUP 2 / dpa-AFX, 1.9.2021
Nicht nur der Verkehr auf den Straßen ist eine große Belastung für die Umwelt, auch der Schiffsverkehr verursacht Treibhausgase, die die Erderwärmung vorantreiben. Wie groß die Umweltauswirkungen des Seeverkehrs in Europa tatsächlich sind, wurde nun erstmals in einem Bericht zusammengefasst, den die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) und die Europäische Umweltagentur (EEA) am Mittwoch in Lissabon vorstellen.
Die untersuchten Faktoren waren Luftemissionen, Luftverschmutzungen, Ölleckagen, das Ablassen von Abwasser, Plastik, Unterwasserlärm und der Transport lebender Organismen in andere Gewässer.
Dem Bericht zufolge waren Schiffe im Jahr 2018 für 13,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen, die der Verkehr in der EU verursacht, verantwortlich. Der Straßenverkehr war mit 71 Prozent der größte Verursacher, der Luftverkehr stand für 14,4 Prozent der Emissionen. Alle Verkehrsträger müssten nachhaltiger, intelligenter und widerstandsfähiger werden, sagte Adina Valean, EU-Kommissarin für Verkehr, laut einer Mitteilung. Das schließe auch die Schifffahrt mit ein.
Schiffe spielen als Transportmittel zwischen den EU-Ländern eine große Rolle, sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr. 77 Prozent des europäischen Außenhandels und 35 Prozent des gesamten Handels am Wert gemessen zwischen EU-Mitgliedstaaten verlaufen auf dem Seeweg. Und das wird in den kommenden Jahrzehnten noch mehr werden, schätzen die Experten. „Der Seeverkehr der EU steht vor einem entscheidenden Jahrzehnt für den Übergang zu einem wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigeren Sektor“, heißt es in dem Bericht.
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) unterstrich, die Schifffahrt habe „in den vergangenen Jahrzehnten bereits viel getan, um noch umweltfreundlicher zu werden – und wird in Zukunft noch mehr tun, insbesondere auch beim Klimaschutz“, wie ein Sprecher am Mittwoch in Hamburg mitteilte. „Dafür, dass Schiffe 90 Prozent aller Waren weltweit und drei Viertel des europäischen Außenhandels transportieren, ist ihr Umwelt-Fußabdruck, wie der Bericht zeigt, im Vergleich klein.“
Die Schifffahrtindustrie wird schnellstmöglich auf fossile Brennstoffe wie Kerosin, Schiffsdiesel und Flüssiggas verzichten zu müssen, um die absehbar noch verschärften Klimaziele der EU zu erreichen. Das Problem dabei: Containerschiffe können – anders als Autos – keine langen Strecken mit Batteriekraft bewältigen. Sie brauchen klimaneutrale Flüssigtreibstoffe, die derzeit allerdings weder im großen Maßstab marktreif, noch in riesigen Mengen verfügbar sind.
Eine Herausforderung sind die Emissionen: Insgesamt verursachten Schiffe, die im Jahr 2018 in Häfen der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums anlegten, rund 140 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das waren etwa 18 Prozent aller CO2-Emissionen, die in diesem Jahr weltweit durch den Seeverkehr verursacht wurden. Der Ausstoß an Schwefeldioxid betrug 16 Prozent der weltweiten SO2-Emissionen der internationalen Schifffahrt.
„Obwohl der Seeverkehr in den letzten Jahren seine Umweltbilanz verbessert hat, steht er bei der Dekarbonisierung und Reduzierung der Umweltverschmutzung immer noch vor großen Herausforderungen“, so die EU-Kommissarin. Eine mögliche Lösung sieht man in der Umstellung auf umweltfreundlichere Antriebsarten und Energieträger wie Biokraftstoffe, Batterien, Wasserstoff oder Ammoniak. Die Landstromversorgung, bei der Schiffe ihre Motoren abschalten und an eine Stromquelle anschließen, könne auch in See- und Binnenschifffahrtshäfen eine saubere Energiequelle darstellen, so der Bericht.
Eine andere Herausforderung sei der Unterwasserlärm, den die Schiffe erzeugen und der Meereslebewesen auf unterschiedliche Weise beeinträchtigen kann. Es wird geschätzt, dass der Seeverkehr dazu beigetragen hat, dass sich der Unterwasserlärmpegel in den EU-Gewässern zwischen 2014 und 2019 mehr als verdoppelt hat. Außerdem führt die internationale Schifffahrt dazu, dass Arten in Gewässer transportiert werden, in denen sie nicht heimisch sind, und die dortigen Ökosysteme beeinträchtigen können.
„Der Bericht zeigt deutlich, dass der Seeverkehr in Europa und die gesamte internationale Schifffahrtsgemeinschaft die dringende Verantwortung haben, ihre Bemühungen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks dieses Sektors zu verstärken“, sagte EEA-Chef Hans Bruyninckx
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53829818-roundup-2-bericht-schifffahrt-hinterlaesst-grossen-oekologischen-fussabdruck-016.htm
INTERNATIONAL: Artenvielfalt: Bedrohungskarte zeigt besonders gefährdete Regionen – Science-APA, 31.8.2021
Eine globale Bedrohungskarte der biologischen Vielfalt an Land hat ein internationales Wissenschafterteam erstellt. Als wichtigste Gefahren für Amphibien, Vögel und Säugetiere identifizierten sie die Landwirtschaft, Jagd und Fallenstellerei, Abholzung, Umweltverschmutzung, invasive Arten und den Klimawandel. Die Forscher wollen mit der im Fachjournal „Nature Ecology and Evolution“ veröffentlichten Arbeit Entscheidungen für den Schutz der Artenvielfalt unterstützen.
Das Forscherteam um Mike Harfoot vom UN World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), dem auch Forscher des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien angehörten, stützte sich bei seiner Arbeit u.a. auf die Roten Listen der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN). So identifizierten sie große Landgebiete, wo die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Amphibien-, Säugetier- oder Vogelart durch eine der Hauptgefahren bedroht ist, mehr als 50 Prozent beträgt.
Besonders ausgeprägt ist die Bedrohung in Südostasien, vor allem auf den Inseln Sumatra und Borneo sowie auf Madagaskar. Bei den Amphibien sticht Europa als Region mit hoher Gefährdung hervor – verursacht durch die Kombination von Landwirtschaft, invasive Arten und Umweltverschmutzung. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den Polarregionen, an der Ostküste Australiens und in Südafrika am wahrscheinlichsten, speziell für Vögel.
*** Bedrohung durch Landwirtschaft ***
Für alle drei Wirbeltier-Klassen zusammen stellt den Forschern zufolge die Landwirtschaft die häufigste Bedrohung dar. Bei Vögeln und Säugetieren ist die Jagd und der Fallenfang die größte Gefahr, und zwar auf 50 Prozent der globalen Landfläche für Vögel und 73 Prozent der Fläche für Säugetiere. Bei den Amphibien ist die Bedrohung durch die Landwirtschaft am größten, sie gefährdet auf 44 Prozent der weltweiten Landfläche diese Arten.
„Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend, um Maßnahmen gegen den Verlust der biologischen Vielfalt zu ergreifen“, erklärte Harfoot in einer Aussendung des IIASA. Die Informationen aus der Studie sollen Entscheidungsträgern dabei helfen herauszufinden, wo Maßnahmen zur Verringerung dieser Bedrohungen die besten Ergebnisse erzielen könnten.
*** Wo Schutzmaßnahmen Priorität haben ***
Dafür erstellten die Wissenschafter auch Risikokarten, die Gebiete mit hoher Priorität für Schutzmaßnahmen ausweisen. Dazu gehören der Himalaya, Südostasien, die Ostküste Australiens, der Trockenwald von Madagaskar, Teile des Ostafrikanischen Grabens, die Guineischen Wälder Westafrikas, der Atlantische Regenwald in Südamerika, das Amazonasbecken und die nördlichen Anden bis nach Panama und Costa Rica in Süd- und Mittelamerika.
Den Forscher zufolge wurde der Gesamtdruck auf die biologische Vielfalt bisher unterschätzt. So seien speziell in jenen Regionen, die die größte Bedeutung für die biologische Vielfalt haben, Bedrohungen wie die Jagd und der Klimawandel nicht berücksichtigt worden.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/6412022353962879121
SIEHE DAZU: https://doi.org/10.1038/s41559-021-01542-9
INTERNATIONAL: Rund ein Drittel aller Baumarten weltweit vom Aussterben bedroht – Science-APA, 2.9.2021
Rund ein Drittel aller Baumarten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Ein Bericht warnt, dass vor allem die Rodung von Waldflächen für die Landwirtschaft sowie die Holzgewinnung den Fortbestand vieler Baumarten bedrohen. Auch der Klimawandel hat demnach „deutlich messbare Auswirkungen“. Zu den am stärksten bedrohten Arten gehören demnach Magnolien. Auch Eichen und Ahornbäume werden als gefährdet eingestuft.
Der Bericht wurde von einem internationalen Zusammenschluss botanischer Gärten (Botanic Gardens Conservation International) und Fachleuten der Weltnaturschutzunion (IUCN) vorgelegt. Die IUCN berät ab Freitag bei einer Konferenz im südfranzösischen Marseille über den Schutz von Tier- und Pflanzenarten.
*** 30 Prozent der Baumarten vom Aussterben bedroht ***
Die Studie untersuchte die Bedrohungslage für 58.497 Baumarten weltweit und stellte fest, dass 30 Prozent vom Aussterben bedroht sind. Weitere sieben Prozent werden als „möglicherweise bedroht“ eingestuft. Für 21 Prozent der Arten lagen nicht genügend Daten für eine Bewertung vor. Etwas mehr als 40 Prozent wurden als „nicht gefährdet“ eingestuft. Etwa 142 Baumarten wurden von den Experten als bereits ausgestorben eingestuft, und von mehr als 440 Baumarten gibt es weniger als 50 Exemplare in der freien Natur.
Brasilien, das einen Großteil des Amazonas-Regenwaldes beherbergt, hat dem Bericht zufolge die meisten Baumarten (8.847) – aber auch die meisten bedrohten Arten (1.788), was auf die intensive Landwirtschaft dort zurückzuführen ist. Der höchste Anteil an bedrohten Arten findet sich jedoch in den tropischen Regionen Afrikas, insbesondere auf den Inseln Madagaskar und Mauritius, wo 59 Prozent beziehungsweise 57 Prozent aller Baumarten gefährdet sind.
Jean-Christophe Vie, Generaldirektor der auf Naturschutz spezialisierten Schweizer Stiftung Franklinia, bezeichnete es in einem Vorwort zum Bericht als „schockierend“, dass die Abholzung großer Waldgebiete weitergeht, obwohl Bäume eine wichtige Rolle in der Natur spielen, da sie Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten bieten, CO2 absorbieren und Inhaltsstoffe für Medikamente liefern.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/1058157816358979637
BRASILIEN verzeichnet im August 28.000 Brände im Amazonas-Regenwald – Überblick am Morgen / DJN, 2.9.2021
Im brasilianischen Amazonas-Regenwald sind im August 28.060 Brände verzeichnet worden. Trotz eines Rückgangs von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Zahl der Brände damit weiter auf einem hohen Niveau, wie das brasilianische Institut für Weltraumforschung (Inpe) unter Berufung auf Satellitenbilder mitteilte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53838841-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
ÖSTERREICH: Prioritäten-Liste zur Restauration zerstörter Ökosysteme Österreichs – Science-APA, 31.8.2021
Die EU schreibt den Mitgliedsstaaten vor, 15 Prozent ihrer ramponierten Lebensräume auf Vordermann zu bringen. Welche Wälder, Felder, Grasländer, Weinbaugebiete, Moore und Auen in Österreich am sinnvollsten restauriert werden, identifizierten Experten der Universität Wien, des Umweltbundesamtes und des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) in einer Studie. Die Instandsetzungsmaßnahmen würden 10,7 Milliarden Euro kosten und sollten bis 2050 abgeschlossen sein.
Beim Wald, der etwa die Hälfte der Fläche Österreichs bedeckt, fanden die Forscher das beste Restaurierungspotenzial in Teilen des Wald- und Weinviertels in Niederösterreich, des Mühlviertels in Oberösterreich und in der östlichen Steiermark. Dort sollte man den Anteil an Totholz und alten, mächtigen Bäumen (Veteranenbäumen) erhöhen, gebietsfremde Arten entfernen, sowie eine vielfältige, standorttypische Baumartenzusammensetzung pflanzen, erklärte Florian Danzinger vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Uni Wien im Gespräch mit der APA: „Also sich auf teils weniger schnellwüchsige, aber für die heimische Artenwelt wertvolle Bäume besinnen, und manche davon stehen lassen, auch wenn sie schon lange hiebreif sind.“ Dafür müssten die Waldbewirtschafter freilich finanziell belohnt werden.
„Für die grünlandgeprägten Kulturlandschaftstypen wurden vor allem das Waldviertel (NÖ), das Inn- und Hausruckviertel (OÖ) und der Flachgau (Salzburg) als Schwerpunktregionen identifiziert“, so die Forscher in einer Aussendung der Uni Wien. Beim Ackerbau priorisierten sie das westliche Wein- und das östliche Waldviertel, die Thermenlinie und das Marchfeld in Niederösterreich, sowie im Burgenland die Regionen Parndorfer Platte und Neusiedlersee-Seewinkel. Beim Weinbau sollten sich die Anstrengungen auf Teile des Weinviertels und die Region Neusiedlersee-Seewinkel konzentrieren.
*** Mehr Zwischenstrukturen wie Hecken und Blühstreifen schaffen ***
In den landwirtschaftlich genutzten Grünflächen, Feldern, Weingärten und Obstplantagen sollten mehr Zwischenstrukturen geschaffen werden, so Danzinger. Die teils riesigen Flächen würden enorm von Hecken, Baumzeilen und Blühstreifen profitieren. „Das ist auch wichtig für die Klimawandelfitness, weil sie die Winderosion und Abspülung durch Starkregen vermindern und im Winter den Schneefang gewährleisten“, sagte er. Dieser Nutzen würde aber nicht die Zusatzkosten und den Verlust an Ernteflächen aufwiegen. Deshalb bräuchte es zusätzliche Förderungen. Bei den Obstplantagen sollte durch finanzielle Anreize erreicht werden, dass manche weniger intensiv genutzt werden und die Betreiber auf Hagelnetze und Ähnliches verzichten, meint der Forscher. Durch Strukturmaßnahmen und extensive Bewirtschaftung würde in all diesen Gebieten auch der „landschaftsästhetischen Wert“ steigen.
Bei den Auen und Mooren sehen die Studienautoren Restaurierungsbedarf im Osten Österreichs, zum Beispiel beim Schilfgürtel des Neusiedlersees, dessen Verlandungsmoor mit einer Fläche von 9.600 Hektar zu den größten europäischen Schilfgebieten zählt, aber auch in den Alpen. Die alpinen Moore sollte man von vorhandenen Drainagen befreien und alle paar Meter „Spundwände“ aus Holz einziehen, die den Wasserabfluss verlangsamen. Dadurch bilden sich kleine, wassergefüllte Staustufen, wo Torfmoos und andere Sumpfpflanzen gedeihen. „Bei den Auen ist es vor allem wichtig, wieder eine Fließwasserdynamik zu ermöglichen“, so Danzinger. Altarme sollten wieder an die Hauptgewässer angeschlossen und mit einer ausreichenden Wassermenge dotiert werden.
*** Vier „Degradationsstufen“ ***
Die Forscher sortierten in der Studie die verschiedenen österreichischen Ökosysteme und Landschaften nach allen möglichen vorhandenen Daten in vier „Degradationsstufen“. „Es war eine große methodische Herausforderung, das Ganze einheitlich darzustellen, weil je nach den Ökosystemen ganz unterschiedliche Daten zur Verfügung gestanden sind“, sagte David Paternoster vom Umweltbundesamt. Dennoch konnten sie eine datenbasierte Einschätzung abliefern. „In anderen europäischen Ländern musste man stärker auf eine auf Experteneinschätzung basierte Darstellung setzen, das wollten und konnten wir in Österreich vermeiden“, erklärte er.
Nachdem sie den Zustand der jeweiligen Ökosysteme eingeschätzt hatten, suchten die Forscher mögliche Zusatznutzen bei einer Restauration. „Zum Beispiel, dass sie innerhalb von Schutzgebieten liegen oder ein Netzwerk von Lebensraumkorridoren erweitern“, sagte Danzinger. Manche der als sehr schlecht eingestuften Landschaften sind deshalb nicht in der Priorisierungsliste, weil es schwer wäre, sie instand zu setzen, und es keinen Mitnahmeeffekt gäbe. Dafür sind andere Gebiete in den 15 Prozent der für den jeweiligen Ökosystemtyp priorisierten Gebiete, weil ihre Instandsetzung zusätzliche Vorteile für den Natur- und Klimaschutz bringt.
Der vom Umweltministerium in Auftrag gegebene Priorisierungs-Bericht wird aktuell beim Erstellen der österreichischen Biodiversitätsstrategie berücksichtigt, so Paternoster. Von der EU würde außerdem bis Ende 2021 ein Aktionsplan (Nature Restoration Action Plan) ausgearbeitet, der für die Mitgliedsländer rechtlich bindende Ziele zur Ökosystemrestauration hat. Die 15-Prozent-Ziele sollen bis 2050 erreicht werden.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/1497808363208022953
SIEHE DAZU:
=> Endbericht der Studie „Strategischer Rahmen für eine Priorisierung zur Wiederherstellung von Ökosystemen auf nationalem und subnationalem Niveau“
QUELLE: https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2370&cHash=4babebf3d5c56f46ecdeac55d9ea4bc6
GESELLSCHAFT
China verbietet Reality-Talentshows: Regierung gegen „abnormale Ästhetik“ und „verweichlichte Männer“ – Überblick am Abend / DJN, 2.9.2021
China hat Reality-Talentshows verboten und Medien dazu angehalten, eine maskulinere Repräsentation von Männern zu fördern. „Sendeanstalten dürfen keine Formate mit der Schaffung mutmaßlicher Heldenfiguren sowie keine Varieté- und Reality-Shows zeigen“, erklärte die staatliche Regulierungsbehörde. Sie wies die Sender an, sich gegen „abnormale Ästhetik“ wie „verweichlichte“ Männer sowie gegen „vulgäre Influencer“, aufgeblasene Gagen und „verkommene Moral“ von Künstlern zu wehren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53845965-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
BILDUNG
GROSSBRITANNIEN: Brexit-Schlag für britische Unis: Nur noch halb so viel EU-Studenten – dpa-AFX, 4.9.2021
Der Brexit ist an den britischen Universitäten angekommen. Zum Start des akademischen Jahres in diesem Herbst beginnen nur 800 Deutsche ihr Studium im Vereinigten Königreich, wie aus Zahlen der zentralen Vergabestelle UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) hervorgeht. Das sind nur noch halb so viel wie im Vorjahr, als 1600 Deutsche gezählt wurden. Damals galt noch eine Brexit-Übergangsphase mit weitgehend gleichen Regeln wie zuvor. Noch stärker ist die Gesamtzahl der Studentinnen und Studenten aus der EU gesunken: von 27 750 auf 11 700.
Während es vor Großbritanniens EU-Austritt sehr unkompliziert war, im britischen Ausland zu studieren und zu forschen, ist nun durch neue Visa-Bestimmungen mehr Aufwand notwendig. Auch kurzfristige Studienaufenthalte sind komplizierter geworden. Mit dem Brexit ist das Vereinigte Königreich auch aus dem EU-eigenen Austauschprogramm Erasmus ausgestiegen, über das Tausende junge Menschen aus der EU jahrelang ihre Auslandssemester auf der Insel verbrachten.
Auch die Corona-Pandemie hat zum Rückgang der Studienanfänger beigetragen. Maßgeblich sind aber vor allem deutlich gestiegene Studienkosten und mehr Bürokratie seit dem Brexit. „Als Großbritannien noch Teil der Europäischen Union war, gab es den Gleichheitsgrundsatz. Da mussten alle dieselben Studiengebühren zahlen“, sagte Ulrich Hoppe, Chef der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in London. „Das hat sich jetzt geändert.“
Zahlten EU-Bürger in England bisher wie britische und irische Studenten maximal 9250 Pfund (10 800 Euro) Studiengebühren pro Jahr, können die Universitäten vom neuen akademischen Jahr an von Anfängern aus der EU – aber auch etwa aus der Schweiz – deutlich mehr verlangen. Hinzu kommt: Wer neu ins Land kommt, kann keine staatliche Unterstützung beantragen. Außerdem brauchen nun alle, die erst 2021 nach Großbritannien gezogen sind, ein Visum. Auch hier sind hohe Kosten und großer bürokratischer Aufwand die Folge.
Das britische Bildungsministerium kommentierte die Zahlen nicht. Aus der Regierung hieß es lediglich, Studentinnen und Studenten aus der EU seien ein wichtiger und geschätzter Teil des Hochschulsystems. Peter Mason vom Hochschulverbund Universities UK International räumte ein: „Nach dem Brexit gab es eine Anpassungsphase, da EU-Studenten wie andere internationale Bewerber behandelt werden, im Gegensatz zu Studenten mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich.“ Er betonte aber, EU-Studenten seien weiterhin willkommen, Lehrende aus der Staatengemeinschaft spielten eine wichtige Rolle.
Doch die Skepsis ist groß. Vor allem der britische Ausstieg aus dem EU-Studentenaustauschprogramm Erasmus lasse die Hochschulen unattraktiver erscheinen, sagte der Politologe Simon Usherwood von der Open University, der größten staatlichen Hochschule des Landes, der Deutschen Presse-Agentur.
Als Ersatz hat die Regierung ein Programm namens Turing Scheme ins Leben gerufen. Damit werden in diesem akademischen Jahr 363 Projekte gefördert, die mehr als 40 000 Schüler und Studenten die Möglichkeit zum Auslandseinsatz auch in Deutschland bieten. Wie viele davon die Chance wirklich nutzen, ist aber nicht bekannt. Usherwood sagte, es sei viel Zeit nötig, um ansatzweise ähnliche Kontakte wie bei Erasmus aufzubauen.
Betroffen seien bisher vor allem Geistes- und Kunstwissenschaften, sagte Usherwood. Er warnte, dass der Brexit auch für die Lehrkräfte Konsequenzen habe. „Je länger das Vereinigte Königreich keine stabilen Beziehungen zur EU unterhält, desto schwieriger wird es, die hochqualifizierten Personen anzuziehen, die zum Erfolg der Branche beigetragen haben.“
AHK-Chef Hoppe teilt die Befürchtungen. „Der Studienstandort ist nicht mehr so attraktiv“, sagte er der dpa. Hoppe warnte, die Entwicklung könne zur weiteren Entfremdung zwischen Großbritannien und der EU beitragen. „Da geht was verloren.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53858554-brexit-schlag-fuer-britische-unis-nur-noch-halb-so-viel-eu-studenten-016.htm
DEUTSCHLAND: Weniger Hochschulabschlüsse im Corona-Jahr 2020 laut Statistische Bundesamt (Destatis) – Unterschiedliche Rückgänge je Studienabschluss und Studienfach – dts, 3.9.2021
Die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent zurückgegangen. Im Wintersemester 2019/2020 und Sommersemester 2020 erwarben rund 477.000 Absolventen einen Hochschulabschluss, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.
Mit Ausnahme der Jahre 2018 war die Zahl der Absolventen seit 2001 kontinuierlich gestiegen. Als Grund für den Rückgang nennen die Statistiker die Corona-Pandemie. Die Absolventenzahlen sanken in allen Bundesländern: Den stärksten Rückgang gab es in Berlin mit -12 Prozent, gefolgt von Brandenburg (-11 Prozent), Bremen (-10 Prozent) und Thüringen (-9 Prozent). In den Bundesländern mit vergleichsweise hohen Absolventenzahlen betrug der Rückgang für Bayern -8 Prozent, für Baden-Württemberg -7 Prozent und für Hessen -6 Prozent.
In Nordrhein-Westfalen, an dessen Hochschulen 22,5 Prozent aller Abschlüsse erworben wurden, machten drei Prozent weniger Studierende und Promovierende als im Vorjahr einen Abschluss. Die Hälfte (50 Prozent) aller Hochschulabschlüsse waren Bachelorabschlüsse, gut ein Viertel (28 Prozent) Masterabschlüsse. Die Zahl der abgeschlossenen Bachelortitel sank dabei um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Zahl der Masterabschlüsse um 7 Prozent. Bei Lehramtsprüfungen (9 Prozent aller Hochschulabschlüsse) ging die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent zurück und bei den Promotionen (5 Prozent aller Abschlüsse) um 7 Prozent.
Der Bachelortitel wurde besonders in der Fächergruppe Geisteswissenschaften (-16 Prozent) weniger abgeschlossen, gefolgt von Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (-14 Prozent) und Mathematik, Naturwissenschaften (-13 Prozent). Bei den Masterabschlüssen war der Rückgang in den Fächergruppen Geisteswissenschaften und Kunst, Kunstwissenschaft (jeweils -14 Prozent) am deutlichsten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53849535-weniger-hochschulabschluesse-im-corona-jahr-2020-003.htm
CYBERKRIMINALITÄT
Florian Fügemann: 83 von 100 Firmen rechnen mit Cyber-Attacke – 3.600 Unternehmen befragt: „Cyber Risk Index“ von Trend Micro attestiert hohe Gefährdungslage – Pressetext, 31.8.2021
Die Gefährdungslage für deutsche Unternehmen durch Cybercrime bleibt hoch. Auch für die nächsten zwölf Monate rechnen 83 Prozent der Firmen mit Datendiebstahl. Ein Großteil der Befragten beurteilt Angriffe als „etwas“ bis „sehr“ wahrscheinlich, wie der aktuelle „Cyber Risk Index“ (CRI) des IT-Security-Dienstleistern Trend Micro http://trendmicro.com zeigt.
*** „Ein erhöhtes Risiko“ ***
Für den aktuellen CRI sind in der ersten Jahreshälfte 2021 über 3.600 Unternehmen jeder Größenordnung und Branche in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika befragt worden. Der CRI basiert auf einer Skala von -10 bis plus 10, wobei -10 den höchsten Risikograd darstellt. Der aktuelle globale Index liegt bei -0,42. Gegenüber dem vergangenen Jahr verzeichnete sich ein leichter Anstieg, was ein „erhöhtes“ Risiko bedeutet. Der CRI für Europa beträgt -0,22 – dies entspricht einem „erhöhten“ Risiko. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor einem halben Jahr (-0,13) ist der CRI leicht angestiegen.
Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit 0,38 (im Vergleich zu 1,02 vor einem halben Jahr) bei einem im Schnitt niedrigeren Bedrohungsniveau. Das höchste Risiko im weltweiten Vergleich hat die Region Nordamerika mit -1,27. Französische und britische Unternehmen fühlen sich mit 78 und 75 Prozent etwas besser geschützt als ihre deutschen Nachbarn. Neben den Kundendaten wird außerdem erwartet, dass weitere Datenbestände und sogenanntes „geistiges Eigentum“ im Rahmen einer Cyber-Attacke abfließen können.
*** IT-Security Chefsache ***
„Um das Cyber-Risiko zu senken, müssen sich Unternehmen besser vorbereiten, indem sie sich zunächst auf die Grundlagen konzentrieren: Die am meisten gefährdeten kritischen Daten identifizieren, sich auf die für ihr Unternehmen wichtigsten Bedrohungen konzentrieren und einen mehrschichtigen Schutz durch umfassend vernetzte Plattformen bereitstellen“, so Richard Werner, Business Consultant bei Trend Micro. „Wichtig ist zu verstehen, dass es sich bei der Verschärfung des Bedrohungsniveaus nicht um eine vorübergehende Welle handelt. Aufgrund äußerer Faktoren verändert sich die IT-Sicherheitslandschaft aktuell stark. Entscheidend ist jedoch der Spielraum, den Unternehmen für ihre Verteidigung gewähren. IT-Security muss als geschäftskritisch wahrgenommen werden.“
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210831023
Umfrage: IT-Sicherheit im Homeoffice kommt bei vielen Firmen zu kurz – dpa-AFX, 31.8.2021
Viele Beschäftigte arbeiten in der Corona-Krise von zu Hause aus – doch aus Sicht der Versicherungswirtschaft haben die Unternehmen dabei zu wenig die IT-Sicherheit im Blick. Bei einer Umfrage im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) unter 300 mittelständischen Unternehmen gab rund ein Viertel von ihnen an, dass sich die Zahl der Cyberattacken in der Pandemie erhöht habe. Der GDV präsentierte die Ergebnisse am Dienstag in Berlin.
Gleichzeitig haben aber nur sieben Prozent der befragten Firmen eigenen Angaben zufolge in zusätzliche IT-Sicherheit investiert. Mit acht Prozent liegt der Anteil derjenigen, die ihre Regeln für Datenschutz und IT-Sicherheit mit Blick auf die Arbeit im Homeoffice überarbeitet haben, nur wenig höher.
„Dass zu Beginn der Pandemie viele Sicherheitsroutinen gestört waren, ist noch verständlich“, teilte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen mit. „Aber wer seine Prozesse jetzt noch nicht an die neue Situation angepasst hat, handelt fahrlässig und lädt Cyberkriminelle und Betrüger geradezu ein.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53816068-umfrage-it-sicherheit-im-homeoffice-kommt-bei-vielen-firmen-zu-kurz-016.htm
Risiken beim Online-Banking: Kriminelle buchen hohe Summe ab – NDR, 30.8.2021
Viele Bankgeschäfte werden inzwischen online abgewickelt. Allerdings haben auch Verbrecher den digitalen Weg entdeckt.
QUELLE (8-min-Video): https://www.youtube.com/watch?v=8Knp8Q5MYa4
HINWEIS: Interessanter, aber wohl nicht mehr ganz aktueller Beitrag.
MIGRATION und SICHERHEIT
TURKSTAATEN: Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan: Angst vor „islamistischem Virus“: warum Afghanistans Nachbarn keine Flüchtlinge wollen – Russland ebenfalls mit verschlossenen Türen – FOKUS, 5.9.2021
Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wollen Tausende Menschen das Land verlassen. Allein aus geographischer Nähe würden sich Afghanistans Nachbarstaaten Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan als Zufluchtsländer anbieten. Doch diese erteilen der Aufnahme von Flüchtenden eine Absage. Es herrscht Angst vor dem Islamismus.
Es ist eine Frage, die wie ein Damoklesschwert über der EU schwebt: Wer nimmt die aus Afghanistan flüchtenden Menschen auf? Deutschland für seinen Teil hat auf diese Frage bisher verhaltener als im Herbst 2015 reagiert. So erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass bevor die EU Flüchtende aufnehme, zunächst sichere Möglichkeiten in der Nachbarschaft Afghanistans eruiert werden müssten.
Doch wenn es nach den drei Anrainerstaaten Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan geht, sollte die EU bei der Aufnahme von Flüchtlingen die Rechnung lieber ohne sie machen.
*** Angst vor Islamismus: Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan wollen keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen ***
„Die drei Länder sind derzeit nicht geneigt, große Menschenmengen aufzunehmen“, sagt Zentralasien-Experte Urs Unkauf im Gespräch mit FOCUS Online. Dafür gebe es auf der einen Seite individuelle Motive: So hätte Turkmenistan ohnehin eine sehr restriktive Einreisepolitik, die seit der Pandemie die Einreise von Ausländern gänzlich verbiete. Auch davor hätte das Land nur wenige Tausend Visa verteilt.
Tadschikistan hingegen gilt als das ärmste Land innerhalb der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) – einer Organisation, der sich die meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion anschlossen – und verfügt kaum über die Ressourcen, um Flüchtende aufzunehmen.
Auch auf Grund geographischer Gegebenheiten sei es für die drei Anrainerstaaten schwierig, Strukturen für Fluchthilfe zu schaffen. Immerhin ist die Grenze zwischen Afghanistan und Turkmenistan eine Wüste; die Chance, eine Flucht zu Fuß zu überleben, ist gering. Auf der Fluchtroute von Afghanistan nach Tadschikistan verhält es sich ähnlich – denn hier trennt ein Bergmassiv die beiden Länder.
*** Zentralasiatische Staaten fürchten Import von islamistischem Gedankengut ***
Ein zentraler politischer Grund eint jedoch alle drei zentralasiatischen Länder: „Sie befürchten, dass die Flüchtlinge islamistisches Gedankengut mit sich bringen und somit zur politischen Radikalisierung innerhalb der säkularen Aufnahmegesellschaften beitragen“, erklärt Unkauf. Die Zentralasien-Expertin Beate Eschment nannte die Problematik im „Deutschlandfunk“ die Angst vor dem „islamistischen Virus“.
Die Furcht davor, verdeckte Taliban zu importieren, die radikalislamistische Bewegungen innerhalb Usbekistans, Tadschikistans und Turkmenistans bestärken könnten, sei laut Unkauf groß. Bereits in den 1990er Jahren hatten säkulare und islamistische Kräfte in Tadschikistan einander bekämpft. Um derartige Unruhen zu vermeiden, würden die Präsidenten der drei Länder eine Zuwanderung aus Staaten mit radikalislamistischen Bewegungen konsequent ablehnen.
„Alles, was ein Wiedererstarken solcher Bewegungen bewirken könnte, soll kategorisch ausgeschlossen werden“, sagt der Regionalexperte. „Man versucht, mit allen politischen Mitteln, potentiellen extremen Bewegungen im nationalen wie regionalen Kontext den Nährboden zu entziehen.“
*** Auch Russland wird sich nicht für afghanische Flüchtlinge öffnen ***
In diesem Punkt ziehen die zentralasiatischen Staaten auch mit Russland an einem Strang. Moskau setzt ebenfalls daran, eine potenzielle Islamisierung der Region zu unterbinden. Das zeige nicht zuletzt das konsequente Vorgehen gegen das islamisch geprägte und nach dem Ende der Sowjetunion nach Unabhängigkeit strebende Tschetschenien, mit dem sich Russland in den 90er Jahren blutige Kämpfe lieferte.
„Das ist ein Zeichen dafür, dass Russland sichere Grenzen als prioritär ansieht und sich aktuell nicht weiter für die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge öffnen wird“, so Unkauf, der ebenfalls als diplomatischer Berater des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft tätig ist.
*** „Die Länder beschäftigen sich aktuell vorrangig mit ihren inneren Angelegenheiten und nicht mit äußeren Problemen“ ***
Neben der Angst vor importiertem Islamismus sind es jedoch auch geschichtliche Erfahrungen, auf Grund derer Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan gegenwärtig Flüchtenden aus Afghanistan ausschließen. „Diese Länder feiern 30 Jahre Unabhängigkeit dieses Jahr. 30 Jahre sind in der Geschichte eine kurze Zeit“, sagt der Zentralasien-Experte. In diesem Zeitraum müssten sich die Strukturen, auch diejenigen der Gesellschaften, teilweise noch herausbilden. „Die Länder beschäftigen sich aktuell vorrangig mit ihren inneren Angelegenheiten und nicht mit den äußeren Problemen“, erklärt Unkauf.
Und diese würden eine massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen unweigerlich mit sich bringen, da die afghanische Bevölkerung sehr heterogen sei und sich aus mehreren ethnischen Gruppen wie den Paschtunen, den Hazara sowie den Minderheiten der Turkmenen, Usbeken und Tadschiken und vielen weiteren zusammensetze. „Für die innere Stabilität der Nachbarländer wäre es eine ernsthafte Belastungsprobe, wenn derart vielfältige Personengruppen aufgenommen würden“, sagt Unkauf.
*** Ein Flüchtlingsdeal mit der EU wird nicht zustandekommen ***
Eine Art Flüchtlingsdeal zwischen der EU und Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan werde es nach Einschätzungen des Experten daher nicht geben. „Auch wenn man denkt, dass das die näherliegende Lösung sei – etwa, weil Afghanistan im Hinblick auf Religion und Kultur größere Schnittmengen mit den drei zentralasiatischen Ländern als mit den Ländern der EU habe. Das wird dort allerdings nicht so wahrgenommen“, so Unkauf.
Auf der anderen Seite verstehen sich die Länder jedoch auch nicht als Teil des Westens – geschweige denn von dessen bisherigem Agieren in der Region. „Das Problem ist, dass die Sicherheitsarchitektur, die der Westen über 20 Jahre implementieren wollte, gescheitert ist. Die westliche Sicherheitspolitik hat zu wenig mit den regionalen Akteuren kooperiert“, analysiert der Zentralasien-Experte.
Nicht nur China, Russland, die Türkei und der Iran würden dabei eine Rolle spielen, sondern auch Nachbarstaaten wie Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. „Hätte man das Gespräch gesucht, gebe es vielleicht eine andere Haltung gegenüber der Flüchtlingspolitik. Denn jetzt sagen die Länder: ‚Man redet mit uns, jetzt wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist‘“, so Unkauf.
*** Afghanistan-Krise: „Deutschland muss die Akteure vor Ort einbinden“ ***
Allein deswegen müsse Deutschland unbedingt den Kontakt zu und die Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Staaten ausbauen – etwa im Rahmen eines Dialogs mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, einer politisch regionalen Organisation, die die politische Ordnung in Eurasien erhalten soll und auf das Zusammenwirken der Mitgliederstaaten, zum Beispiel Usbekistan und Tadschikistan, abzielt.
„Die Herausforderungen der deutschen Politik im Hinblick auf Zentralasien ist, dass das Sicherheits-Dilemma nur gelöst werden kann, wenn man die Akteure vor Ort einbindet“, sagt der diplomatische Berater. Gegenwärtig komme vor allem Usbekistan Deutschland sehr entgegen, indem es der Bundeswehr den Taschkenter Flughafen sowie logistische und technische Hilfen für die Evakuierungen zur Verfügung stelle.
Nun müsse die deutsche Seite nachziehen und eine langfristige Kommunikationsstrategie definieren. „Was jetzt in Afghanistan passiert, muss die Konsequenz für den strategischen Dialog mit den regionalen Akteuren und globalen Gestaltungsmächten in der Region sein“, sagt Unkauf. Diese könnte durch Gesprächsangebote stabilisiert werden. In dem Zuge müsse die Politik muss auch mehr Zentralasien-Kompetenz aufbauen und die historischen, kulturellen und sozio-ökonomischen Spezifika der jeweiligen Staaten stärker in den Blick nehmen . „Da hat das westliche Bündnis noch viel Arbeit vor sich“, so der Zentralasien-Experte.
QUELLE: https://www.focus.de/politik/ausland/usbekistan-turkmenistan-tadschikistan-angst-vor-dem-islamistischen-virus-warum-afghanistans-nachbarn-keine-fluechtlinge-wollen_id_20902906.html
SIEHE DAZU:
=> Afghanistan: Nachbarländer in großer Unruhe – Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, aber auch China, Russland und die Türkei: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Länder in der Nachbarschaft in große Unruhe versetzt. Vor allem die steigende Zahl der Geflüchteten bereitet den Regierungen Sorge. Neben verstärktem Grenzschutz will man aber auch auf Dialog setzen – nicht zuletzt mit den Taliban selbst – ORF, 16.8.2021
QUELLE: https://orf.at/stories/3225071/
=> Steffen Richter: Afghanistans Nachbarländer: Die Angst der Anrainer – Die Zeit, 17.8.2021
QUELLE: https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/afghanistan-nachbarlaender-taliban-pakistan-iran-usbekistan-fluechtlinge-uebersicht
USBEKISTAN – DEUTSCHLAND: Usbekistan sichert Maas Hilfe bei Evakuierungen Deutschen, Ortskräften und Schutzbedürftigen zu – Zurückweisung afghanischer Flüchtlinge an den Grenzen – FAZ, 30.8.2021
Während am Flughafen Kabul auch die Rettungsmission der Amerikaner vor dem Ende steht, reist Außenminister Maas durch die Nachbarstaaten, um Wege für die zurückgelassenen Ortskräfte zu suchen und eine gemeinsame Linie abzustimmen.
Usbekistan will die Ausreise von Deutschen, Ortskräften und Schutzbedürftigen aus Afghanistan unterstützen. Usbekistan sei bereit, bei dieser Personengruppe zu helfen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Es gehe der Bundesregierung um den Transit der Menschen, die nach Deutschland geflogen werden sollen. „Darüber hinaus haben wir keine Anfrage gestellt“, sagte mit Blick auf die Debatte über die Aufnahme aller afghanischen Flüchtlinge in den Nachbarstaaten. Derzeit weist Usbekistan viele Flüchtlinge aus Afghanistan an der Grenze zurück.
Maas bezeichnete es als sehr schwierige Aufgabe, in der zweiten Evakuierungsphase nach Ende der Militärflüge Menschen über den Landweg aus Afghanistan zu holen. Zum einen brauche man Garantien der Taliban. Zum anderen müsse man vermeiden, wie in Kabul öffentliche Sammelpunkte zu benennen. Es warteten dann dort auch Zehntausende, die nicht zu der Gruppe gehörten, die Deutschland evakuieren wolle.
Maas: Alle Nachbarstaaten an einen Tisch
Die Nachbarstaaten Afghanistans wollen sich nach seinen Angaben ihre Afghanistan-Politik absprechen. „Es gibt Bemühungen, alle Nachbarstaaten an einen Tisch zu bekommen“, sagte Maas vor dem Weiterflug nach Tadschikistan. Alle wichtigen Akteure, auch Russland und China, sollten dabei sein. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die laufenden Gespräche über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zu Afghanistan. Dort werde sich zeigen, ob in Moskau und Peking die Bereitschaft zur Kooperation bestehe.
China und Russland gehören neben den Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien zu den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats, der das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen ist.
Anders als die westlichen Staaten sind die beiden Länder auch nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan noch mit Botschaften in Kabul vertreten. Laut Maas ist auch eine Afghanistan-Konferenz der Nachbarländer geplant. Dazu zählen neben Usbekistan auch Tadschikistan, Pakistan, Turkmenistan, Iran und China.
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-usbekistan-sichert-maas-hilfe-bei-evakuierungen-zu-17508198.html
PAKISTAN (Pressespiegel / DJN, 31.8.2021) – Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Pakistans Botschafter in Deutschland der Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem Nachbarland eine Absage erteilt. „Pakistan nimmt keine weiteren Flüchtlinge aus Afghanistan auf“, sagte Mohammad Faisal. Sein Land unterstütze allerdings mit allen Kräften die Ausreise von Afghanen in andere Länder. Die Grenzen würden erst einmal geöffnet bleiben. (Tagesspiegel)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813122-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
EUROPÄISCHE UNION will mit Hilfen für afghanische Nachbarländer große Migrationsbewegung abwenden – DJN, Überblick am Abend / DJN, 30.8.2021
Mit mehr finanziellen Hilfen für die Nachbarstaaten Afghanistans sowie potenzielle Transitländer will die EU eine große Fluchtbewegung aus dem Land in Richtung Europa abwenden. Die EU sei entschlossen, eine neuerliche „unkontrollierte und großangelegte illegale“ Einwanderung nach Europa zu verhindern, heißt es in einem Entwurf für das EU-Innenministertreffen am Dienstag, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Vorgesehen sind auch Sicherheitsüberprüfungen von evakuierten Afghanen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53809987-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
EUROPÄISCHE UNION: Vor dem Sondertreffen der EU-Innenminister zu Afghanistan hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Widerstand gegen den EU-Vorsitz Sloweniens und gegen Österreich aufgerufen. „Ich hoffe, dass es Widerstand gibt gegen Herrn Kurz aus Österreich und Herrn Jansa aus Slowenien, die sich beide klar und definitiv im Einklang mit Orban, Salvini und Le Pen befinden“, sagte Asselborn, der auch Minister für Immigration und Asyl ist. Österreich und Slowenien hatten erklärte, keine Kontingente für besonders gefährdete Flüchtlinge im Rahmen von Resettlement-Programmen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) zur Verfügung zu stellen. Slowenien wäre lediglich bereit, einige Ortskräfte zu übernehmen, die zuvor für Nato und EU gearbeitet haben. (Welt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813122-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
UNGARN – FLÜCHTLINGE (Pressespiegel / DJN, 1.9.2021) – Ungarn stellt sich klar gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Afghanistan und sieht sich in seiner Haltung der Abgrenzung von 2015 bestätigt. „Wir müssen vor Ort helfen. Die EU sollte ihre Hilfe exportieren, und nicht auf europäischen Boden unlösbare Probleme importieren“, sagte Ungarns Botschafter Peter Györkös dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (RND)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53825487-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
ÖSTERREICH für starkes EU-Engagement in Nachbarstaaten Afghanistans – EU stärkt humanitäre Hilfe und die Stabilisierungsarbeit in der Nachbarschaft – dts, 2.9.2021
Kurz vor dem EU-Außenministertreffen in Slowenien hat sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg für europäische Hilfe in den Nachbarstaaten Afghanistans ausgesprochen. Man werde sich engagieren, sagte er am Donnerstag im RBB-Inforadio.
Die Europäische Union werde die humanitäre Hilfe und die Stabilisierungsarbeit in der Nachbarschaft verstärken. „Ich glaube: Das ist unser wesentliches Ziel, dass wir das Problem in Afghanistan möglichst ‚containen‘.“ Schallenberg sprach sich auch für Gespräche mit den Taliban aus – unter bestimmten Bedingungen: „Respekt der Grund- und Freiheitsrechte für alle afghanischen Staatsbürger, Respekt auch der Minderheitenrechte, Inklusivität und auch Respekt der internationalen Verpflichtungen, die Afghanistan eingegangen ist. Dass es natürlich auf technischer Ebene Kontakte geben muss, und auch gegeben hat, ist selbstverständlich.“
Aber es sei nicht so, dass man die neuen Machthaber in Kabul als legitime Vertretung Afghanistans anerkenne. Europa sei gut beraten, keinen Blankoscheck auszustellen, so der Außenminister. „Auch wenn die Taliban jetzt durchaus vernünftige Signale auszuschicken scheinen, sind berechtigte Zweifel angesagt.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53839517-oesterreich-fuer-starkes-eu-engagement-in-nachbarstaaten-afghanistans-003.htm
ÖSTERREICH lehnt jede weitere Aufnahme von Afghanen ab – dtx, 1.9.2021
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz warnt angesichts der Lage in Afghanistan vor einer neuen Massenflucht. Aktuelle Bilder von der Grenze Afghanistans zum Iran seien „alarmierend“, sagte Kurz dem TV-Sender „Bild“.
Er warnt vor „ungesteuerter Migration“ nach Europa. Denn: „Der Blick in die Zukunft Afghanistans ist ein düsterer.“ Aber noch gebe es „viele Möglichkeiten, ein neues 2015 zu verhindern“. Auch nach der Machtübernahme der Taliban bleibt Österreich nach den Worten von Kurz bei der bisherigen harten Linie gegenüber afghanischen Flüchtlingen: „Wir werden nicht zusätzlich Menschen aus Afghanistan aufnehmen.“
Außerdem sollen weiterhin Afghanen aus Österreich abgeschoben werden, aber nicht nach Kabul, sondern in ihre ursprünglichen Ankunftsländer in Europa wie zum Beispiel Rumänien.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53831343-oesterreich-lehnt-jede-weitere-aufnahme-von-afghanen-ab-003.htm
UNGLEICHHEIT und NIEDRIGZINS – VERMÖGENSSTEUER – ERBSCHAFTSSTEUER
Thomas Fuster: Sind die Reichen schuld an den niedrigen Zinsen? Die These sorgt derzeit für viel Zündstoff – Das Zinsniveau sinkt seit Jahrzehnten. Erklärt wird der Trend oft mit der Alterung der Bevölkerung in Industriestaaten. Drei Ökonomen erheben Einspruch. Sie rücken die Ungleichheit der Einkommen ins Zentrum. Stimmt ihre These, hätte dies weitreichende Folgen – Zu viele Spargelder – Babyboomer taugen nicht zur Erklärung – Ein sich selbst verstärkender Prozess – Neue Zürcher Zeitung, 5.9.2021
Ist die wachsende Ungleichheit verantwortlich für die extrem niedrigen Zinsen? Die These sorgt derzeit in der Ökonomenzunft für eine kontroverse Debatte. Der Auslöser der Diskussion ist eine Forschungsarbeit, die vor einer Woche am weltweit wichtigsten Zentralbankentreffen, nämlich jenem im amerikanischen Jackson Hole, präsentiert worden ist. Die Arbeit geht der Frage nach, weshalb die Zinsen seit Jahrzehnten sinken und die Vermögenspreise steigen.
*** Zu viele Spargelder ***
Einig sind sich die meisten Ökonominnen und Ökonomen, dass der weltweite Überhang an Ersparnissen eine wichtige Ursache für das Niedrigzinsumfeld ist. Diese Ersparnisschwemme («savings glut») wird dabei meist mit demografischen Trends erklärt. Die Argumentation lautet, dass die Alterung der Bevölkerung in den Industrieländern – im Fokus stehen die Babyboomer – dazu führt, dass mehr gespart wird. Entsprechend gebe es mehr investierbares Kapital, das Anlagen suche und auf die Zinsen drücke.
Auch Atif Mian (Princeton), Ludwig Straub (Harvard) und Amir Sufi (Chicago) stellen nicht in Abrede, dass hinter den niedrigen Zinsen wohl ein erhöhtes Angebot an Spargeldern steckt. Die drei Ökonomen erklären die wachsenden Sparvolumen aber nicht primär mit der demografischen Alterung. Als weit wichtiger erscheint ihnen der seit den 1980er Jahren vor allem in den USA tiefer werdende Graben zwischen Arm und Reich.
Fasst man ihr Argument zusammen, lautet es: Reiche Leute sparen einen deutlich höheren Anteil ihres Einkommens, als dies für Leute mit mittlerem oder niedrigem Einkommen möglich ist. Und wenn Reiche für einen immer höheren Anteil am Nationaleinkommen verantwortlich sind, dann führt dies zu überproportional höheren Ersparnissen. Diese Spargelder wiederum suchen nach Erträgen, was die Zinsen sinken und die Vermögenspreise steigen lässt.
*** Babyboomer taugen nicht zur Erklärung ***
Das tönt zunächst wenig überraschend. So muss man kein Ökonom sein, um zu wissen, dass wohlsituierte Menschen einen grösseren Teil ihres Einkommens beiseitelegen können. Klar ist auch, dass weniger betuchte Personen oft ihre gesamten Einkünfte für den Kauf lebensnotwendiger Konsumgüter ausgeben müssen, sie können also nichts oder nur sehr wenig sparen. Der Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe und Sparquote ist somit unumstritten.
Kontroverser ist ein anderer Punkt. Die Autoren wollen zeigen, dass die Ungleichheit eine bessere Erklärung liefert für niedrige Zinsen, als dies der Verweis auf die steigende Zahl älterer Menschen tut. Das ist auch deshalb bedeutsam, weil die demografisch bedingte Zunahme an Spargeldern zurückgehen dürfte, wenn die Babyboomer alle in Rente sind und weniger sparen. Bei der Ungleichheit zeichnet sich hingegen keine Trendwende ab; dieser Faktor, so die Autoren, dürfte länger anhalten.
Untermauert wird das Argument am Beispiel der USA, und zwar für die Zeit zwischen 1950 und 2019. Dabei zeigt sich, dass die Unterschiede der Sparquoten innerhalb derselben Altersgruppen (etwa der Babyboomer) deutlich grösser sind als jene zwischen den Altersgruppen. Babyboomer sind keine uniforme Masse; einige sparen viel, andere weniger. Die Folge: Wenn die Ersparnisse steigen, dann nicht deshalb, weil die Babyboomer älter, wohlhabender und sparfreudiger werden, sondern die Reichen reicher.
Tatsächlich steigt seit den 1980er Jahren das relative Gewicht jener Einkommen stark an, die zu den 10% der Haushalte mit den besten Gehältern fliessen. Ein Beispiel: Als jene Leute, die zwischen 1925 und 1934 auf die Welt gekommen waren, zwischen 45 und 54 Jahre alt waren, machten die Top-10%-Verdiener dieser Kohorte rund 33% der Einkommen dieser Altersgruppe aus. Als die zwischen 1965 und 1974 geborenen Personen in dieses Alter kamen, lag der Anteil bereits bei 47%.
*** Ein sich selbst verstärkender Prozess ***
Der Trend zeigt sich auch in den Ersparnissen. So schreiben die Autoren: «Insgesamt schätzen wir, dass die obersten 10% von 1995 bis 2019 zwischen 3 und 3,5 Prozentpunkte mehr vom Volkseinkommen gespart haben als im Zeitraum vor den 1980er Jahren. Dies entspricht 30 bis 40% der gesamten privaten Ersparnisse in der US-Wirtschaft von 1995 bis 2019.» Dieser Anstieg der Ersparnisse durch Haushalte mit hohem Einkommen habe wohl einen starken Druck auf die Zinsen ausgeübt.
Stimmt die Kausalität, hätte dies einige Sprengkraft. Konstatiert würde nämlich, dass sich die Ungleichheit wie von selbst verstärkt: So führen die hohen Ersparnisse der Topverdiener zu niedrigeren Zinsen. Und die niedrigen Zinsen befeuern die Preise von Vermögenswerten wie etwa Aktien oder Immobilien, wodurch die Reichen noch mehr sparen, was erneut die Zinsen unter Druck setzt – und so weiter.
Gar so mechanisch dürfte der Prozess aber kaum ablaufen. Zudem gelten die Ergebnisse nur für die USA, wo das Problem der Ungleichheit weit grösser ist als in den europäischen Wohlfahrtsstaaten mit ihren umfassenden Umverteilungen. Die prominente Bühne, die man der Arbeit von Mian, Straub und Sufi in Jackson Hole geboten hat, macht aber deutlich, dass Verteilungsfragen auch in Notenbankkreisen an Bedeutung gewinnen.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/wirtschaft/ungleichheit-sind-die-reichen-schuld-an-den-niedrigen-zinsen-ld.1643767
Studie: Vermögenssteuer bringt wenig und bremst die Konjunktur – Überblick am Morgen / DJN, 30.8.2021
Eine Vermögenssteuer zur Finanzierung der Coronavirus-Krise und zur Umverteilung zwischen Krisengewinnern und -verlierern ist laut einer neuen Studie kein kluges und gerechtes Instrument. Mit einer solchen Steuer zusätzlich zu den bestehenden würde Deutschland nicht nur einen Sonderweg gehen, sondern auch noch Unternehmen mit krisen- oder branchenbedingt geringeren Renditen über Gebühr belasten, so das Ergebnis der Studie, die der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, für die Stiftung Familienunternehmen verfasst hat.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53803508-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
BDI: Höhere Erbschaftsteuer würde Familienunternehmen die Luft nehmen – dpa.AFX, 1.9.2021
Eine höhere Erbschaftsteuer würde Familienunternehmen in Deutschland aus Sicht des Industrie-Branchenverbands BDI ungewollt an den Kapitalmarkt treiben. „Ich kenne mehrere Familienunternehmer, denen klar ist, dass weder die Firma noch die Eigentümer beim nächsten Generationswechsel die fällige Erbschaftsteuer bestreiten können“, sagte Verbandspräsident Siegfried Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. „Denen bleibt gar nichts anderes übrig, als Anteile an der Firma zu verkaufen, um daraus die Erbschaftsteuer zu zahlen.“ Das treffe besonders langfristig orientierte, standorttreue Familienunternehmen hart – genau solche Unternehmen, die die Politik sonst immer hervorhebe und lobe.
Mehrere Parteien versprechen in ihren Programmen für die Bundestagswahl am 26. September Reformen der Erbschaftsteuer. Mit dem bisherigen Steuermodell machen Erbschaften Studien zufolge die Vermögenden noch reicher, unter anderem, weil für Betriebsvermögen großzügige Sonderregelungen gelten. SPD, Grüne und Linke haben sich deshalb Reformen vorgenommen und wollen hohe Erbschaften stärker besteuern. Union und FDP dagegen lehnen eine schärfere Erbschaftsteuer ab, weil sie dadurch Unternehmen und Arbeitsplätze gefährdet sehen.
Diese Einschätzung teilt der BDI. Das Geld für Erbschaft- oder Vermögensteuern fehle den Unternehmen dann für Innovationen und Investitionen, warnte Russwurm. „Dann blutet Substanz aus.“ Er sehe „eine echte Gefahr“ für Unternehmen, die diese Steuer nicht zahlen und deshalb weniger investieren könnten.
Russwurm kritisierte auch die bestehenden Sonderregelungen für das Erben von Betrieben. Steuernachlässe würden Unternehmen nur gewährt, wenn sie sieben Jahre lang ihre unternehmerischen Entscheidungen daran ausrichten, wie viel Löhne und Gehälter sie zahlten. „Dann droht die Erbschaftsteuer notwendigem unternehmerischen Handeln im Weg zu stehen“, warnte Russwurm.
Wie viel in Deutschland jedes Jahr vererbt wurde, ist nicht bekannt: Die meisten Erbschaften und Schenkungen liegen nach Angaben des Statistischen Bundesamts unterhalb der hohen Freibeträge. So können Ehepartner bis zu 500 000 Euro, die eigenen Kinder bis zu 400 000 Euro erben, ohne dafür Steuern zu zahlen. Erben oberhalb der Freibeträge zahlten im vergangenen Jahr auf Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro insgesamt 8,5 Milliarden Euro Steuern – deutlich mehr als im Vorjahr.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53824934-bdi-hoehere-erbschaftsteuer-wuerde-familienunternehmen-die-luft-nehmen-016.htm
DIW-Studie: Superreiche jetzt noch reicher – dts, 31.8.2021
Die Vermögen des reichsten Prozents der Haushalte in Deutschland sind zwischen 2013 und 2018 um fast die Hälfte gewachsen – auf durchschnittlich elf Millionen Euro pro Haushalt. Das berichtet die „Zeit“ unter Berufung auf eine Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
„Wir sehen beim Vermögen am oberen Rand der Gesellschaft extreme Zuwächse“, sagte die DIW-Forscherin Charlotte Bartels. Durch die Berechnungen des DIW lässt sich der Vermögenszuwachs des reichsten ein Prozents der Haushalte in absoluten Zahlen ablesen. Demnach haben sich die Vermögen dieser Haushalte in den vergangenen vier Jahrzehnten fast verdreifacht. Währenddessen konnte die ärmere Hälfte der Bevölkerung quasi kein Vermögen aufbauen.
Ein wesentlicher Grund für die großen Vermögenszuwächse am oberen Rand seien vor allem gestiegene Immobilienpreise und Unternehmensbewertungen, heißt es in der Studie.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820228-diw-studie-superreiche-jetzt-noch-reicher-003.htm
HINWEIS: vergleiche dazu meinen COMMENT: Bemerkenswert bei den Diskussionen zu Vermögensentwicklungen ist die Ausblendung des Geldwertschwundes zum gleichen Thema im Montagsblick KW 34/35
Würde eine Reichensteuer wirklich die Ungleichheit abbauen? – Der Hintergrund- Die politische Debatte rund um die Vermögensteuer – Und was sagen die Ökonomen? – Weiterführende Informationen zum Thema – Forum for a New Economy, 20.8.2021
Im Kampf gegen wachsende Ungleichheit will die SPD die Vermögenssteuer wieder einführen – und zwar mit einem einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für die Reichsten. Wie wirksam dieses Instrument ist, haben wir mit NoWaBo und Markus Grabka in unserer Short Cut-Serie zur Bundestagswahl diskutiert.
Die Corona Pandemie hat die Diskussionen rund um die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland zuletzt wieder angefacht. Dass die Ungleichheit in Deutschland nicht erst seit der Pandemie wächst, belegt eine vom Forum in Auftrag gegebene Studie von drei deutschen Ökonominnen und Ökonomen um den Bonner Professor Moritz Schularick, die als erste auf Basis von Steuerdaten, Umfragen und Reichenlisten die langfristige Entwicklung der Vermögensungleichheit in Deutschland umfangreich erfasst haben.
Die SPD schlägt vor, die Vermögensteuer zurückzubringen – mit einem einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für hohe Vermögen. Doch wie sinnvoll ist die Vermögenssteuer aus ökonomischer Sicht? Wie würde sich das auf den Gini-Index auswirken? Und ist eine Vermögensteuer ein wirksames Einzelinstrument, oder bedarf es ergänzender Maßnahmen, um eine gewisse Wirkung auf die Ungleichheit zu erzielen? Darüber haben wir am 24. August mit Norbert Walter-Borjans, Parteivorsitzender der SPD, und Markus M. Grabka vom DIW gesprochen. Der Beitrag ist Teil unserer New Economy Short Cut Reihe zur Bundestagswahl, bei der wir prominente Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl in den Bundestag einladen, die Versprechen ihrer Partei im Hinblick auf die großen ökonomischen Fragen unserer Zeit mit uns zu diskutieren. Weitere Diskutanten sind Christian Dürr (FDP), Anja Hajduk (Bündnis 90/ Die Grünen) und Caren Lay (DIE LINKE). Das Programm im Überblick
*** Die wichtigsten Takeaways ***
Konsens herrschte zwischen Norbert Walter-Borjans (SPD) und Markus M. Grabka (DIW) bei der generellen „Bestandsaufnahme“ des Problems. Beide betonten, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch sei, was sich negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirke und auch potenziell negative Implikationen für das Wirtschaftswachstum habe. Um die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, sei es laut Markus Grabka nötig, die unteren und mittleren Einkommensgruppen zu entlasten. Die steuerliche Entlastung der reichsten 10% in Deutschland habe zu wachsender Ungleichheit geführt, was auch eine aktuelle DIW-Studie zeige.
Die Frage danach, wie eine Vermögenssteuer ausgestaltet sein müsste, um der steigenden Vermögensungleichheit in Deutschland etwas entgegenzusetzen, stellte sich hingegen als komplexes Themenfeld dar, was zu einer sehr spannenden Diskussion führte.
Zu Anfang des Gesprächs ordnete NoWaBo die Vermögenssteuer in die breitere fiskalpolitische Debatte und in die Agenda seiner Partei ein. Durch die Steuerpläne der SPD sollten über 80% der Bevölkerung entlastet werden. Bei der SPD-Forderung nach einer Vermögenssteuer ginge es nicht darum, die „Reichen ärmer“ zu machen, sondern lediglich, dass der Zuwachs an Reichtum besteuert werde. Dadurch sollten die Reichen mehr beteiligt werden, was angesichts des enormen Investitionsbedarfs in Deutschland unabdingbar sei. Der „trickle-down“-Ansatz, durch Steuersenkungen für Vermögende die Nachfrage zu steigern, sei in der Vergangenheit gescheitert. Im Gegenteil, laut NoWaBo könne die Vermögenssteuer sogar einen Anreiz für mehr Konsum darstellen und sich dadurch positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken.
Markus M. Grabka (DIW) wandte in diesem Punkt ein, dass eine Vermögenssteuer möglicherweise Arbeitsplätze gefährden könne, vor allem, wenn dadurch die Steuerlast für den aktuell stark von der Pandemie betroffenen Privatsektor steige. Grundsätzliche gelte es aus ökonomischer Sicht „den Vermögenskuchen nicht nur zu teilen, sondern zu vergrößern“. Nicht zuletzt haben Studien (z.B. Schularick et al. 2020) gezeigt, dass eine Vermögenssteuer indirekt sogar zu mehr Ungleichheit führen könnte. Nach seiner Ansicht ist die Vermögenssteuer „nur ein Instrument in einem größeren Instrumentenkasten“. Entscheidend für die Abmilderung der Ungleichheit sei die Erbschafts- und Schenkungssteuer. In diesem Zusammenhang seien die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer eine wichtige Stellschraube, bei der die Politik ansetzen könnte.
Auf die zentrale Frage hin, ob die Vermögenssteuer in der Art, wie sie von der SPD vorgeschlagen wird, ausreichen könne, um die Vermögensverteilung tatsächlich zu beeinflussen, verwies Herr Grabka auf eine vom Forum New Economy beauftragte Studie. Ersten Berechnungen im Rahmen dieser Studie zufolge müsste eine Vermögenssteuer bei etwa 5% – 7% ansetzen, damit nicht nur der Zusatzertrag, sondern auch die Substanz besteuert würde. Hierbei betonte NoWaBo, dass bereits bei einem Steuersatz von 1% mit rund 10 Mrd. an Steuereinnahmen zu rechnen sei. Daher sei die von seiner Partei entworfene Steuer keine reine Symbolpolitik.
*** Was war sonst noch wichtig? ***
NoWaBo brachte in das Gespräch ein, dass die Unterbindung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung eine tragende Rolle spiele. An den gesellschaftlichen Kosten sollten sich auch diejenigen beteiligen, die „sich bisher davor gedrückt“ hätten. Daher gelte es, Steuerschlupflöcher zu schließen und den G20-Beschluss zur Mindestbesteuerung von Unternehmen konsequent umzusetzen.
Sowohl NoWaBo als auch Herr Grabka gingen auf Möglichkeiten ein, die Vermögensbildung und Altersvorsorge für Geringverdiener zu erleichtern. Die Riester-Rente müsse attraktiver gestaltet werden, möglicherweise könnten hier skandinavische Staaten wie etwa Schweden und das Modell eines Staatsfonds mit opt-out-Option als Vorbilder dienen.
*** Der Hintergrund- Die politische Debatte rund um die Vermögensteuer ***
Die Corona-Pandemie hat bestehende Ungleichheiten in Deutschland und anderswo in der Welt aufgedeckt und sogar noch verschärft. Die Titel großer internationaler Zeitungen, die darüber berichteten, wie die durch die Pandemie verursachten Marktturbulenzen den Superreichen zugute kamen und so die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößerten, waren für viele ein Aufruf zum politischen Handeln. Ein Aufruf, der von den Parteien im Vorfeld der Bundestagswahl sicherlich nicht ignoriert wurde, von einigen mehr als von anderen.
Im Wahlprogramm der SPD heißt es „Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten“. Neben der Umverteilungswirkung soll diese Maßnahme auch den einzelnen Bundesländern mehr finanziellen Spielraum für ihre zukünftigen Aufgaben verschaffen. Geplant ist deshalb die Einführung eines einheitlichen Steuersatzes von einem Prozent für sehr Vermögende. Um die Steuerlast auf besonders vermögende Bevölkerungsschichten zu konzentrieren, soll es zudem hohe Freibeträge geben. Laut Parteiprogramm wird diese Maßnahme keine Arbeitsplätze gefährden. Außerdem soll die Erbschaftssteuer so reformiert werden, dass sie vermögende Firmenerben nicht asymmetrisch begünstigt.
DIE LINKE hingegen fordert eine Vermögenssteuer von 5 % auf Vermögen (ohne Schulden) über einer Million Euro. Für Unternehmen und betriebsnotwendiges Vermögen sollen Freibeträge von mindestens 5 Millionen Euro vorgesehen werden. Außerdem soll ausländisches Eigentum an Betriebsvermögen genauso besteuert werden wie inländisches. Durch diese Maßnahme sollen rund 100 Milliarden Euro pro Jahr für Investitionen der Länder zur Verfügung stehen. Und zur Bewältigung der Corona-Krise will die Partei eine Vermögensabgabe für Nettovermögen über 2 Mio. Euro erheben (für Betriebsvermögen sind 5 Mio. Euro Freibetrag). Diese soll progressiv von 10 bis 30 Prozent steigen und kann über 20 Jahre in Raten gezahlt werden. Geschätzte Einnahmen: 310 Milliarden Euro über 20 Jahre. Bei den Grünen ist die Position etwas weniger eindeutig, sie stehen jedoch für eine Vermögenssteuer für Vermögen über zwei Millionen Euro pro Person in Höhe von 1 Prozent jährlich mit verfassungsrechtlich zulässigen Steuererleichterungen für Betriebsvermögen. Die CDU ihrerseits lehnt eine Vermögenssteuer komplett ab mit dem Argument, eine solche Maßnahme würde alle belasten, das Wohnen verteuern, Arbeitsplätze gefährden und damit Wachstum und Wohlstand bremsen. Dieselbe Position und Argumente finden sich auch im Wahlprogramm der FDP.
*** Und was sagen die Ökonomen? ***
Eine DIW-Studie aus dem Jahr 2020 hat das Thema Ungleichheit in Deutschland erneut ins Rampenlicht gerückt, als sie aufzeigte, dass die Vermögensverteilung in Deutschland noch ungleicher ist als bisher berichtet – das reichste eine Prozent der Bevölkerung besitzt etwa 35 Prozent des Vermögens, das reichste Zehntel hält rund zwei Drittel des Gesamtvermögens, während die ärmsten 50 Prozent nur über 1,4 Prozent des Vermögens verfügen. In absoluten Zahlen – so die Studie – sind die reichsten zehn Prozent diejenigen, deren Vermögen am stärksten zugenommen hat. Relativ gesehen konnten jedoch fast alle Vermögensdezile in ähnlicher Weise von den Vermögenszuwächsen der letzten zehn Jahre profitieren, mit Ausnahme der 15 Prozent, die überhaupt kein Vermögen besitzen.
Angesichts dieser Zahlen gehört die Einführung einer Vermögenssteuer zu den ersten Instrumenten, die einem in den Sinn kommen, wenn man die Vergrößerung der Vermögensschere stoppen will – doch so trivial ist ihre Wirksamkeit nicht.
Das meint Markus M. Grabka – einer der Autoren der Studie – zur Einführung einer Vermögenssteuer: “Die ist aber mit diversen Problemen und bürokratischem Aufwand verbunden. Auch haben Steuersätze von zum Beispiel einem Prozent Vermögensteuer faktisch keine nennenswerte Außenwirkung auf die Höhe der Vermögensungleichheit. Daher lohnt es sich, auf alternative Politikinstrumente zu schauen. Die Vermögensbildungspolitik in Deutschland ist dringend reformbedürftig und die Förderbeträge sollten deutlich angehoben werden.”
Andere Artikel, wie der von Fuest et al. (2018), lehnen die Idee der Einführung einer Vermögenssteuer vollständig ab, da diese negative Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum, Investitionen und Beschäftigung hätte, von einem breiten Teil der Bevölkerung getragen würde und schließlich zu einem Rückgang der gesamten Steuereinnahmen führen würde.
In einer neuen Studie für das Forum „Ungleichheit in Deutschland – Politikmaßnahmen zur Trendumkehr“ (erscheint demnächst) schlagen Bach et al. (2021) vor, dass stattdessen eine wirksame Förderung von Wohneigentum langfristig signifikante Effekte auf die Verringerung der Vermögensungleichheit in Deutschland haben könnte. Ähnliche Effekte, wenn auch geringere, könnten durch eine effektivere zusätzliche Altersvorsorge und eine wirksame Sparförderung für die Mittelschicht erzielt werden. Ein Staatsfonds, der in global diversifizierte Portfolios investiert, könnte zusätzliche Einnahmen generieren, die der Bevölkerung als Grundeinkommen oder Grundvermögen zugute kommen. Darüber hinaus kann Vermögen durch eine Erhöhung der Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer/Abgabe auf hohe Vermögen oder effektivere Steuern auf Immobilienvermögen umverteilt werden. Die Einnahmen daraus könnten zur Förderung der Vermögensbildung des Mittelstandes oder zur Finanzierung eines Grunderbes verwendet werden. Eine strukturelle Steuerreform mit einer reformierten Erbschaftssteuer mit weniger Vergünstigungen und Freibeträgen, einer Vermögenssteuer/Abgabe für Superreiche, einer Erhöhung der Grundsteuer und einer Einkommenssteuer auf Kapitalerträge aus Immobilien könnte längerfristig Mehreinnahmen in der Größenordnung von bis zu 38 Milliarden Euro pro Jahr oder 1,0 Prozent des BIP generieren und hätte wahrscheinlich einen leicht dämpfenden Effekt auf die Vermögensungleichheit. Die höheren Erbschafts- und Vermögenssteuern für Vermögende und Superreiche verringern per se die Vermögensungleichheit. Allerdings ist der Effekt im Verhältnis zur Breite der Verteilung nicht sehr groß, da nur hohe Vermögen betroffen sind. Im Falle der Erbschaftssteuer wirkt sie zudem erst langfristig, wenn das Vermögen nach einer Generation übertragen wurde.
*** Vereinfachte Simulation in der Studie ***
Eine vereinfachte Simulation in der Studie zeigt zudem, dass über einen Zeitraum von 30 Jahren – also etwa dem Generationenabstand – eine aktuelle Vermögensteuer mit einem jährlichen Steuersatz von 1 Prozent die gleichen Auswirkungen hat wie eine alle 30 Jahre erhobene Erbschaftsteuer oder eine einmalige Vermögensteuer von 30 Prozent, die in gleichen Raten über 30 Jahre gezahlt wird. Darüber hinaus zeigt die Simulationsrechnung die langfristige Wirkung einer breit angelegten Vermögensförderung auf Basis eines Grunderbes für die jüngere Generation. Je nach Szenario der Bemessungsgrundlage reicht das Gesamtsteueraufkommen von 384 Mrd. Euro (bei einem persönlichen Freibetrag von 2 Mio. Euro und einem Freibetrag für Unternehmensvermögen von 5 Mio. Euro) bis 615 Mrd. Euro (bei einem persönlichen Freibetrag von 1 Mio. Euro und keinem Freibetrag für Unternehmensvermögen). Der Gini-Koeffizient der Vermögensverteilung wird durch die Vermögenssteuer jedoch nur um 1,0 bis 1,6 Prozent gesenkt. Das liegt daran, dass selbst eine so hohe Abgabe nur bis zu 5 Prozent des gesamten Privatvermögens von mehr als 12 Billionen Euro ausmacht. Zudem ist der Gini-Koeffizient auf die Mitte der Verteilung bezogen und reagiert nicht stark auf Veränderungen am oberen Rand, wo die Vermögenssteuer erhoben wird. Insgesamt kann eine stärkere Verringerung der Vermögensungleichheit in der Breite nur durch eine Stärkung des Erwerbseinkommen und der Vermögensbildung bei Geringverdienern und in der Mittelschicht gelingen.
QUELLE (inkl. weiterführenden Intratext-Links u.a. zu diversen Studien): https://newforum.org/the-state/einfuehrung-einer-vermoegenssteuer-gegen-zunehmende-ungleichheit/
SIEHE DAZU:
=> Eine neue Studie von Thilo Albers, Charlotte Bartels und Moritz Schularick zeigt zum ersten Mal die langfristige Entwicklung der Vermögensungleichheit in Deutschland, „Die Verteilung der Vermögen in Deutschland von 1895 bis 2018“
=> Eine noch unveröffentlichte Studie zu den Hauptreibern der Ungleichheit in Deutschland, vorab besprochen bei unserem achten New Paradigm Workshop
https://newforum.org/en/inequality/die-verteilung-der-vermoegen-in-deutschland-von-1895-bis-2018/
=> Eine Forum Studie zur Einkommens-, Konsum- und Vermögensungleichheit in Deutschland von Bartels & Schröder
https://ideas.repec.org/p/agz/bpaper/2002.html
https://newforum.org/en/inequality/ungleichheit-in-deutschland-wie-eine-trendwende-moeglich-ist/
Bernd Liedl, Sonja Spritzer und Nadia Steiber: Österreich: Sozialstaat und Umverteilung gewinnen an Bedeutung – Arbeiterkammer. 3.8.2021
Welche Rolle spielt der Sozialstaat in der Corona-Krise? Hat sich die Einstellung der Menschen zum Sozialstaat im Verlauf der Pandemie geändert? Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Sozialstaat in der Wahrnehmung vieler Menschen an Bedeutung gewonnen hat. Ein Großteil der Bevölkerung befürwortet die staatliche Einkommensumverteilung und eine Krisenfinanzierung durch Maßnahmen mit umverteilender Wirkung – wie zum Beispiel höhere Steuern auf große Unternehmen und Spitzeneinkommen.
*** Zustimmung zum Sozialstaat wird im Verlauf der Corona-Krise stärker ***
Im Juni 2020 und Jänner 2021 wurde im Rahmen der AKCOVID-Studie erhoben, ob sich die Bedeutung des Sozialstaats für die österreichische Bevölkerung seit Beginn der COVID-19-Pandemie verändert hat. Zu beiden Befragungszeitpunkten waren beinahe zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass der Sozialstaat seit Beginn der Corona-Krise „wichtiger“ geworden sei. Der Anteil der Befragten, die befanden, der Sozialstaat sei mit Beginn der Krise „viel wichtiger“ geworden, stieg im Verlauf der COVID-19-Pandemie von rund einem Drittel im Juni 2020 auf 40 Prozent im Jänner 2021. Diese Einschätzung deckt sich mit der Meinung von ExpertInnen, die dem Sozialstaat mit Andauern der Krise eine zunehmende Bedeutung für die Armutsbekämpfung zuschreiben.

GRAPHIK: https://awblog.at/wp-content/uploads/2021/08/awblog-210831-sozialstaat-1024×704.png
*** Einkommensumverteilung in der Corona-Krise ***
Viele Menschen gehen davon aus, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich im Zuge der Corona-Krise größer werden. Dementsprechend sprechen sich auch viele für staatliche Maßnahmen aus, die das Ausmaß der Einkommensungleichheit reduzieren bzw. Armut bekämpfen. In Österreich wird die staatliche Einkommensumverteilung im internationalen Vergleich stark befürwortet. Das war bereits vor Beginn der Krise der Fall. Wie schlägt sich nun die Corona-Krise auf die öffentliche Meinung zur staatlichen Einkommensumverteilung nieder?
Ein Vergleich der AKCOVID-Daten mit Daten aus dem European Social Survey aus den Jahren 2018/19 zeigt, dass sich der Grad der Zustimmung zu staatlicher Umverteilung im Zuge der COVID-19-Pandemie weiter erhöht hat. Zwar stand sowohl vor als auch während der Corona-Krise die überwiegende Mehrheit staatlicher Einkommensumverteilung positiv gegenüber. Eine Veränderung zeigt sich jedoch in der Stärke der Zustimmung: Zwischen 2018/19 und Juni 2020 ist der Anteil der Personen, die staatliche Einkommensumverteilung „voll und ganz“ befürworten, von knapp 30 Prozent auf über 40 Prozent angewachsen.
Dieser Einstellungswandel vollzog sich dabei vor allem innerhalb der Bevölkerung mit niedrigeren Bildungsabschlüssen, was durch ihre stärkere direkte Betroffenheit von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise (z. B. Kurzarbeit) erklärt werden kann: Der Anteil der „voll und ganz“ Zustimmenden erhöhte sich bei Personen ohne Matura um 16 Prozentpunkte auf rund 44 Prozent (signifikanter Anstieg), während sich dieser Anteil bei jenen mit höheren Bildungsabschlüssen nicht signifikant erhöhte.
*** Finanzierung der Krise ***
Obgleich teils argumentiert wird, dass die Krisenschulden durch ein Post-COVID-Wachstum „finanziert“ werden können, stellt sich die Frage, wie die Bevölkerung zu alternativen Finanzierungsoptionen mit umverteilender Wirkung steht. Die AKCOVID-Studie zeigt, dass höhere Steuern auf hohe Einkommen, große Unternehmen und Vermögen von der Bevölkerung grundsätzlich positiv gesehen werden. Etwa die Hälfte der Befragten war im Jänner 2021 für die stärkere Besteuerung hoher Einkommen und für Vermögenssteuern, um die Krisenfolgen zu finanzieren; mehr als zwei Drittel favorisierten eine höhere Besteuerung großer Unternehmen als Finanzierungsoption. Demgegenüber befürworten weniger als 10 Prozent der Befragten eine Kürzung von Sozialleistungen.

GRAPHIK: https://awblog.at/wp-content/uploads/2021/08/awblog-210831-sozialstaat1-1024×704.png
*** Fazit: Sozialstaat soll für Umverteilung sorgen ***
Seit Beginn der Corona-Krise hat sich für viele Menschen in Österreich die Bedeutung des Sozialstaates erhöht. Ein großer Teil der Bevölkerung sieht es als Aufgabe des Staates, soziale Ungleichheit zu verringern bzw. die Schere zwischen Arm und Reich im Zuge der Krise nicht noch weiter aufgehen zu lassen. Wie in den Befragungsdaten erkennbar ist, würde nur ein kleiner Teil der österreichischen Bevölkerung bekannte Konzepte – wie eine Erhöhung der Lohnsteuer auf besonders hohe Einkommen oder eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer – als staatliche Maßnahmen zur Reduktion sozialer Ungleichheit ablehnen. Große Teile der Bevölkerung würden hinter derartigen Maßnahmen stehen, wenn damit soziale Ungleichheit verringert werden kann und Verteilungsgerechtigkeit forciert wird.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um zentrale Ergebnisse der Studie: Bernd Liedl und Nadia Steiber: Einstellungen zum Sozialstaat im Verlauf der COVID-19-Pandemie. Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 223, 2021.
QUELLE (mit Intratext-Links): https://awblog.at/sozialstaat-und-umverteilung/
SIEHE DAZU:
=> Einstellungen zum Sozialstaat im Verlauf der COVID-19-Pandemie
QUELLE (33-Seiten-PDF): http://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/pdf/AC16251384/AC16251384.pdf
INTERNATIONAL
SENTIX Konjunkturindex: Vierter Rückgang in Folge! – SENTIX, 6.9.2021
Die konjunkturelle Lagebeurteilung der Anleger hat sich für die Eurozone im September nicht weiter verbessert. Mit 30,8 Punkten bleibt diese aber nach wie vor auf hohem Niveau. Die Erwartungswerte sinken dagegen zum vierten Mal in Folge auf nur noch 9 Punkte.
In Deutschland messen wir eine vergleichbare Entwicklung. Der Zenit des konjunkturellen Aufholprozesses nach den Corona-Lockdowns ist damit durchschritten. Nun stellt sich die Frage, ob wir nur ein Durchatmen oder eine Wende einleiten.
Auch für die Weltwirtschaft stehen die Zeichen auf einen sog. „mid cycle slowdown“, also einer Wachstumsver-langsamung in der Mitte des Zyklus. Besonders betroffen ist die Region Asien ex Japan, wo sich der Gesamtindex bereits zum fünften Mal in Folge abschwäche. Die Lagewerte fallen auf den tiefsten Stand seit Februar 2021.
QUELLE (REGISTRIERPFLICHT): https://www.sentix.de/index.php/sentix-Economic-News/vierter-rueckgang-in-folge.html
TECH-LOBBYISMUS (Pressepsiegel / DJN, 1.9.2021)- Die zehn größten Technologiekonzerne haben laut einer neuen Studie zuletzt 32,75 Millionen Euro im Jahr für Lobbyarbeit ausgegeben und damit mehr als jede andere Branche. Insgesamt hat die Branche demnach 1.452 registrierte Lobbyisten beschäftigt und 97 Millionen Euro eingesetzt. Allein das Budget von Google beträgt der Studie der Organisationen Lobby Control und Corporate European Observatory zufolge 5,75 Millionen Euro, gefolgt von Facebook (5,5 Millionen Euro), Microsoft (5,25 Millionen) und Apple (3,5 Millionen). Die „Top 10“ werden abgerundet durch Huawei und Amazon, sowie IBM, Intel, Qualcomm und Vodafone. Zum Vergleich: Die zehn größten Chemieunternehmen geben im Jahr in Brüssel insgesamt 18 Millionen Euro für ihre Lobbytätigkeit aus. Die zehn größten Autokonzerne und die zehn größten Finanzkonzerne setzen jeweils 10 Millionen Euro ein. (FAZ)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53825487-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Studie: Globale Autoindustrie mit Rekordgewinnen im ersten Halbjahr – dpa-AFX, 31.8.2021
Die weltweite Autoindustrie hat einer Studie zufolge im ersten Halbjahr dieses Jahres operativ so viel Geld verdient wie nie zuvor in der Branchengeschichte. Die 16 größten Autokonzerne fuhren der Erhebung des Beratungsunternehmens EY zufolge zwischen Januar und Ende Juni Betriebsgewinne von zusammen 71,5 Milliarden Euro ein – ein Rekordwert. Im Vorjahr hatten die Konzerne im gleichen Zeitraum nach der am Dienstag vorgelegten Studie in Summe noch einen Verlust von 4,1 Milliarden Euro eingefahren. Damals waren allerdings angesichts des Beginns der Corona-Krise die weltweiten Lieferketten und die Nachfrage zusammengebrochen.
Auffällig: Die meisten Firmen vermeldeten satte Betriebsgewinne, obwohl der weltweite Pkw-Absatz und auch die Firmenumsätze im Schnitt nach wie vor unter dem Vor-Corona-Niveau lagen. So wurden im ersten Halbjahr demnach nur 33,5 Millionen Fahrzeuge verkauft, elf Prozent weniger als in der ersten Hälfte des Jahres 2019. Auch die Erlöse der 16 größten Autokonzerne lagen mit 809 Milliarden Euro noch rund 2 Prozent unter dem Vergleichswert von 2019.
EY-Branchenexperte Peter Fuß sagte, die Firmen hätten vor allem von den in der Corona-Krise eingeleiteten Sparmaßnahmen und vom Trend zu teuren und großen Modellen profitiert. Zudem sei durch den aktuellen weltweiten Chipmangel bei hoher Auto-Nachfrage ein günstiges Preisumfeld entstanden. „Der Chipmangel führt dazu, dass sich die Autokonzerne auf margenstarke Fahrzeuge konzentrieren und weniger darauf angewiesen sind, hohe Rabatte zur Ankurbelung des Geschäfts zu geben. Derzeit ist die Nachfrage größer als das Angebot – diese Situation weiß die Branche durchaus für sich zu nutzen.“
Blickt man auf die Margen, sind die deutschen Autohersteller BMW und Daimler laut der Studie führend. Die operative Umsatzrendite – also das, was vom Umsatz am Ende noch als Gewinn aus dem operativen Geschäft übrig bleibt, – lag bei BMW mit 14,5 Prozent höher als bei allen anderen großen Autokonzernen. Daimler (12,9 Prozent) folgt auf Rang zwei, der Volkswagen -Konzern (8,8 Prozent) auf Rang sechs. Die Umsatzrendite ist Maßstab dafür, wie profitabel eine Firma arbeitet. In den Zahlen sind nicht nur die reinen Pkw-Geschäfte, sondern auch alle anderen Aktivitäten der 16 Konzerne enthalten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813736-studie-globale-autoindustrie-mit-rekordgewinnen-im-ersten-halbjahr-016.htm
Zahl der Demenzkranken steigt laut WHO rasant – Je älter man wird, desto höher das Risiko auf Demenz – Länder nicht vorbereitet – Science-APA, 2.9.2021
Die Zahl der Demenzkranken wird nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rasant steigen. Bis 2030 dürften rund 40 Prozent mehr Personen weltweit mit Demenz leben als heute. Betroffen waren 2019 nach Schätzungen etwa 55 Millionen Menschen, wie die WHO in Genf berichtete. Die positive Botschaft: Viele Menschen könnten ihr Demenz-Risiko deutlich reduzieren, etwa durch einen gesünderen Lebensstil, gute Schulbildung und intakte Sozialkontakte.
„Schulbildung baut Hirnreserven auf“, sagte WHO-Expertin Katrin Seeher in Genf. Als Risikofaktoren für Demenz nannte sie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Depressionen und soziale Isolation. Rauchen und Alkohol trinken gehören nach WHO-Angaben ebenfalls dazu. Auch ein Schutz des Gehirns, etwa bei bestimmten Aktivitäten Helmen tragen, dämme das Risiko von Demenz ein, sagte Seeher.
*** Je älter man wird, desto höher das Risiko auf Demenz ***
Einer der Hauptgründe für die steigenden Zahlen ist die Tatsache, dass Menschen dank besserer Lebensbedingungen deutlich älter werden als frühere Generationen. Mit dem Alter steigt generell das Risiko nicht übertragbarer Krankheiten, darunter Demenz. „Demenz raubt Millionen Menschen das Gedächtnis, die Unabhängigkeit und die Würde, aber sie raubt uns anderen auch die Menschen, die wir kennen und lieben“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Demenz ist meist eine fortschreitende Krankheit, in deren Verlauf Betroffene kognitive Fähigkeiten verlieren, etwa beim Gedächtnis, der Orientierung und der Sprache, dem Verstehen, Lernen, Planen und Einschätzen. Auch die emotionalen und sozialen Fähigkeiten können langsam verloren gehen. Dies passiert öfter mit fortschreitendem Alter, aber Krankheiten oder Verletzungen können auch Veränderungen im Gehirn und damit Demenz auslösen, darunter Schlaganfälle, Unfälle oder die Alzheimer-Krankheit.
*** Länder nicht vorbereitet ***
Die meisten Länder seien auf die wachsende Zahl von Demenzkranken nicht genügend vorbereitet, so die WHO. „Die Welt lässt Menschen mit Demenz im Stich“, sagte Tedros. Es müsse mehr getan werden, um Betroffene bei einem Leben in Würde zu unterstützen und Betreuerinnen und Betreuer nicht allein zu lassen. „Menschen mit Demenz sowie ihre Familien und Betreuerinnen und Betreuer erleben Diskriminierung aufgrund des Alters, Stigma und soziale Ausgrenzung. Das darf in unseren Gesellschaften keinen Platz haben“, so die WHO.
Das Interesse an der Erforschung von Medikamenten gegen Demenz sei nach vielen enttäuschenden klinischen Studien gesunken, schreibt die WHO. Allerdings hätten die USA beispielsweise ihre jährlichen Investitionen in die Alzheimer-Forschung von 631 Millionen Dollar 2015 auf 2,8 Milliarden Dollar (rund 2,4 Mrd. Euro) 2020 ausgeweitet.
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/9606556219747144408
BÖRSE
SENTIX-Sentimente: Das Grundvertrauen verbessert sich – SENTIX, 5.9.2021
Während noch unklar ist, ob die typische Sommerschwäche bei Aktien sich noch kurzfristig bemerkbar machen wird, verbessert sich der Ausblick für das 4. Quartal weiter. Das Grundvertrauen der Anleger in Aktien steigt. Besonders spannend ist dies in den USA für die Nebenwerte-Aktien, denn dort sind die Anleger vergleichsweise defensiv positioniert. Weitere Ergebnisse: * Bonds: Das Grundvertrauen sackt weiter ab * EUR-USD: Das Grundvertrauen dreht.
QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-36-2021.html
Frank Heiniger: USA Top, Hongkong Flop – China hält Finanzmärkte in Atem – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 1.9.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/08/hongkong.png
Die schärfere Regulierung und die wachsende Einmischung Pekings in die Unternehmenswelt halten die Aktienmärkte in Atem. Von den Massnahmen besonders betroffen sind die chinesischen Gesellschaften, die im Ausland gelistet sind. So hat sich der Nasdaq Golden Dragon China Index, der bekannte US-kotierte Valoren wie Alibaba oder Baidu umfasst, gegenüber Februar zwischenzeitlich halbiert.
Übel ist es im bisherigen Jahresverlauf auch dem Hang Seng in Hongkong ergangen: Der Index, der vielen ausländischen Investoren als Eintrittstor zum chinesischen Aktienmarkt dient, hat seit Februar beinahe 20% an Wert eingebüsst.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2131/
China plant neue Börse in Peking – Überblick amAbend / DJN, 2.9.2021
China plant nach den Worten von Präsident Xi Jinping eine Börse in der Hauptstadt Peking. Der neue Handelsplatz werde vor allem die „innovative Entwicklung“ kleiner und mittlerer Unternehmen unterstützen, sagte der Staatschef in einer Rede bei einer Handelsmesse. Zu Details, etwa Start und Umfang der Pekinger Börse, äußerte er sich nicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53845965-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
US-Börsenaufsicht erwägt Verbot von Payment for Order Flow-Wertpapierhandel – dpa-AFX, 31.8.2021
Die US-Börsenaufsicht SEC denkt über das Verbot einer bestimmten Wertpapierhandelsart nach. SEC-Chef Gary Gensler sagte am Montag in einem Interview der US-Anlegerzeitung „Barron?s“, dass ein Verbot sogenannter Payment for Order Flow „auf dem Tisch liege.“ Bei dieser Art des Aktienhandels leiten Broker die Order ihrer Kunden an größere Handelshäuser weiter, von denen sie dann im Gegenzug Geld erhalten. Gensler sieht darin Interessenskonflikte, da Handelsfirmen so als erstes über Angebot und Nachfrage Bescheid wüssten, was zu unfairen Vorteilen führen könnte. Aktien von Brokern wie Robinhood gerieten daraufhin unter Druck. Robinhood-Papiere schlossen mit einem Minus von fast sieben Prozent. Der Billig-Broker, der mit seiner einfach zu bedienenden App einer jüngeren Generation von Anlegern den Weg zum US-Finanzmarkt geebnet hat, war erst Ende Juli an die Börse gegangen. Die App wirbt mit provisionsfreiem Handel. Geld macht Robinhood mit PFOF, die bei Regulierungsbehörden schon länger umstritten sind.
QUELLE:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53812874-us-boersenaufsicht-sec-erwaegt-verbot-von-pfof-wertpapierhandel-016.htm
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen im DAX – DJN, 3.9.2021
Diverse Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 20. September wirksam; siehe die Auflistung:
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53848746-ueberblick-anstehende-indexaenderungen-015.htm
ZENTRALBANKEN
– EUROPÄISCHE UNION / EZB
Nachfrage von Banken nach EZB-Liquidität auf Rekordtief – DJN, 31.8.2021
FRANKFURT (Dow Jones)–Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) ist beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft auf ein Rekordtief gefallen. Wie die EZB mitteilte, wurden 16 Millionen Euro nach 112 Millionen in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 96 Millionen Euro weniger EZB-Liquidität.
Die Gebote von 2 (Vorwoche: 6) Instituten wurden voll bedient. Auch die Zahl der Bieter markierte ein Rekordtief. Das neue Geschäft wird am 1. September valutiert und ist am 8. September fällig.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53818269-nachfrage-von-banken-nach-ezb-liquiditaet-auf-rekordtief-015.htm
Morgan Stanley: EZB bestätigt unverändert hohes monatliches PEPP-Volumen – Überblick am Mittag / DJN, 2.9.2021
Morgan Stanley erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) das Volumen der monatlichen Anleihekäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP unverändert (bei etwa 80 Milliarden Euro) lassen wird. „Einige geldpolitische Falken mögen angesichts der jüngsten starken Inflationsdaten und der günstigeren Finanzierungsbedingungen für eine Verlangsamung plädieren. Aber wir denken, dass die Tauben angesichts der Unsicherheit über die Abwärtsrisiken durch das Virus und die Lieferengpässe, eine noch nicht abgeschlossene Erholung und die schwachen mittelfristigen Inflationsaussichten ein unverändertes Tempo fordern werden“, heißt es im Ausblick der Bank auf die EZB-Ratssitzung.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53842260-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Hans Bentzien: EZB-Vizepräsident De Guindos deutet planmäßiges Ende von PEPP an – DJN, 1.9.2021
Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sieht wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung des Euroraums offenbar keine Notwendigkeit für eine Aufstockung des Pandemiekaufprogramms PEPP. De Guindos sagte im Interview mit El Confidencial: „Die jüngsten Daten waren sehr positiv, die europäische Wirtschaft wird das vor der Pandemie verzeichnete Einkommensniveau Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres erreichen können. Wir werden in den nächsten Tagen neue Projektionen haben und unsere Entscheidungen an ihnen ausrichten.“
De Guindos verwies darauf, dass die geldpolitischen Maßnahmen darauf gerichtet gewesen seien, den Einfluss der Pandemie für die Wirtschaft zu begrenzen, für günstige Finanzierungsbedingungen und ein Erreichen des Inflationsziels zu sorgen. „Man kann sehen, dass die Erholung der europäischen Wirtschaft im zweiten Quartal sehr stark war, und wir glauben, dass sie auch im dritten und vierten Quartal ziemlich stark sein wird“, sagte de Guindos.
Nach seiner Aussage entwickelt sich die Wirtschaft im laufenden Jahr bisher besser als erwartet, was sich in der nächsten Woche in den Projektionen zeigen werde. Dagegen seien die Auswirkungen der Delta-Variante des Coronavirus nicht so stark wie vor vier Monaten erwartet. „Unser Notfallkaufprogramm ist an die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gebunden.“
Zur Inflation sagte de Guindos: „Die Inflation wird 2021 weiter anziehen. Unser Basisszenario ist, dass sie 2022 wieder zurückgeht.“ Die EZB müsse sicher gehen, dass es nicht zu Zweitrundeneffekten komme, denn das würde bedeuten, dass aus einer vorübergehenden Entwicklung eine strukturelle werde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53827341-ezb-vizepraesident-de-guindos-deutet-planmaessiges-ende-von-pepp-an-015.htm
Hans Bentzien: Holzmann: EZB kann über Reduzierung von Pandemieprogrammen diskutieren – DJN, 31.8.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann eine Reduzierung seiner Krisenmaßnahmen prüfen. „Wir sind jetzt in der Lage, darüber nachzudenken, wie wir die Pandemie-Sonderprogramme reduzieren können – ich denke, diese Ansicht teilen wir“, sagte Holzmann laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Es bestehe jetzt die Chance, zu diskutieren, wie die EZB den „Pandemieteil abschließen“ und sich auf den „Inflationsteil“ konzentrieren könne.
Der EZB-Rat entscheidet am kommenden Donnerstag über den weiteren Gang der Geldpolitik. Dabei soll auch das Volumen der monatlichen Ankäufe im vierten Quartal festgelegt werden. Holzmann gehört zu den geldpolitischen „Falken“ in dem Gremium.
Das französische Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hatte am Montag gefordert, die EZB müsse bei der Festlegung des Monatsvolumens – vor der Sommerpause 89 Milliarden Euro – berücksichtigen, dass die Marktzinsen niedriger als bei der Entscheidung im Juni seien. Das kann als Plädoyer für etwas niedrigere Käufe interpretiert werden. Der Franzose gilt als „moderater Falke“.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53821423-holzmann-ezb-kann-ueber-reduzierung-von-pandemieprogrammen-diskutieren-015.htm
Hans Bentzien: Lagarde: Euroraum-BIP Ende 2021 auf Vor-Corona-Niveau – DJN, 1.9.2021
Die Wirtschaftsleistung des Euroraums wird nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) schneller als im Juni gedacht wieder ihr vor der Corona-Krise verzeichnetes Niveau erreichen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte in einem Interview mit dem Magazin Time: „Wenn wir uns das Niveau des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ansehen, die Größe unserer Volkswirtschaften, dann werden wir gegen Jahresende dort sein, wo wir vor der Pandemie waren.“
Die im Juni veröffentlichten BIP-Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der EZB hatten ein Erreichen des Vorkrisenniveaus im ersten Quartal 2022 impliziert. Neue Projektionen werden nach der EZB-Ratssitzung am Donnerstag nächster Woche veröffentlicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53832885-lagarde-euroraum-bip-ende-2021-auf-vor-corona-niveau-015.htm
EZB-Vize de Guindos: Wirtschaft entwickelt sich besser als erwartet – dpa-AFX, 1.9.2021
Die rasche Erholung der Wirtschaft im Euroraum vom Corona-Tief gibt Europas Währungshütern Spielraum für eine Normalisierung ihrer Geldpolitik. „Die Wirtschaft entwickelt sich 2021 besser als erwartet, und das wird sich in den Projektionen widerspiegeln, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden“, sagte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der spanischen Zeitung „El Confidencial“. Der Spanier erklärte: „Wenn sich die Inflation und die Wirtschaft erholen, wird es logischerweise zu einer schrittweisen Normalisierung der Geldpolitik und auch der Finanzpolitik kommen.“
Bei der nächsten regulären Sitzung des EZB-Rates nächste Woche Donnerstag (9.9.) wird die Notenbank auch auf Grundlage ihrer aktuellen Prognosen zur Entwicklung der Konjunktur und der Teuerungsrate im Euroraum ihre geldpolitischen Entscheidungen treffen.
Angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs mehrten sich zuletzt Forderungen, die milliardenschweren Anleihenkäufe allmählich zurückzufahren. Die Erholung der Wirtschaft erlaube, über geringere Anleihenkäufe nachzudenken, hatte der Chef der österreichischen Zentralbank, Robert Holzmann, am Dienstag gesagt. Der Chef der niederländischen Zentralbank, Klaas Knot, sprang Holzmann bei.
Die EZB hatte zu Beginn der Corona-Pandemie ein besonders flexibles Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen aufgelegt. Das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) hat inzwischen ein Volumen von 1,85 Billionen Euro und soll nach derzeitiger Planung der Notenbank bis mindestens Ende März 2022 fortgeführt werden. Die Anleihenkäufe der EZB helfen Staaten wie Unternehmen: Diese müssen für ihre Wertpapiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53827292-ezb-vize-de-guindos-wirtschaft-entwickelt-sich-besser-als-erwartet-016.htm
– DEUTSCHLAND / Deutsche Bundesbank
Hans Bentzien: EZB/Weidmann: Risiko zu hoher Inflation nicht ausblenden – DJN, 1.9.2021
Die sehr expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann aufgrund der schwachen Inflationsaussichten gerechtfertigt. Bei einer Bankenaufsichtskonferenz warnte Weidmann aber davor, die Inflationsrisiken vollkommen aus dem Blick zu verlieren.
„Zuletzt lag die Inflationsprognose für den Euroraum in den kommenden Jahren deutlich unter der Zielrate, daher ist eine expansive Geldpolitik weiterhin angemessen“, sagte Weidmann laut veröffentlichtem Redetext. Er fügte hinzu: „Doch wir sollten eben auch das Risiko einer zu hohen Inflation nicht ausblenden. Angesichts der bestehenden Unsicherheit sollten wir den sehr lockeren Kurs der Geldpolitik nicht für zu lange festschreiben.“
Der Präsident der Bundesbank wies darauf hin, dass die EZB in der nächsten Woche neue Inflationsprognosen veröffentlichen werde, denen er nicht vorgreifen wolle.
Weidmann plädierte zudem dafür, die Wertpapierkäufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP rechtzeitig zu verringern. „Wegen der andauernden Unsicherheit können wir den PEPP-Ausstieg aber nicht weit im Voraus festlegen“, sagte er. Damit die PEPP-Nettokäufe dann nicht ruckartig enden müssten, sollte die EZB sie schon vorher schrittweise zurückfahren, wenn es die Situation erlaube.
Der EZB-Rat wird in der nächsten Woche darüber entscheiden, ob die EZB ihre PEPP-Käufe im vierten Quartal mit einem erhöhten Tempo fortführen wird. Zuletzt hatte sie ihre Anleihebestände unter diesem Programm monatlich um 80 Milliarden Euro erhöht.
Weidmann warnte außerdem, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland aufgrund der Materialknappheit in der Industrie 2021 etwas schwächer als bisher erwartet ausfallen könnte. Das Wachstum könnte etwas geringer „als in unserer Prognose vom Juni erwartet“ liegen, sagte er.
Die Bundesbank hatte im Juni einen kalenderbereinigten Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,7 Prozent prognostiziert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53831405-ezb-weidmann-risiko-zu-hoher-inflation-nicht-ausblenden-015.htm
USA
Defizit in der US-Handelsbilanz etwas stärker als erwartet gesunken – DJN/dpa-AFX, 2.9.2021
Das Außenhandelsdefizit der USA ist im Juli etwas stärker als erwartet geschrumpft. Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juli stärker als erwartet gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 70,05 Milliarden Dollar nach revidiert 73,23 (vorläufig: 75,75) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 70,90 Milliarden Dollar gerechnet.
Die Exporte stiegen zum Vormonat um 1,3 Prozent auf 212,83 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 282,879 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 0,2 Prozent.
Das Handelsdefizit der USA ist chronisch. Die Importe sind anhaltend höher als die Exporte. Die Vereinigten Staaten sind ein typisches Nettoimportland. Sie finanzieren das Defizit durch Auslandskredite. Die Kapitalmärkte der USA sind attraktiv, auch weil die Vereinigten Staaten mit dem Dollar über die Weltleitwährung verfügen.
Die größten ausländischen Kreditgeber der USA sind China und Japan. Sie halten die größten Bestände an US-Staatsanleihen – abgesehen von der amerikanischen Notenbank Fed.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53843190-defizit-in-der-us-handelsbilanz-gesunken-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53843356-usa-handelsbilanzdefizit-geht-zurueck-016.htm
EIA: US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet – DJN, 1.9.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 27. August überraschend deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,169 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,8 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,98 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 4 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,29 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,5 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,241 Millionen gesunken waren. Die API-Daten hatten einen Anstieg von 2,7 Millionen Barrel angezeigt.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11,5 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 11,5 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53833281-us-rohoellagerbestaende-staerker-gesunken-als-erwartet-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Andreas Neinhaus : US-Inflationserwartungen fallen nicht – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 30.8.2021
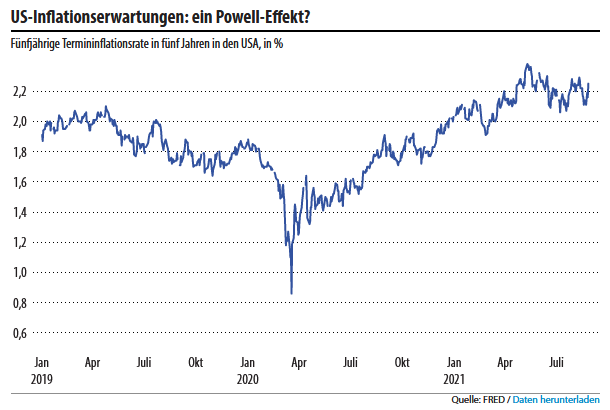
Mit Spannung wurde vergangene Woche die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Jackson-Hole-Symposium erwartet, in der er über den Plan des Fed für den Ausstieg aus den Anleihenkäufen informieren würde. Powell sprach, und er äusserte sich auch zum viel diskutierten Tapering. Aber seine Aussagen fielen weniger konkret aus, als sich viele «Fed Watchers» gewünscht hatten.
Er hat bestätigt, was bereits aus dem Protokoll der Julisitzung des Offenmarktausschusses bekannt war: Eine Drosselung der Käufe noch im laufenden Jahr ist wahrscheinlich, hängt aber von den kommenden Konjunkturnachrichten ab. Kein eindeutiger Termin, keine Hinweise auf das Tempo des Tapering.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2129/
Chicagoer Einkaufsmanagerindex im August kräftig und stärker als erwartet gesunken – DJN, 31.8.2021
Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im August nach einem Zwischenhoch im Juli deutlich abgeschwächt. Wie MNI Indicators mitteilte, fiel das Chicago Business Barometer auf 66,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten 69,4 erwartet nach einem Vormonatsstand von 73,4. Ein Wert oberhalb der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion, unterhalb von 50 weist er auf eine Abschwächung hin.
Der Indikator notiert damit wieder deutlicher unter seinen jüngsten Hochständen. Im Mai hatte der Indikator mit 75,2 Punkten den höchsten Stand seit Ende 1973 erreicht. Werte über der Marke von 50 Punkten signalisieren wirtschaftliches Wachstum, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin.
Der Subindex für die Produktion verringerte sich um 7,8 Punkte auf ein Zweimonatstief von 61. Jener für die Auftragseingänge sank um 4,4 Punkte auf 67,8, während der für den Auftragsbestand um 11,6 auf 81,6 Punkte stieg, Folge von Materialengpässen, Lieferproblemen und Arbeitskräftemangel.. Die Lagerbestände weiteten sich um 6,2 auf 48,8 Zähler aus. Beim Subindex für Arbeitskräftebedarf ergab sich ein Plus von 0,8 Punkt auf 48,3, der Indexstand für die gezahlten Preise ab Fabriktor zog um 2,3 Punkte auf 93,9 an.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820564-chicagoer-einkaufsmanagerindex-im-august-kraeftig-gesunken-015.htm
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820564-chicagoer-einkaufsmanagerindex-im-august-kraeftig-gesunken-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820352-usa-chicago-geschaeftsklima-truebt-sich-deutlich-ein-016.htm
Murat Sahin u.a.: ISM-Index für US-Industrie steigt überraschend im August – DJN/dpa-AFX, 1.9.2021
Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im August beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 59,9 (Vormonat: 59,5). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 58,6 prognostiziert.
Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.
Deutlich gesunken ist allerdings der Indikator für die bezahlten Preise, der sich allerdings immer noch auf einem hohen Niveau befindet. Während sich der Indexwert für neue Aufträge deutlich verbesserte, fiel der Beschäftigungsindikator erneut zurück.
Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 66,7 (Vormonat: 64,9), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 49,0 (Vormonat: 52,9). Der Index für die Produktion nahm zu auf 60,0 (Vormonat: 58,4), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 79,4 (Vormonat: 85,7) auswies.
Der Stimmungsindikator für die amerikanische Industrie, der als Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, liegt weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte über 50 Punkten deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Darunter signalisiert er eine Schrumpfung.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53832884-ism-index-fuer-us-industrie-steigt-im-august-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53832580-usa-industriestimmung-steigt-ueberraschend-016.htm
Markit: US-Industrie zeigt im August nachlassende Tendenz – DJN, 1.9.2021
Die Aktivität in der US-Industrie hat im August im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 61,1 von 63,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 61,2 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 61,2 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.
Zwar verzeichneten US-Wareproduzenten im August dank einer erneut lebhaften Nachfrage weiterhin deutliche Zuwächse bei der Produktion und den Auftragseingängen. „Allerdings sorgten Produktionseinschränkungen aufgrund von Materialknappheit für weiteren Druck auf die Kapazitäten, da die Arbeitsrückstände fast rekordverdächtig anstiegen“, sagte IHS-Senior-Ökonom Siân Jones. „Die Unternehmen hatten nicht nur Schwierigkeiten bei der Abwicklung zu erledigen, sondern waren auch mit einem weiteren Anstieg der Kosten konfrontiert.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53832712-markit-us-industrie-zeigt-im-august-nachlassende-tendenz-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en
Auftragseingang der US-Industrie im Juli gestiegen – DJN, 2.9.2021
Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juli um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 1,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte.
Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juli einen Rückgang von 0,1 Prozent nach vorläufig minus 0,1 Prozent. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 0,1 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,8 Prozent zu.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,1 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 1,0 Prozent registriert worden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53844404-auftragseingang-der-us-industrie-im-juli-gestiegen-015.htm
USA: Bauausgaben steigen im Juli stärker als erwartet – dpa-AFX, 1.9.2021
In den USA sind die Bauausgaben im Juli stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet. Im Juni waren die Bauausgaben um 0,1 Prozent gestiegen.
In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren die Ausgaben kurzzeitig deutlich zurückgegangen. Der Rückgang ist aber inzwischen aufgeholt. Die Bauwirtschaft erholte sich seit Mitte des vergangenen Jahres von der Corona-Krise. Zuletzt wurde die Branche jedoch durch Materialengpässe und Preissteigerungen für Baustoffe gebremst.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53832696-usa-bauausgaben-steigen-staerker-als-erwartet-016.htm
USA: Schwebende Hausverkäufe fallen überraschend – dpa-AFX, 30.8.2021
In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe überraschend weiter gefallen. Im Juli gingen die Verkäufe im Monatsvergleich um 1,8 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Montag in Washington mitteilte. Analysten wurden vom erneuten Rückschlag überrascht. Sie hatten einen leichten Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Im Juni hatte es einen ähnlich starken Dämpfer um revidiert 2,0 Prozent (zuvor 1,9 Prozent) gegeben.
Im Jahresvergleich fiel die Zahl der sogenannten schwebenden Hausverkäufe im Juli um 9,5 Prozent. Im Juni waren die Verkäufe in dieser Betrachtung um 3,5 Prozent im Jahresvergleich gesunken.
Die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe gelten als Frühindikator für den Häusermarkt in den USA, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53808261-usa-schwebende-hausverkaeufe-fallen-ueberraschend-016.htm
USA: Hauspreise steigen immer stärker – Case-Shiller-Index steigt im Juni um 19,1 Prozent auf Jahressicht – Extrem niedrige Zinsen und Wegzug aus den Metropolen in Vororte und Peripherie treiben – dpa-AFX, 31.8.2021
Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im Juni weiter beschleunigt. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise zum Vorjahresmonat um 19,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 18,6 Prozent gerechnet. Im Mai hatte das Plus 17,1 Prozent betragen.
Der Preisanstieg am US-Häusermarkt wird immer stärker. Die Corona-Krise hat dem Markt nicht geschadet, im Gegenteil: Die extrem niedrigen Zinsen, eine sicherheitsbedingte Nachfrage nach Immobilien und der steigende Bedarf an Wohnraum treiben die Preise. Immer mehr Menschen zieht es aus den Metropolen in die Vorstadt- und Peripheriegebiete, weil in der Corona-Krise viele zu Hause arbeiten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53819998-usa-hauspreise-steigen-immer-staerker-case-shiller-index-016.htm
USA: Häuserpreise steigen im Juni im Vergleich zum Vormonat schwächer als erwartet – FHFA – dpa-AFX, 31.8.2021
In den USA sind die Häuserpreise im Juni weniger als erwartet gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel einen Anstieg um 1,9 Prozent erwartet.
Allerdings war der Anstieg im Mai etwas stärker als bisher bekannt ausgefallen. Die Behörde revidierte den Zuwachs im Monatsvergleich auf 1,8 Prozent nach oben, von zuvor 1,7 Prozent.
Im Jahresvergleich verstärkte sich der ohnehin hohe Preisauftrieb weiter. Nach einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,2 Prozent im Mai stiegen die Hauspreise laut FHFA im Juni um 18,8 Prozent.
Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53819818-usa-haeuserpreise-steigen-schwaecher-als-erwartet-fhfa-016.htm
Stimmung der US-Verbraucher trübt sich stärker als erwartet ein – DJN/dpa-AFX, 31.8.2021
Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im August deutlich stärker als erwartet abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 113,8. Das ist der tiefste Stand seit Februar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 123,1 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 125,1 von zunächst 129,1 nach unten revidiert.
Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 147,3 (Vormonat: 157,2), jener für die Erwartungen verringerte sich auf 91,4 (103,8).
„Die Sorge wegen der Delta-Variante – und in geringerem Maße auch wegen der steigenden Gas- und Lebensmittelpreise – führte zu einer weniger günstigen Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und der kurzfristigen Wachstumsaussichten“, erklärte die Herausgeberin der Umfrage, Lynn Franco. Pläne zum Kauf von Häusern, Autos und Großgeräten seien teilweise zurückgestellt worden, der Prozentsatz der Verbraucher, die in den nächsten sechs Monaten in Urlaub fahren wollen, sei jedoch weiter gestiegen. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob dieser Rückgang des Vertrauens dazu führen werde, dass die Konsumenten ihre Ausgaben in den kommenden Monaten erheblich einschränken.
Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820950-stimmung-der-us-verbraucher-truebt-sich-staerker-als-erwartet-ein-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820527-usa-verbraucherstimmung-truebt-sich-ein-016.htm
ADP: US-Privatsektor schafft weitaus weniger Stellen als erwartet – DJN, 1.9.2021
In den USA hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft im August deutlich verlangsamt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat nur 374.000 Stellen. Ökonomen hatten ein Plus von 600.000 Jobs vorausgesagt. Im Juli waren unter dem Strich 326.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 4.000 weniger als ursprünglich gemeldet.
„Die Delta-Variante scheint die Erholung des Arbeitsmarktes gebremst zu haben“, sagte Mark Zandi, Chefvolkswirt von Moody’s Analytics. „Das Beschäftigungswachstum ist nach wie vor stark, bleibt aber weit hinter dem Tempo der letzten Monate zurück. Das Beschäftigungswachstum bleibt untrennbar mit dem Verlauf der Pandemie verbunden.“
Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 460.000 US-Unternehmen mit etwa 26 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.
Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im August auf der Basis des offiziellen Jobreports 720.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Bei der Arbeitslosenquote sehen sie einen Rückgang von 5,4 auf 5,2 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53831514-adp-us-privatsektor-schafft-weitaus-weniger-stellen-als-erwartet-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.adpemploymentreport.com/
US-Produktivität steigt im zweiten Quartal um 2,1 Prozent – DJN/dpa-AFX, 2.9.2021
Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal nicht so stark gestiegen wie erwartet. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 2,4 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 2,3 Prozent ausgewiesen worden war.
Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, erhöhten sich die Lohnstückkosten revidiert mit einer hochgerechneten Jahresrate von 1,3 Prozent. Vorläufig war eine Zunahme von 1,0 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Revision auf ein Plus von 0,9 Prozent erwartet.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53843269-us-produktivitaet-steigt-im-zweiten-quartal-um-2-1-prozent-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53843357-usa-produktivitaet-steigt-schwaecher-als-erwartet-016.htm
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe kräftig gesunken – DJN/dpa-AFX, 2.9.2021
Die Erholung am US-Arbeitsmarkt geht weiter in kleinen Schritten voran. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 28. August kräftig abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 14.000 auf 340.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit der Woche zum 14. März 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 345.000 vorhergesagt.
Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 354.000 von ursprünglich 353.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 11.750 auf 355.000.
In der Woche zum 21. August erhielten 2,748 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 16.000.
Seit Beginn des Jahres hat sich hat sich die Lage am Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt tendenziell gebessert. Nachdem es im Frühjahr eine kräftige Erholung gegeben hatte, verbesserte sich die Situation in den Sommermonaten allerdings nur noch leicht und es kam auch mehrfach zu Rückschlägen. Der schwere Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 ist nahezu vollständig überwunden.
Die wöchentlichen Hilfsanträge bewegen sich aber immer noch auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Damals wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Allerdings befand sich der Jobmarkt vor der Krise in einem ungewöhnlich guten Zustand nahe der Vollbeschäftigung.
QUELLE:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53843268-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-kraeftig-gesunken-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53843156-usa-erstantraege-auf-arbeitslosenhilfe-sinken-leicht-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
Bostic: Anstieg der Zwangsräumungen könnte Aufschwung belasten – Überblick am Morgen / DJN, 2.9.2021
Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, sagte, dass die Beendigung des Schutzes vor Zwangsräumungen und die zu langsame Einführung von Hilfen für Mieter, die ihren Vermietern Geld schulden, Probleme für die wirtschaftliche Erholung schaffen könnten. „Das Räumungsmoratorium war bisher sehr hilfreich, um zu verhindern, dass Menschen mitten in einer Pandemie aus ihren Häusern vertrieben werden“, sagte Bostic in einem virtuellen Auftritt und bezog sich dabei auf ein kürzlich beendetes Räumungsverbot, das finanziell in Not geratene Mieter schützte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53838841-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Kreise: US-Justizministerium bereitet weitere Wettbewerbsklage gegen Google vor – dpa-AFX, 1.9.2021
Die Alphabet -Tochter Google muss sich in den USA laut einem Insider womöglich auf ein zweites Kartellverfahren einstellen. Das US-Justizministerium beschleunigt seine Untersuchungen des Geschäfts mit digitaler Werbung und könnte noch im laufenden Jahr Klage einreichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person schrieb. Noch sei aber keine Entscheidung gefallen. Google wird immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, seine dominierende Marktstellung auszunutzen. Der Internet-Konzern betont indes, dass er angesichts des herrschenden Wettbewerbs keine dominierende Marktstellung inne habe.
Google ist schon länger mit rechtlichem Gegenwind konfrontiert. So reichte das US-Justizministerium bereits im Oktober 2020 Klage ein mit dem Vorwurf, Google schütze seine dominierende Position bei der Internet-Suche und der damit verbundenen Werbung auf illegale Weise.
Und auch Bundesstaaten gingen zuletzt verstärkt gegen den Suchmaschinen-Betreiber vor. 2020 hatten zahlreiche US-Bundesstaaten Klagen mit dem Vorwurf illegaler Monopolstellungen des Unternehmens im Suchmaschinen- und Onlinewerbegeschäft eingereicht. Eine weitere Klage mehrerer Dutzend Staaten vom Juli 2021 nimmt das App-Store-System auf einer der großen Smartphone-Plattformen ins Visier.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53835610-kreise-us-justizministerium-bereitet-weitere-wettbewerbsklage-gegen-google-vor-016.htm
BRASILIEN
Brasiliens BIP schrumpft im ersten Quartal leicht – Überblick am Abend / DJN, 1.9.2021
Die brasilianische Wirtschaft ist im zweiten Quartal leicht geschrumpft, da die Industrie von Lieferproblemen geplagt und die Landwirtschaft von einem Rückgang der Kaffeeernte betroffen war. Das Bruttoinlandsprodukt sank saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Im Jahresvergleich lag das BIP um 12,4 Prozent höher, teilte die Statistikbehörde mit.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53834512-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
CHINA
China: ‚Caixin‘-Stimmungsindikator für die Industrie enttäuscht ebenfalls – dpa-AFX, 1.9.2021
Aus China kommen erneut schwache Signale aus dem Industriesektor. Nachdem bereits der staatliche Einkaufsmanagerindex für die großen Konzerne gefallen ist, hat sich auch die Stimmung bei den kleineren und mittelgroßen Industriebetrieben weiter eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ erfasste Stimmungsindikator fiel im August stärker als erwartet und rutschte zudem unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten bei den befragten Betrieben hindeutet.
Der „Caixin“-Index sank den Angaben vom Mittwoch zufolge auf 49,2 (Juli: 50,3) Punkte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang auf 50,1 Zähler gerechnet. Am Dienstag hatte die Regierung ihre Einkaufsmanagerindizes für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen vorgelegt. Dabei hatte vor allem der Indikator für den Dienstleistungssektor enttäuscht.
Der Indexwert, der die Stimmung in größeren und staatlichen Unternehmen des Dienstleistungssektors abbildet, fiel im August auf 47,5 Punkte nach 53,3 Zählern im Monat zuvor. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Belastet hatte vor allem die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Das Magazin „Caixin“ legt seinen Index für die Dienstleistungsbranche am Freitag vor.
Bei den staatlichen Indikatoren ging auch die Stimmung in der Industrie zurück. Hier fiel der Dämpfer allerdings vergleichsweise moderat aus. Der Indexwert sank nur leicht auf 50,1 Punkte, nach 50,4 Zählern im Juli. Im August hatte Chinas Führung mit harten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus angekämpft. Nach Einschätzung des Commerzbank-Analysten Hao Zhou macht die Delta-Variante die Wachstumsprognose für China unsicherer.
Allerdings hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die Corona-Maßnahmen bereits Ende August wieder weitgehend aufgehoben. „Wenn es also nicht zu einem weiteren großen Virusausbruch kommt, dürfte die Wirtschaft im dritten Quartal nur einen vorübergehenden Rückschlag erlitten haben und sich im vierten Quartal wieder erholen“, sagte der Commerzbank-Experte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53825294-china-caixin-stimmungsindikator-fuer-die-industrie-enttaeuscht-ebenfalls-016.htm
Delta-Variante belastet überraschend Stimmung in Chinas Unternehmen – Hoffnung auf Wirtschaftserholung im vierten Quartal – dpa-AFX, 31.8.2021
Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus bremst die konjunkturelle Entwicklung in China. Vor allem im Bereich Dienstleistungen sorgte das Virus für einen herben Stimmungsdämpfer, wie aus dem am Dienstag veröffentlichen staatlichen Einkaufsmanagerindex hervorgeht. Der Indexwert, der die Stimmung in größeren und staatlichen Unternehmen des Dienstleistungssektors abbildet, fiel im August auf 47,5 Punkte, nach 53,3 Zählern im Monat zuvor.
Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten einen deutlich höheren Indexwert von 52,0 Punkten erwartet. Der Rückschlag im August ist der stärkste Dämpfer des staatlichen Indexwertes seit dem Ausbruch der Corona-Krise Anfang 2020. Außerdem ist der Indexwert für den Bereich Dienstleistungen erstmals seit Februar 2020 wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.
Auch der staatliche Indexwert für die Industrieunternehmen ging im August zurück. Hier fiel der Stimmungsdämpfer allerdings vergleichsweise moderat aus. Der Indexwert sank nur leicht auf 50,1 Punkte, nach 50,4 Zählern im Juli. Im August hatte Chinas Führung mit harten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus angekämpft. Nach Einschätzung des Analysten Hao Zhou von der Commerzbank macht die Delta-Variante die Wachstumsprognose für China unsicherer.
Allerdings hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die Corona-Maßnahmen bereits Ende August weitgehend aufgehoben. „Wenn es also nicht zu einem weiteren großen Virusausbruch kommt, dürfte die Wirtschaft im dritten Quartal nur einen vorübergehenden Rückschlag erlitten haben und sich im vierten Quartal wieder erholen“, sagte der Commerzbank-Experte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813883-delta-variante-belastet-stimmung-in-chinas-unternehmen-016.htm
Autoverkäufe in China gehen kräftig zurück – dpa-AFX, 1.9.2021
Der Rückgang der Autoverkäufe in China hat sich im August noch einmal beschleunigt. Auf dem für deutsche Autobauer immens wichtigen chinesischen Automarkt sei der Fahrzeugabsatz im Vergleich zum Vorjahr von damals 1,73 Millionen Fahrzeugen nach vorläufigen Berechnungen um 13 Prozent gesunken, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking mit. Damit war der Rückgang deutlich stärker als im Juli und Juni.
Schon im Mai hatte es nach Daten des Verbands nur noch ein kleines Plus bei den Verkäufen gegeben. China ist mit Abstand der wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW. Die VW -Töchter Porsche und Audi, aber auch Mercedes-Benz und BMW können sich vom Massenmarkt in dem Land oft abkoppeln, weil sie vorwiegend auf teurere Marktsegmente ausgerichtet sind.
Neben den PCA-Daten wird die Entwicklung am chinesischen Automarkt auch vom Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) beziffert. Dieser misst den Absatz der Autobauer an die Händler und umfasst zudem etwas mehr Fahrzeugtypen im Nutzfahrzeugbereich.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53831632-autoverkaeufe-in-china-gehen-kraeftig-zurueck-016.htm
ELEKTROMOBILITÄT (Pressespiegel / DJN, 1.9.2021) – Die Zeiten, in denen die Exporthoffnungen chinesischer Autohersteller wie Landwind und Brilliance krachend im Crashtest zerschellten, sind vorbei. Stattdessen sichern sich die neuen Elektroauto-Produzenten aus der Volksrepublik Bestnoten wie zuletzt das E-Modell Polestar 2. Die Limousine, hergestellt von den Joint-Venture-Partnern Volvo und Geely, schnitt im ADAC-Test sogar besser ab als der E-Volkswagen ID4. Diese neue Zuverlässigkeit ist Teil des Plans der chinesischen Staatsführung, das Land zu einem führenden Exporteur von Elektrofahrzeugen zu machen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der auf China spezialisierten Denkfabrik Merics, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. (Handelsblatt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53825487-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
JAPAN
Japans Industrieproduktion im Juli gesunken – Aber Aussichten positiv – Arbeitslosenrate sinkt leicht im Juli – Pandemiefolgen: Erholung der Wirtschaft wird noch Jahre dauern – dpa-AFX, 31.8.2021
Japans zuletzt deutlich gestiegene Industrieproduktion ist im Juli gesunken, dürfte in den nächsten Monaten aber weiter anziehen. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Meti) am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, sank der Ausstoß im Juli im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent. Viele Ökonomen hatten allerdings mit einem etwas höheren Rückgang gerechnet. Im Vormonat war die Industrieproduktion der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nach revidierten Daten um 6,5 Prozent gestiegen. Die Konzerne erwarten, dass es auch im August sowie September weiter aufwärts geht: Im August rechnen sie mit einem Anstieg um 3,4 Prozent und im Monat darauf um 1,0 Prozent, wie das Ministerium weiter mitteilte.
Die Arbeitslosenrate sank derweil im Juli leicht auf 2,8 Prozent nach 2,9 Prozent im Vormonat. Auf 100 Jobsuchende entfielen 115 freie Stellen, wie das Arbeitsministerium bekanntgab. Japans Wirtschaft war im zweiten Quartal dieses Kalenderjahres wieder leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach vorläufigen Daten auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent. Teile des Inselreiches, darunter Tokio, befinden sich weiterhin im Corona-Notstand. Experten erwarten, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich die Wirtschaft vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53812465-japans-industrieproduktion-im-juli-gesunken-aber-aussichten-positiv-016.htm
INDIEN
Indiens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal mit Rekordrate infolge des Basiseffekts – Überblick am Abend / DJN, 31.8.2021
Indiens Wirtschaft wächst mit einem Rekordtempo, arbeitet sich aber immer noch aus einer der tiefsten Rezessionen heraus, die eine große Volkswirtschaft während der Pandemie erlebt hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im zweiten Quartal um 20,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das zweistellige Wachstum spiegelt einen Vergleich mit dem Vorjahr wider, als die Wirtschaft um etwa 24 Prozent schrumpfte, was den stärksten Rückgang in der Geschichte des Landes darstellte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53822477-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
TÜRKEI
Türkische Wirtschaft im zweiten Quartal stark erholt – Überblick am Mittag / DJN, 1.9.2021
Die türkische Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal 2021 kräftig erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 21,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das türkische Statistikamt TurkStat berichtete. Die Daten für das Quartal zeigten, dass die Konsumausgaben der privaten Haushalte um 22,9 Prozent, die Konsumausgaben des Staates um 4,2 Prozent und die Bruttoanlageinvestitionen um 20,3 Prozent im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres gestiegen sind.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53830692-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
GROSSBRITANNIEN
Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger stark ein als erwartet – dpa-AFX, 1.9.2021
In Großbritannien hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen nicht so stark wie bisher gedacht eingetrübt. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im August gegenüber dem Vormonat nur geringfügig um 0,1 Punkte auf 60,3 Zähler, wie die Marktforscher am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilten. In einer ersten Erhebung hatte Markit einen Rückgang auf 60,1 Punkte gemeldet. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.
Die Stimmung in der britischen Wirtschaft bleibt damit vergleichsweise gut. Trotz des Dämpfers liegt der Indexwert deutlich über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet weiter auf Wachstum im britischen Industriesektor hin.
Zwar hätten die Industriebetriebe solide Produktionszuwächse erzielt und neue Aufträge verzeichnet, sagte Markit-Experte Rob Dobson. Allerdings hätten die Unternehmen aber auch „von erheblichen Verzögerungen“ bei den Produktions-, Liefer- und Vertriebsplänen berichtet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53828347-grossbritannien-unternehmensstimmung-truebt-sich-weniger-stark-ein-als-erwartet-016.htm
SCHWEIZ
Kof-Konjunkturbarometer sinkt markant – Wirtschaftsleistung noch immer überdurchschnittlich – Finanz & Wirtschaft, 30.8.2021
Im August ist das Barometer wie im Vormonat rückläufig und fällt um 17,4 Punkte. Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur bleiben jedoch positiv – Finanz & Wirtschaft, 30.8.2021
Das Kof-Konjunkturbarometer ist im August markant gesunken. Konkret ist es um 17,4 auf 113,5 Punkten gefallen, wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (Kof) am Montag mitteilte.
Bereits in den beiden Vormonaten war das das Barometer um 10,2 und 2,6 Punkte zurückgegangen, nachdem es noch im Mai seinen historischen Höchststand bei 143,7 Punkten gesehen hatte.
Das Barometer hat sich damit im Berichtsmonat auch deutlich schlechter entwickelt, als es Ökonomen im Vorfeld erwartet hatten. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Experten hatten einen Wert im Bereich von 120,0 bis 128,5 Punkte prognostiziert.
*** Noch immer überdurchschnittlich ***
Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur bleiben laut Kof aber trotz des satten Rückgangs freundlich. Der aktuelle Stand sei noch immer deutlich höher als der langfristige Mittelwert (100 Punkte). Somit dürfte sich laut der Kof die wirtschaftliche Erholung von den Folgen der Pandemie in den kommenden Monaten fortsetzen. Die mittlerweile immer klarer erkennbare vierte Welle der Pandemie nähre jedoch Zweifel an einer «in naher Zukunft wieder weitgehend unbehinderten Wirtschaftsaktivität».
Verantwortlich für den aktuellen Rückgang seien alle Indikatorgruppen mit Ausnahme derjenigen aus dem Baugewerbe, so die Kof weiter. So werde zum Beispiel in der Industrie die Auftragslage als weniger positiv eingeschätzt. Innerhalb der Industrie signalisierten alle im Barometer abgebildeten Branchen mit Ausnahme der Chemie- und der Holzindustrie einen Rückgang gegenüber dem Vormonat. Besonders ausgeprägt sei dieser bei der Metallindustrie, gefolgt von der Papier- und der Elektroindustrie.
Das Kof-Konjunkturbarometer ist ein Frühindikator für die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft, der sich aus einer Vielzahl von Einzelindikatoren zusammensetzt. Diese werden über statistisch ermittelte Gewichte zu einem Gesamtindikator zusammengefasst.
Mit dem Einkaufsmanager-Index (PMI) wird am kommenden Donnerstag ein weiterer vorlaufender Konjunktur-Indikator veröffentlicht.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/kof-konjunkturbarometer-sinkt-markant/
SCHWEIZER BANKEN (Pressespiegel / DJN, 1.9.2021) – Die Konsolidierungswelle im Lager der Schweizer Privatbanken beschleunigt sich laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG und der Hochschule St. Gallen. Vor zehn Jahren gab es derer noch 158 im Land – zum Ende dieses Jahres dürften es nur noch 93 sein. KPMG-Partner Christian Hintermann erwartet, dass sich die Zahl der Privatbanken in der Schweiz mittelfristig um ein weiteres Viertel reduzieren wird. Dabei werde es wie bisher vor allem die kleinen Häuser treffen, die weniger als 5 Milliarden Franken Vermögen verwalten. (FAZ)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53825487-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
Hans Bentzien u.a.: Euroraum-Inflation steigt im August auf 3,0 Prozent – Kerninflation steigt deutlich von 0,7 auf 1,6 Prozent – DJN/dpa-AFX, 31.8.2021
Der Inflationsdruck im Euroraum hat im August deutlicher als erwartet zugenommen und den höchsten Stand seit fast zehn Jahren erreicht. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 3,0 (Juli: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Zuletzt war die Inflation im November 2011 so hoch gewesen, noch höher (3,2 Prozent) war sie zuletzt im Oktober 2008. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von nur 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,7 Prozent prognostiziert.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Nahrungsmittel) erhöhten sich um 0,3 Prozent auf Monats- und 1,6 (0,7) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Volkswirte hatten Raten von 0,2 und 1,5 Prozent erwartet.
Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich mit einer Jahresrate von 2,0 (1,6) Prozent und unverarbeitete Lebensmittel um 2,9 (1,9) Prozent. Die Jahresteuerung bei Energie nahm auf 15,4 (14,3) Prozent zu und die bei Industriegütern ohne Energie auf 2,7 (0,7) Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,1 (0,9) Prozent.
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent Inflation an. Laut ihren im Juni veröffentlichten Stabsprojektionen rechnet sie für 2021 mit 1,9 Prozent Teuerung, für 2022 und 2023 aber nur noch mit 1,5 bzw. 1,4 Prozent. Neue Projektionen werden nach der EZB-Ratssitzung am Donnerstag nächster Woche veröffentlicht.
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Inflation von zwei Prozent an. Diese Rate wird gegenwärtig klar überschritten. Allerdings will die EZB nicht gegensteuern, weil sie den Inflationsanstieg als temporär erachtet. Sie verweist auf zahlreiche Sondereffekte, die überwiegend auf die Corona-Krise zurückgehen.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53816417-euroraum-inflation-steigt-im-august-auf-3-0-prozent-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53816069-inflation-steigt-auf-hoechsten-stand-seit-fast-zehn-jahren-016.htm
SIEHE DAZU
=> TABELLE/EU-Verbraucherpreise August nach Ländern (Vorabschätzung)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53816536-tabelle-eu-verbraucherpreise-august-nach-laendern-vorabschaetzung-015.htm
Hans Bentzien: European Labour Market Barometer erhält zweiten Dämpfer in Folge – DJN, 2.9.2021
Das European Labour Market Barometer, der Arbeitsmarkt-Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen, ist im August zum zweiten Mal in Folge gesunken. Nach Mitteilung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ging es gegenüber dem Vormonat um 0,3 Punkte auf 104,3 Punkte zurück. „Die europäischen Arbeitsmärkte befinden sich weiter auf Erholungskurs, die Risiken steigender Infektionszahlen im Herbst haben die Aussichten aber wieder etwas gedämpft“, sagt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“. In mehreren teilnehmenden Ländern habe sich der Ausblick verschlechtert: In Zypern, Bulgarien, Schweiz, Tschechien, Polen und Flandern sei der Arbeitsmarkt-Frühindikator deutlich gefallen.
Der Teilindikator für die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen verlor – ausgehend von einem besonders hohen Niveau – 0,7 Punkte und lag im August bei 104,7 Punkten. Der Teilindikator für die künftige Entwicklung der Beschäftigung stieg um 0,1 auf 104,0 Punkte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53839308-european-labour-market-barometer-erhaelt-zweiten-daempfer-in-folge-015.htm
Andreas Plecko: Wirtschaftsstimmung im Euroraum sinkt im August nach Rekordhoch – DJN, 30.8.2021
Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im August gesunken, nachdem der Indikator im Juli ein Rekordhoch markiert hatte. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 117,5 Punkte von 119,0 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Indexrückgang auf 118,0 Zähler erwartet.
Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator ging auf 116,5 Punkte von 118,0 zurück. In der EU wurde die Wirtschaftsstimmung durch einen Vertrauensrückgang im Dienstleistungssektor, in der Industrie und bei den Verbrauchern gedämpft, während das Vertrauen im Baugewerbe wieder zunahm und im Einzelhandel praktisch unverändert blieb.
In den größten EU-Volkswirtschaften ging die Stimmung in Frankreich (minus 4,5) und in den Niederlanden (minus 3,0) stark zurück, in geringerem Maße auch in Italien (minus 1,9), Polen (minus 1,7) und Spanien (minus 1,2). Die Stimmung in Deutschland (minus 0,3) erhielt nur einen geringen Dämpfer.
Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone fiel auf 13,7 Punkte von 14,5 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 12,7 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Rückgang auf minus 5,3 Punkte von minus 4,4 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53804894-wirtschaftsstimmung-im-euroraum-sinkt-im-august-nach-rekordhoch-015.htm
Markit: Dynamik der Eurozone-Industrie lässt im August nach – DJN, 1.9.2021
Das Wachstum der Eurozone-Industrie ist im August zwar stark geblieben, die Dynamik hat sich aber zum zweiten Mal hintereinander abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank von 65,9 auf 61,4 Punkte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Rückgang auf 61,5 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.
Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung hin. Die Niederlande belegten in der Rangliste erneut Platz eins, wenngleich sich die Wachstumsrate auf ein Fünfmonatstief abgeschwächt hat. Abgekühlt hat sich die Industriekonjunktur auch in Deutschland, Irland, Österreich und Frankreich.
Bemerkenswert an den aktuellen Umfragedaten ist der Wert Griechenlands, der auf den höchsten Stand seit Juli 2020 geklettert ist. Beschleunigt hat sich die Steigerungsrate auch in Italien und Spanien.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53827934-markit-dynamik-der-eurozone-industrie-laesst-im-august-nach-015.htm
Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Juli auf 7,6 Prozent – DJN, 1.9.2021
Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Juli weiter gesunken. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, ging die Arbeitslosenquote auf 7,6 Prozent zurück, nachdem sie im Juni bei revidiert 7,8 (vorläufig: 7,7) Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 7,6 Prozent prognostiziert. Im Mai hatte die Quote 8,0 Prozent und im April 8,2 Prozent betragen.
Relativ niedrig ist die Arbeitslosenquote in den Niederlanden mit 3,1 Prozent und in Deutschland mit 3,6 Prozent. Die höchsten Erwerbslosenquoten weisen Griechenland (14,6 Prozent) und Spanien (14,3 Prozent) auf.
In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 6,9 (Vormonat: 7,1) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im Juli in der Eurozone 12,3 Millionen Menschen und in der gesamten EU 14,6 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53828541-eurozone-arbeitslosenquote-sinkt-im-juli-auf-7-6-prozent-015.htm
ITALIEN
Italien: Jahresteuerung zieht im August kräftig auf 2,6 Prozent an – dpa-AFX, 31.8.2021
In Italien hat die allgemeine Teuerung im August deutlich angezogen. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mit. Im Juli hatte die Rate gerade mal 1,0 Prozent betragen. Analysten hatten mit einer Rate von 2,1 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich erhöhte sich der HVPI um 0,3 Prozent.
Istat begründete die erhöhte Teuerung zum einen mit deutlich steigenden Energiepreisen. Zum anderen wurde auf einen statistischen Effekt verwiesen, der mit dem im Vorjahr verzögerten Start des Sommerschlussverkaufs im Einzelhandel zusammenhängt. Grund der Verzögerung war die erste Corona-Welle.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53816675-italien-inflation-zieht-kraeftig-an-016.htm
Italiens Wirtschaft gewinnt im Frühjahr wie erwartet an Fahrt – dpa-AFX, 31.8.2021
Das Wachstum der italienischen Wirtschaft hat im Frühjahr wie von Analysten erwartet deutlich an Stärke gewonnen. Im zweiten Quartal sei die Wirtschaftsleistung um 2,7 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen, teilte die Statistikbehörde Istat am Dienstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mit. Die Behörde bestätigte damit wie erwartet eine erste Erhebung.
Im ersten Quartal war die Wirtschaft der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nur leicht um 0,2 Prozent gewachsen. Im Winterhalbjahr hatten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die italienische Wirtschaft belastet.
Mit der Lockerung der Maßnahmen kam die Konjunktur in den Monaten April bis Juni wieder stärker in Schwung. Der Bereich Dienstleistungen konnte von einem kräftigen Anstieg der Konsumausgaben privater Haushalte profitieren. Außerdem wurde das Wachstum laut Istat durch einen stärkeren Außenhandel gestützt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53815557-italiens-wirtschaft-gewinnt-wie-erwartet-an-fahrt-016.htm
SPANIEN
Spanien kündigt Erhöhung des Mindestlohns zum dritten Mal binnen zwei Jahren an – Überblick am Abend / DJN, 1.9.2021
Spanien erhöht zum dritten Mal binnen zwei Jahren den Mindestlohn. Das kündigte Regierungschef Pedro Sánchez an. Er bekräftigte das Ziel seiner sozialistisch geführten Regierung, den Mindestlohn bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 auf 60 Prozent des Durchschnittslohns anzuheben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53834512-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
FRANKREICH
Französische Inflation steigt im August mit 2,4 Prozent auf höchsten Stand seit fast drei Jahren – dpa-AFX, 31.8.2021
Die Inflation in Frankreich hat sich im August überraschend deutlich verstärkt und den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 2,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag nach einer ersten Schätzung in Paris mit. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2018. Im Vormonat hatte die Rate nur 1,5 Prozent betragen.
Analysten wurden von der Stärke des Preisanstieg überrascht. Sie hatten bei den Verbraucherpreisen nur mit einer Jahresrate von 2,1 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im August um 0,7 Prozent und damit ebenfalls stärker als erwartet.
Als Preistreiber wirkte unter anderem die Entwicklung bei frischen Nahrungsmitteln, deren Preise überdurchschnittlich stark zulegten. Auch bei industriell gefertigten Gütern legten die Preise im August wieder zu, nachdem sie im Juli im Jahresvergleich gefallen waren. Stärkster Preistreiber bleiben aber die Kosten für Energie, die sich erneut kräftig um mehr als 12 Prozent erhöhten
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53814845-franzoesische-inflation-steigt-auf-hoechsten-stand-seit-fast-drei-jahren-016.htm
Frankreichs BIP-Wachstum für 2021Q2 von 0,9 auf 1,1 Prozent gegenüber Vorquartal revidiert – Überblick am Mittag / DJN, 31.8.2021
Die französische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als zunächst berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach revidierten Daten um 1,1 (vorläufig: 0,9) Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Insee mitteilte. Im ersten Quartal hatte es eine BIP-Stagnation gegeben. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, dem letzten Quartal vor der Corona-Krise, lag das BIP noch um 3,2 Prozent tiefer.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53818513-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
DEUTSCHLAND
Kassenärzte-Chef rechnet mit Ende der Pandemie im Frühjahr – Überblick am Morgen / DJN, 2.9.2021
Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, rechnet mit einem baldigen Ende der Corona-Pandemie. „Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein wird mit Corona“, sagte Gassen der Rheinischen Post. Diese Einschätzung werde auch von renommierten Wissenschaftlern geteilt. Bis zum Frühjahr werde die Impfquote weiter ansteigen, und vor allem auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern zunehmen. „Einschränkungen werden dann wohl gänzlich unnötig werden“, sagte Gassen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53838841-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Peter Rohner: Die deutsche Inflation ist nur halb so dramatisch – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, Finanz & Wirtschaft, 3.9.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/09/8kxhh-zweijahresteuerung-deutschland-640×434.png
Was für ein Schocker! Fast 4% soll die Inflation in Deutschland im August betragen haben. So hat es das Statistische Bundesamt in Wiesbaden geschätzt. So hoch war die deutsche Inflation seit 1993 nicht mehr. Auch die Teuerung gemessen nach der EU-weit harmonisierten Methode liegt mit 3,1% auf einem Mehrjahreshoch.
Doch das Ergebnis ist verzerrt durch den pandemiebedingten Preisrückgang vor einem Jahr. Denn die Inflation ist gewöhnlich definiert als prozentuale Veränderung der Konsumentenpreise zum Vorjahresmonat. Dadurch ergibt sich wegen der niedrigen Basis nun ein besonders hoher Wert.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2133/
COMMENT: Inflation des Geldes bedeutet Geldwert-Entwertung, damit Kaufkraftverlust. Problem jeder Inflation ist, dass sich die Effekte eines Kaufkraftverlustes das Geld sozusagen merkt. Das will sagen: die Preissteigerungen bleiben als Makel zurückliegender Phasen höherer Inflation bestehen. Sie verschwänden erst, fasste eine Deflation gleichen Ausmaßes wie die zurückliegende Inflation Fuß. Deflation ist aber derzeit kein Thema – verständlicher Weise und aus vielen verschiedenen Gründen!
Und wie ist das mit dem Basiseffekt? Teils, teils: es kommt auf die Branche an, die man betrachtet. Preissteigerungen in Bereichen mit Lieferkettenproblemen dürften „echte“ Preissteigerungen in der jüngsten Vergangenheit gewesen und in der zumindest näheren Zukunft sein. Genaues werden wir dazu wissen, wenn aus Zukunft Vergangenheit geworden sein wird. So ist das nun mal mit prognostischen Spekulationen.
Treten erhöhte durchgesetzte Lohnforderungen hinzu, beginnt sich die Inflationsspirale zu drehen. 2021 haben sich die Tarifkonflikte jedenfalls verschärft. Setzt sich zudem die Loführergewerkschaft mit ihren harten Forderungen gegenüber der Deutschen Bahn durch, so ist m.E. der Startschuß für weitere harte Lohnverhandlungen anderer Gewerkschaften gegeben: wenn die es können, können wir es auch, wird es dann aus den Gewerkschaftsetagen tönen. In der Bevölkerung gärt es – Corona sei Dank – sowieso: viele finanzschwache Privathaushalte sind finanziell in die Klemme geraten. Die Privathaushalte der (gehobenen) Mittelklasse und der Reichen haben ein staatliches Sparpolster – aber nicht die finanzschwachen Haushalte: aggregierte Sparvolumina hin oder her. Kommt in Deutschland eine Linkskoalition, dann dann werden die Gewerkschaften nochmals gestärkt.
Schwaches Wirtschaftswachstum und zunehmende Geldentwertung sind das Rezept für eine Stagflation (=> KOMMENTAR AUS FREMDEN FEDERN), vor allem wenn die Inflationsspirale in den Gang gesetzt worden ist.
FAZIT: Jubelgesänge angesichts möglicherweise bald wieder sinkender Inflationsraten sind daher nicht angesagt. Treffen wird die Geldentwertung, somit der Kaufkraftverlust, insbesondere den kleinen Mann und die kleine Frau auf der Straße. Und doppelt werden sie in Mitleidenschaft gezogen werden, handelte es sich bei der Inflation bei genauerem Hinsehen um eine über die nähere Zukunft hinausgehende Stagflation: schwache Wirtschaft, wenig Arbeitsplätze.
Hans Bentzien: Deutsche HVPI-Inflation steigt im August auf 3,4 Prozent – DJN, 30.8.2021
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im August wie erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 3,4 (Juli: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 3,4 Prozent prognostiziert.
Die deutschen HVPI-Daten sind vor allem wegen ihres Einflusses auf die Euroraum-Teuerung von Interesse, über die Eurostat am Dienstag (11.00 Uhr) informiert. Volkswirte erwarten bisher einen Anstieg der Inflationsrate auf 2,7 (2,2) Prozent. Spaniens HVPI-Teuerung nahm auf 3,3 (2,9) Prozent zu. Erwartet worden war dagegen ein Rückgang auf 2,8 Prozent. Französische Preisdaten kommen am Dienstag (8.45 Uhr).
Der nationale Verbraucherpreisindex Deutschland stagnierte auf Monatssicht und erhöhte sich auf Jahressicht um 3,9 (3,8) Prozent. Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent und eine Jahresteuerung von 3,9 Prozent prognostiziert.
Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 5,6 (5,4) Prozent, darunter Energie um 12,6 (11,6) Prozent und Nahrungsmittel um 4,6 (4,3) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,5 (2,2) Prozent mehr als im Vorjahresmonat, Wohnungsmieten waren um 1,3 (1,3) Prozent teurer.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53807223-deutsche-hvpi-inflation-steigt-im-august-auf-3-4-prozent-015.htm
Bundesländer melden für August weiter steigende Preise – Anstiege der Jahresteuerung zwischen 3,6 und 4,2 Prozent – Tabellarische Übersicht – DJN, 30.8.2021
Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im August weiter gestiegen. Wie die Daten aus fünf Bundesländern zeigten, bewegten sich die monatlichen Raten zwischen 0,0 und 0,1 Prozent. Die Jahresteuerung stieg damit auf 3,6 bis 4,2 Prozent. Der Anstieg der Inflationsrate ist weiterhin durch Basiseffekte geprägt, die sich durch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer sowie die niedrigen Mineralölpreise in der zweiten Jahreshälfte 2020 ergeben.
Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise im August gegenüber dem Vormonat um 0,1 (Juli: 0,9) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 3,9 (3,8) Prozent klettern.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53806365-tabelle-bundeslaender-melden-fuer-august-weiter-steigende-preise-015.htm
IW: Bei weiter steigender Inflation Umverteilungskämpfe – DJN, 30.8.2021
Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 2021 nach Erkenntnissen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 2021 deutlich zugenommen. Laut dem neuen IW-Tarifbericht, über den die Tageszeitung Welt berichtet, lag die Konfliktintensität im ersten Halbjahr im Schnitt bei 8,4 Punkten pro Tarifkonflikt. Der Wert beruht auf Punkten, die für unterschiedliche Eskalationsstufen vergeben werden – etwa Streikdrohungen, Warnstreiks, juristischen Auseinandersetzungen und Urabstimmung. Er ist laut dem Bericht deutlich höher als im vergangenen Jahr, als pro Verhandlung im Schnitt nur 2,3 Punkte gemessen wurden.
„Nach dem Maßhalten 2020, in dessen Rahmen es den Gewerkschaften vor allem um Beschäftigungssicherung ging, ist im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wieder die Lohnentwicklung in den Mittelpunkt der Tarifverhandlungen gerückt“, heißt es in dem IW-Papier. Das zeige sich an den gestiegenen Lohnforderungen der Gewerkschaften: Die lagen demnach im ersten Halbjahr zwischen 4,0 und 5,3 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Besonders weit eskalierten die Auseinandersetzungen laut IW im immer noch laufenden Tarifstreit zwischen Bahn und GDL sowie der Metall- und Elektroindustrie.
In den nächsten Monaten könnten sich die Konflikte in vielen Branchen noch deutlich stärker zuspitzen. „Die Gewerkschaften halten sich derzeit noch zurück, weil die Wirtschaftslage durch Corona unsicher ist und noch nicht klar ist, wie hartnäckig sich die Inflation halten wird“, sagt IW-Forscher Hagen Lesch. Wenn neue Lockdowns aber ausblieben und die Verbraucherpreise über mehrere Monate anstiegen, werde ihr Auftreten deutlich offensiver werden.
„Wir werden schon bald einen Umverteilungskampf erleben, wenn die Inflation weiter anzieht“, prophezeit Lesch. Denn nicht nur die Gewerkschaften würden diese als Argument für sich nutzen – sondern auch die Unternehmen, die sie etwa beim Rohstoffhandel ebenfalls zu spüren bekommen. Nach neuen Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen die Verbraucherpreise im August um voraussichtlich 3,9 Prozent im Vergleich zum August 2020.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53812354-iw-bei-weiter-steigender-inflation-umverteilungskaempfe-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche-Bank-Chef Sewing kritisiert Negativzins und „Basel 4“ – DJN, 31.8.2021
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank AG, Christian Sewing, hat bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Kreditinstitute des Landes gefordert. „“Wir sollten keine Kapitalanforderungen einführen, die den europäischen Anforderungen nicht gerecht werden – Stichwort Basel 4“, sagte Sewing unter Bezugnahme auf die in Umsetzung befindliche Eigenkapitalrichtlinie Basel 3. Die Finanzwirtschaft spricht von Basel 4, um auf die aus ihrer Sicht ursprünglich nicht in Aussicht gestellte Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen hinzuweisen.
Sewing kritisierte außerdem die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). „Wir müssen so schnell wie möglich zu einem normalen Zinsumfeld kommen“, sagte Sewing. Er wies darauf hin, dass die US-Banken in den vergangenen Jahren fortlaufende Einlagenzinsen erhalten hätten, während die Euroraum-Banken Zinsen zu zahlen hätten. „Wir sprechen von einem Delta von mehr als 150 Milliarden Dollar Vorsteuergewinn“, sagte Sewing.
Dieses Geld könnten die Institute laut Sewing gut gebrauchen, um Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz zu finanzieren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820835-deutsche-bank-chef-sewing-kritisiert-negativzins-und-basel-4-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): DIW: BIP dürfte im dritten Quartal um gut 1 Prozent steigen – DJN, 31.8.2021
Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ist im August auf 111 Punkte gestiegen und zeigt nach Angaben des Instituts für das dritte Quartal wie schon im Vorquartal einen kräftigen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) an. „Die deutsche Wirtschaft dürfte um gut 1 Prozent zulegen“, erklärte das DIW in einer Mitteilung.
„Das kräftige Plus bei der Wirtschaftsleistung im vergangenen Quartal dürfte zu einem beträchtlichen Teil auf die Impf- und Testaktivitäten zurückgehen, während sich die Erholung in den von Corona besonders betroffenen Branchen in das dritte Quartal schleppt“, sagte Simon Junker, der DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland. So seien erst im Juni die Umsätze im Gastgewerbe von quälend niedrigem Niveau in die Höhe geschossen – und dürften Umfragen zufolge auch in den darauffolgenden Monaten weiter zugelegt haben.
Damit liefere die Erholung bei den Dienstleistern später als gedacht erst im laufenden Quartal kräftige Impulse. Hemmschuh bleibe indes die Industrie, der es mehr und mehr an wichtigen Vorleistungen mangele. „Solange die Knappheiten im weltweiten Warenverkehr anhalten, kann die Industrie die immer üppiger gefüllten Auftragsbücher kaum abarbeiten“, sagte Junker. Ein guter Teil der derzeitigen Ausfälle dürfte aber nachgeholt werden, sobald die Engpässe beseitigt seien.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53815885-diw-bip-duerfte-im-dritten-quartal-um-gut-1-prozent-steigen-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): HWWI erwartet verhaltene Erholung der deutschen Wirtschaft – DJN, 1.9.2021
Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet nach dem Einbruch der deutschen Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent für 2021 nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,5 Prozent und für 2022 mit einem von 3,5 Prozent. Das gab das Institut in Hamburg bekannt. „Damit wird das Vor-Corona-Niveau von Ende 2019 erst wieder im Laufe von 2022 erreicht“, erklärten die Ökonomen. Dank der Impffortschritte und der damit einhergehenden Lockerungen sei die Wirtschaft seit dem Frühjahr wieder auf Erholungskurs, doch werde dieser durch neuerlich steigende Infektionszahlen und Materialengpässe gebremst.
Die Inflationsrate für die Verbraucherpreise sei dieses Jahres infolge von Basis- und Sonderfaktoren zwar merklich gestiegen. Da diese Einflüsse im nächsten Jahr aber wieder wegfielen beziehungsweise sich merklich abschwächten, sei damit, solange dies nicht zu übermäßigen Lohnsteigerungen führe, „kein nachhaltiges Inflationsproblem verbunden“. Auch am Arbeitsmarkt zeichne sich eine Besserung ab.
„Auch wenn wieder ansteigende Infektionszahlen eine vierte Welle signalisieren, haben sich mit Fortschreiten des Impfprozesses die Aussichten auf eine Beherrschung der Pandemie verbessert“, hob das HWWI hervor. Zwar könnte es wieder einzelne Einschränkungen geben, ein erneuter pauschaler Lockdown scheine jedoch wenig wahrscheinlich. So sei insbesondere für die in den früheren Lockdowns am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche kaum mehr mit generellen Einschränkungen zu rechnen. „Damit scheinen die Rahmenbedingungen besser als etwa vor Jahresfrist.“ Auch sollten sich die Lieferengpässe in der Industrie und Bauwirtschaft nach und nach entspannen.
*** Erholung setzt sich im zweiten Halbjahr fort ***
Zudem dürften die privaten Haushalte ihre während der Lockdowns geübte Kaufzurückhaltung allmählich lockern und die Unternehmen unterlassene Investitionen nachholen. Die Auslandsnachfrage habe bereits angezogen und werde in diesem Jahr wieder einen Wachstumsbeitrag leisten. Alles in allem sei mit einer Fortsetzung der Erholung der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu rechnen. Die Inflationsrate dürfte sich bis zum Jahresende etwa auf dem aktuellen Niveau von etwas unterhalb von 4 Prozent halten. Für das Gesamtjahr 2021 veranschlagt das HWWI 2,8 Prozent und für 2022 2,0 Prozent Inflation.
Die Ökonomen erwarten 2021 insgesamt noch einen Rückgang der privaten Konsumausgaben um 0,5 Prozent, 2022 sollen sie dann aber um 4,9 Prozent zunehmen. Für die Ausrüstungsinvestitionen sehen sie in beiden Jahren Zuwächse um je 6,7 Prozent. Die Exporte sollen dieses Jahr um 9,0 Prozent und nächstes um 5,6 Prozent steigen und die Importe um 8,6 Prozent und 5,5 Prozent. Am Arbeitsmarkt werden ein Rückgang der Arbeitslosenzahl auf 2,62 Millionen in diesem und 2,36 Millionen im kommenden Jahr und eine entsprechende Quote von 5,5 Prozent und 5,0 Prozent gesehen.
Bei der unterstellten Pandemieentwicklung sollte sich der Erholungsprozess nach der Einschätzung der Ökonomen 2022 fortsetzen. Das Konsumverhalten der privaten Haushalte dürfte sich weiter normalisieren. Ähnlich würden auch die Unternehmen ihre Investitionsneigung wieder erhöhen. Auch die Weltwirtschaft und damit die Auslandsnachfrage würden sich weiter stabilisieren und die Exporte deutlich zunehmen. Der Erholungsprozess hierzulande werde aber auch die Importe spürbar steigen lassen, sodass die Wachstumsimpulse von außen insgesamt recht gering sein würden. Der Aufholprozess werde dann „im Laufe des nächsten Jahres mit Erreichen des Vor-Corona-Niveaus an Dynamik nachlassen und Richtung Potenzialpfad einschwenken“.
Die Risiken für pandemiebedingte Rückschläge, insbesondere generelle Lockdowns, hätten sich reduziert, auch global, die Bildung neuer resistenter Mutanten sei jedoch nicht auszuschließen. Offen sei auch, wie lange noch die Verzögerungen durch die Pandemie im internationalen Lieferverkehr anhalten, die den Erholungsprozess beeinträchtigen. Bisherige außenwirtschaftliche Risiken, wie durch den Brexit oder den Handelskonflikt zwischen den USA und China, seien in letzter Zeit zwar abgeklungen. Die Entwicklung in Afghanistan könnte sich allerdings auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den drei Großmächten und damit auch auf die übrige Welt auswirken.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53828042-hwwi-erwartet-verhaltene-erholung-der-deutschen-wirtschaft-015.htm
Markit: Lieferengpässe bremsen deutsche Industrie im August – DJN, 1.9.2021
Die deutsche Industrie hat im August aufgrund anhaltender Lieferengpässe Schwierigkeiten gehabt, mit der hohen Nachfrage Schritt zu halten. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 62,6 von 65,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 62,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 62,7 ermittelt worden. Zugleich blieb der Kostendruck auf einem historisch hohen Niveau.
„Während die Nachfrage nach deutschen Produkten weiter beständig steigt und die Anzahl der Neuaufträge nach wie vor zu den höchsten in der Umfragegeschichte gehört, musste die Produktion aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe vielerorts gedrosselt werden“, sagte IHS-Markit-Experte Trevor Balchin. „Wie die Umfrageergbnisse von August zeigen, ist das Produktionswachstum mittlerweile so stark hinter den Auftragseingang zurückgefallen wie nie zuvor in über 25 Jahren Datenerfassung.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53827858-markit-lieferengpaesse-bremsen-deutsche-industrie-im-august-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de
Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie empfindlich verschlechtert – Lieferengpässe magerln Autohersteller – Überblick am Morgen / DJN, 2.9.2021
Die Lage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer hat sich im August vor der IAA laut einer Mitteilung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung empfindlich abgekühlt. Der entsprechende Ifo-Wert stürzte laut den Angaben von 56,4 auf 28,8 Punkte und damit den schlechtesten Wert seit April. „Das zeigt, dass die Autobranche nach wie vor unter Lieferengpässen von Vorprodukten leidet, insbesondere bei Chips“, sagte Ifo-Industrieökonom Oliver Falck.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53838841-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Andreas Plecko: VDMA: Gute Weltkonjunktur sorgt für volle Auftragsbücher – Sechste Monat in Folge mit zweistelligen Zuwachsraten – DJN, 2.9.2021
Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben im Juli dank einer guten Weltkonjunktur und einer schwachen Vorjahresbasis kräftige Zuwächse in ihren Auftragsbüchern verzeichnet. Die Bestellungen stiegen um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Es war der sechste Monat in Folge mit zweistelligen Zuwachsraten.
„Wir erleben eine anhaltend hohe Nachfrage nach Maschinenbauprodukten aus allen Teilen der Welt, auch aus dem Inland. Viele Kunden wollen jetzt aufholen, was durch Corona 2020 liegen geblieben ist“, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. „Allerdings müssen diese Aufträge erst einmal zu Umsatz werden. Und hier machen uns die anhaltenden Lieferengpässe und Materialknappheiten zunehmend Sorge.“
Im Juli legten die Bestellungen aus dem Inland um 24 Prozent zu, aus dem Ausland kamen 43 Prozent mehr Orders. Die Euro-Staaten verbuchten ein Plus von 27 Prozent, die Nicht-Euro-Staaten sogar einen Zuwachs von 51 Prozent. Für das sehr hohe Plus aus den Nicht-Euro-Ländern waren ein extrem schwaches Vorjahresniveau sowie einige Großaufträge verantwortlich. „Es ist erfreulich, dass die Auftragszuwächse aus vielen Regionen der Welt über den Sommer hinweg stark geblieben sind“, sagte der VDMA-Chefvolkswirt.
Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum Mai bis Juli legten die Bestellungen um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Aus dem Inland kamen 34 Prozent mehr Orders, die Auslandsaufträge legten um 52 Prozent zu. Aus den Euro-Ländern wurde eine Steigerung von 46 Prozent verbucht, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 54 Prozent mehr Bestellungen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53839556-vdma-gute-weltkonjunktur-sorgt-fuer-volle-auftragsbuecher-015.htm
Deutsche Flughäfen erreichen 40 Prozent des Vorkrisenniveaus – Vor allem kurze Inladsfülge und lange Interkontinentalflüge betroffen – dpa-AFX, 31.8.2021
Im Reisemonat Juli haben knapp 9,9 Millionen Menschen die Flughäfen in Deutschland genutzt. Das waren zwar fast doppelt so viele wie im Vorjahresmonat, aber auch nur 40 Prozent des Aufkommens aus dem Juli 2019, als von der Corona-Pandemie noch keine Rede war.
Laut der am Dienstag vorgelegten Monatsbilanz des Flughafenverbandes ADV fehlen die Passagiere besonders auf Inlandsflügen und den langen Interkontinentalverbindungen. In beiden Bereichen lag die Nachfrage nur bei rund einem Viertel des Vorkrisen-Niveaus. Das wichtigste Segment blieben Europaflüge zu den typischen Ferienzielen am Mittelmeer. Hier lagen die Passagierzahlen mit 7,8 Millionen bei knapp der Hälfte (47,2 Prozent) des Aufkommens aus dem Juli 2019.
Am Montag hatte der ADV berichtet, dass die Passagierzahlen zuletzt wieder nachgelassen haben: In der Woche vom 16. bis 22. August wurden erstmals seit Monaten wieder weniger Passagiere gezählt als in der jeweiligen Vorwoche. Der Verband befürchtet, dass der Trendverlauf in diesem Jahr dem des Sommers 2020 ähneln könnte, als die Passagierzahlen nach dem touristischen Sommerhoch wieder stark zurückgingen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53814509-deutsche-flughaefen-erreichen-40-prozent-des-vorkrisenniveaus-016.htm
Andreas Plecko: Kräftiges Umsatzminus für deutschen Einzelhandel im Juli – DJN, 1.9.2021
Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli überraschend kräftig gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 5,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,9 Prozent prognostiziert.
Nach Angaben der Statistiker ist beim Vormonatsvergleich zu beachten, dass der Juni aufgrund der bundesweit damals noch sinkenden Corona-Inzidenz und der Aufhebung der Bundesnotbremse ein umsatzstarker Monat war. Für Juni wurde der monatliche Anstieg auf 4,5 (zunächst: 4,2) Prozent revidiert.
Auf Jahressicht sanken die Umsätze im Juli preisbereinigt um 0,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 waren die Umsätze dagegen kalender- und saisonbereinigt um 3,8 Prozent höher. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig größeren Revisionen.
Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Juli 2,4 Prozent weniger um als im Juni und lag 2,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. Der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln verzeichnete einen Umsatzrückgang um 7,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, lag aber um 6,1 Prozent über dem Vorkrisenniveau des Februars 2020.
Der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein Umsatzminus von 11,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Mit einem Plus von 20,7 Prozent liegen die Umsätze in dieser Branche aber weiterhin deutlich über dem Niveau vom Februar 2020.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53826503-kraeftiges-umsatzminus-fuer-deutschen-einzelhandel-im-juli-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): Ifo-Institut: Materialengpass auf dem Bau geht weiter zurück – DJN, 30.9.2021
Der Materialengpass auf den deutschen Baustellen hat sich laut einer neuen Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung abgemildert. Im August gaben demnach 42,2 Prozent der Unternehmen im Hochbau an, unter Materialknappheit zu leiden, im Juli waren es noch 48,8 Prozent gewesen, gab das Institut in München bekannt. Auch im Tiefbau entspannte sich die Lage etwas. 31,4 Prozent der Betriebe litten laut den Angaben unter Lieferengpässen, nach 33,9 Prozent im Vormonat.
„Die Flutkatastrophe im Juli hat aber örtlich neue Verwerfungen ausgelöst. Insbesondere aus Nordrhein-Westfalen gingen im August Meldungen ein, dass die Ereignisse den Materialmangel verschärft haben. Der Anteil der betroffenen Unternehmen dort liegt nun merklich über dem deutschen Durchschnitt“, sagte Ifo-Forscher Felix Leiss.
Trotz aller Verbesserungen bleibe die Versorgung insgesamt sehr angespannt. Viele Vorprodukte seien weiterhin knapp und teuer, insbesondere Dämmstoffe und Stahl. „Eine gewisse Entspannung sehen wir beim Schnittholz, dennoch sind viele Holzprodukte nur schwer zu bekommen“, erklärte Leiss. Der Engpass treibe die Baupreise, insbesondere im Hochbau. Viele Unternehmen berichteten dort von Preissteigerungen. Beinahe jede zweite Firma im Hochbau plane zudem bald weitere Erhöhungen. Auch im Tiefbau seien Preissteigerungen geplant, dies jedoch deutlich seltener. Aktuell klage zudem jeder dritte Bau-Betrieb über Probleme, geeignetes Personal zu finden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53803074-ifo-institut-materialengpass-auf-dem-bau-geht-weiter-zurueck-015.htm
Handwerksbetriebe kämpfen mit zunehmend umfangreicher gestörten Lieferketten und steigenden Materialengpässen – Impfrate sollte steigen – Unbekannter Impfstatus der Mitarbeiter behindert Auftragsannahmen – Arbeitsmarktprobleme: ausgeschriebene Lehrlingsstellen bleiben zu gut zwei Fünftel unbesetzt – ROUNDUP / dpa-AFX, 3.9.2021
Handwerksbetriebe in Deutschland sind immer mehr von Störungen in Lieferketten betroffen. Laut einer aktuellen Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks meldeten Ende August fast drei Viertel der Betriebe, dass Rohstoffe, Materialien oder Vorprodukte in den vergangenen vier Wochen nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar waren. Bei einer Firmenbefragung im Mai waren es 61 Prozent. Am häufigsten fehlten derzeit Metalle, Kunststoffe und Elektronikkomponenten. Holz und Dämmstoffe dagegen waren wieder besser verfügbar.
„Die wirtschaftliche Erholung unserer Betriebe wird zunehmend durch wieder umfangreichere Störungen der Lieferketten und durch Materialengpässe belastet“, sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur. Inzwischen müssen den Angaben nach schon drei von vier Betrieben Aufträge stornieren oder verschieben – oder sie machen wegen der Preisentwicklung Verlustgeschäfte.
„Besonders ärgerlich ist, dass die öffentliche Hand trotz aller Beteuerungen und Appelle bislang die Betriebe weitgehend im Regen stehen lässt. Knapp die Hälfte der Betriebe kann noch kein Entgegenkommen der öffentlichen Hand in der Vergabepraxis feststellen“, kritisierte Wollseifer. Bei öffentlichen Ausschreibungen müssten Preisgleitklauseln genutzt werden, die den Betrieben in einer Ausnahmesituation wie der aktuellen wirtschaftliche Planungssicherheit geben.
Für Lieferengpässe und Preissteigerungen gibt es verschiedene Gründe. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hatte Mitte August berichtet, laut einer Umfrage hätten Unternehmen etwa eine gestiegene Nachfrage auf der einen und zu geringe Produktionskapazitäten auf der anderen Seite als Grund genannt. Dazu kämen Transportprobleme: Containermangel und fehlende Frachtkapazitäten auf Schiffen sorgten für Störungen in den Lieferketten.
Mit Blick auf die Corona-Pandemie sprach das Handwerk von einer „Atempause“ in den Sommermonaten. Deutlich weniger Betriebe seien von Umsatzeinbußen betroffen. Laut Umfrage wachsen die Auftragsbestände.
„Diese zwischenzeitliche leichte Stabilisierung darf jetzt auf keinen Fall zunichte gemacht werden“, sagte Wollseifer. „Deshalb müssen wir mit allem Nachdruck beim Impfen weiter vorankommen, um die Arbeitsfähigkeit unserer Betriebe weiter aufrecht zu erhalten und den Forderungen unserer Kunden nachzukommen, die zunehmend nur vollständig geimpfte Handwerkerinnen und Handwerker in ihren Räumlichkeiten tätig werden lassen.“
Weil der Corona-Impfstatus der Beschäftigten nicht bekannt sei und Kunden dadurch keine gesicherte Auskunft dazu gegeben werden könne, müsse bereits jetzt fast jeder zehnte derart betroffene Betrieb Aufträge stornieren oder verschieben, so der Handwerkspräsident. „Es kann nicht sein, dass die Unkenntnis über den Corona-Impfstatus zu einer spürbaren Gefährdung der Auftragslage unserer Betriebe führt.“
In der Bundesregierung ist es umstritten, ob die Arbeitgeber ein Auskunftsrecht zum Impfstatus ihrer Beschäftigten erhalten sollen. Wollseifer sagte, Impfen sei das derzeit einzige Instrument, um aus der Pandemie zu kommen.
Schwierig bleibt die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Die coronabedingte Verunsicherung scheine bei den Bewerbern stärker und länger anzuhalten als bei den Betrieben, so der Verband. Von den befragten Betrieben, die in diesem Jahr Ausbildungsplätze zu besetzen haben, konnten 44 Prozent bisher ihre angebotenen Lehrstellen noch nicht vollständig besetzen. An der Betriebsbefragung nahmen vom 25. bis zum 30. August mehr als 1600 Betriebe teil.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53850154-roundup-handwerksbetriebe-kaempfen-mit-zunehmenden-lieferengpaessen-016.htm
Hans Bentzien: Allianz: Corona-Hilfen überkompensieren Probleme europäischer KMU – Insolvenzgefährdung gesunken – DJN, 2.9-2021
Die staatlichen Corona-Hilfsmaßnahmen haben die finanzielle Lage kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU) in Deutschland, Frankreich und Großbritannien offenbar nachhaltig verbessert. Die Allianz weist in einer aktuellen Studie darauf hin, dass die Insolvenzgefährdung von KMU auch nach Wegfall dieser Maßnahmen geringer sein dürfte als vor Corona.
In der Studie heißt es: „Wir haben drei Frühindikatoren ermittelt, die helfen können, die Notlage eines Unternehmens vier Jahre vor einem Konkurs zu erkennen: Rentabilität, Kapitalisierung und Zinsdeckung. Bei Anwendung dieser Kriterien auf fast 525.000 KMU stellen wir fest, dass 7 Prozent aller KMU in Deutschland, 13 Prozent in Frankreich und 15 Prozent im Vereinigten Königreich in den nächsten vier Jahren von Insolvenz bedroht sind.“ Im Jahr 2019 waren es noch 9, 14 und 17 Prozent.
„Das bedeutet, dass die staatliche Unterstützung in diesen Ländern die Folgen von Covid-19 nicht nur abfedert, sondern überkompensiert, indem direkte Subventionen (einschließlich Teilarbeitslosenregelungen) und Steuerstundungen die Wertschöpfungsverluste der nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften ab 2020 vollständig abdecken“, merken die Autoren Ana Boata und Ano Kuhanathan an.
Ohne staatliche Unterstützung wäre der Anteil der angeschlagenen KMU in Frankreich und im Vereinigten Königreich mit 17 bzw. 26 Prozent laut Allianz viel höher gewesen, da die Gewinnspannen um mehr als 5 Prozentpunkte zurückgegangen wären. „Interessanterweise wäre der Anteil in Deutschland trotz eines Schocks von fast 3 Prozentpunkten bei den Margen vom Höhepunkt bis zum Tiefpunkt relativ stabil geblieben“, heißt es in der Studie. Die drei Sektoren mit dem höchsten Anteil an gefährdeten KMU in Deutschland sind laut Allianz Automobilzulieferer, Fahrzeugbau und Dienstleistungen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53841219-allianz-corona-hilfen-ueberkompensieren-probleme-europaeischer-kmu-015.htm
Deutsche Tarifverdienste steigen im zweiten Quartal schneller – DJN, 39.8.2021
Die Tarifverdienste in Deutschland sind im zweiten Quartal 2021 schneller gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,9 (Vorquartal: 1,3) Prozent. Im Ergebnis berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und durch Tarifabschlüsse festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.
Wie Destatis weiter mitteilte, lag der Anstieg ohne Sonderzahlungen im Vorjahresvergleich bei 1,4 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent.
Überdurchschnittlich haben sich die Tarifverdienste mit Sonderzahlungen im Vergleich unter anderem im verarbeitenden Gewerbe sowie bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (jeweils 2,8 Prozent) entwickelt. Auch im Baugewerbe (2,5 Prozent), im Gastgewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (jeweils 2,4 Prozent) waren die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen deutlich höher als im Vorjahresquartal.
Unterdurchschnittlich sind die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen im Vergleich zum Vorjahresquartal vor allem in der Land- und Forstwirtschaft (1,0 Prozent), bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (1,1 Prozent) sowie in der Öffentlichen Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung (1,2 Prozent) gestiegen.
Der verbreitete Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Tarifindizes, da sie die durchschnittliche Veränderung der durch Tarifabschlüsse vereinbarten Monats- und Stundenverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer messen. Änderungen der tatsächlich bezahlten Arbeitszeit fließen in den Tarifindex nicht ein.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53803095-deutsche-tarifverdienste-steigen-im-zweiten-quartal-schneller-015.htm
TARIFKONFLIKTE (Pressespiegel / DJN, 31.8.2021) – Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 2021 deutlich zugenommen. Laut dem neuen Tarifbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) lag die Konfliktintensität im ersten Halbjahr im Schnitt bei 8,4 Punkten pro Tarifkonflikt. Der Wert beruht auf Punkten, die für unterschiedliche Eskalationsstufen vergeben werden – etwa Streikdrohungen, Warnstreiks, juristischen Auseinandersetzungen und Urabstimmung. Er ist deutlich höher als im vergangenen Jahr, als pro Verhandlung im Schnitt nur 2,3 Punkte gemessen wurden. (Welt)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813122-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
MINDESTRENTE (Pressespiegel / DJN, 31.8.2021) – Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fordert die Einführung einer Mindestrente, um eine weiter steigende Altersarmut in Deutschland zu verhindern. „Eine Mindestrente, die im Rentensystem verankert ist, wäre ein wichtiger Schritt, um Altersarmut zu reduzieren und zum sozialen Ausgleich beizutragen“, schreiben die DIW-Forscher Johannes Geyer und Peter Haan in einer Studie, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Vorbild dafür könnten die Rentenversicherungssysteme in Österreich und den Niederlanden sein. (Funke Mediengruppe)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813122-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Nach gescheiterter einstweiliger Verfügung der Bahn: Lokführerstreiks dauern an – Weiter keine Kompromiss-Signale – GESAMT-ROUNDUP / dpa-AFX, 5.9.2021
Nach erheblichen Ausfällen im Bahnverkehr auch am Wochenende setzt die Lokführergewerkschaft GDL ihre Streiks trotz wachsender Kritik fort. Die mittlerweile dritte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn soll noch bis Dienstagmorgen (02.00 Uhr) andauern. Weder von der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) noch vom Bahn-Konzern gab es bis Sonntagmittag Kompromisssignale. Kritik am Ausstand kommt nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus dem Gewerkschaftslager. DGB-Chef Reiner Hoffmann warf der GDL Partikularinteressen vor und forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Mit der dritten bundesweiten Streikrunde innerhalb weniger Wochen waren Fahrgäste erstmals auch an einem Wochenende von dem Ausstand betroffen. In Thüringen und Sachsen war es das letzte Reisewochenende vor Beginn des neuen Schuljahres. Der Streikschwerpunkt liege weiter in ostdeutschen Bundesländern sowie Metropolregionen, so die Bahn.
Das Unternehmen konnte nach eigenen Angaben das Grundangebot im Fernverkehr am Wochenende etwas aufstocken. Rund jeder dritte Fernzug sollte trotz des Arbeitskampfs fahren. An den ersten beiden Streiktagen im Personenverkehr am Donnerstag und am Freitag war es demnach nur jeder vierte. Im Regional- und S-Bahnverkehr hatten laut Bahn bundesweit unverändert rund 40 Prozent des sonst üblichen Angebots Bestand, allerdings mit regionalen Abweichungen.
Laut einer Bahnsprecherin beteiligten sich seit Beginn des Streiks am Mittwochnachmittag bis einschließlich Sonntagmorgen insgesamt mehr als 9760 Beschäftigte an dem Arbeitskampf. Bei rund 7000 Streikenden handele es sich um Lokführerinnen und Lokführer. Die zweitstärkste Berufsgruppe im Streik ist in der Regel das Bordpersonal, also Zugbegleiter oder Beschäftigte in den Bordbistros.
Die GDL will für weitere Berufsgruppen verhandeln, etwa für Werkstattbeschäftigte, Angestellte in der Verwaltung oder der Infrastruktur und in Stellwerken. Laut Bahn beteiligen sich nur wenige Beschäftigte aus diesen Gewerken am Streik. Die GDL nennt höhere Zahlen. Die Deutsche Bahn war am Donnerstag sowie am Freitag in zwei Instanzen mit einer Einstweiligen Verfügung gegen den Streik vor Arbeitsgerichten in Frankfurt gescheitert. Sie wirft der GDL vor, mit dem Ausstand auch rechtliche und politische Ziele zu verfolgen.
DGB-Chef Hoffmann kritisierte, „dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzt“. Obwohl die Differenzen zwischen Gewerkschaft und Bahn nicht sehr groß seien, weigere sich GDL-Chef Claus Weselsky, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagte Hoffmann der „Rheinischen Post“. Im Kern gehe es Weselsky also darum, seine Gewerkschaft zu erhalten und ihren Einflussbereich zu vergrößern, um auf diese Weise mehr Mitglieder zu gewinnen: „Bei Herrn Weselsky und der GDL geht es ums pure Überleben.“ Die GDL gehört zum Deutschen Beamtenbund (dbb) und nicht zum DGB.
Der Wirtschaftsflügel der Union fordert zusätzliche strengere Vorgaben für Arbeitskampf-Aktionen im Zug- und Luftverkehr. Dazu sollte eine Ankündigungspflicht von mindestens vier Tagen gehören, heißt es in einem Vorstandsbeschluss der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) von CDU und CSU. Gefordert werden auch Regelungen zum Aufrechterhalten einer Grundversorgung und eine verpflichtende Schlichtung vor dem Scheitern von Tarifverhandlungen. Bei einer Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder über Streiks solle zudem ein zusätzliches Quorum von 50 Prozent bezogen auf die Zahl der Mitarbeiter eines Betriebes eingeführt werden.
Der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolff, sagte: „Wir erleben, dass die Fahrgäste keinerlei Verständnis mehr für die Dauer der Streiks und die Beharrlichkeit der GDL haben, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, Dirk Flege, sagte: „Sowohl im Interesse der Millionen Bahnkunden als auch des Klimaschutzes kann ich nur hoffen, dass dieser Arbeitskampf bald beendet ist.“ Nach den Worten von Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer ist die Heftigkeit des Streiks für die meisten Außenstehenden nicht nachvollziehbar. „Ich hoffe nicht, dass durch den Streik Kunden vergrault werden und diese in Zukunft vermehrt auf Bus und Auto ausweichen.“ Der FDP-Politiker Oliver Luksic sagte: „Fehlende Planbarkeit macht die Schiene unattraktiver und schadet damit erheblich der gewünschten Verlagerung hin zum Bahnfahren.“
Die GDL fordert 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Zum Streikauftakt hatte die Bahn ein verbessertes Angebot vorgelegt. Der Konzern stellt etwa eine Corona-Prämie für 2021 von bis zu 600 Euro in Aussicht sowie eine Tarifvertrags-Laufzeit von 36 Monaten. Die Löhne sollen in zwei Stufen um 3,2 Prozent steigen. Weselsky hatte dies abgelehnt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53859727-gesamt-roundup-lokfuehrerstreiks-dauern-an-weiter-keine-kompromiss-signale-016.htm
SIEHE DAZU:
=> Nur jeder dritte Fernzug fährt – Bahnstreik auch am Wochenende – ROUNDUP / dpa-AFX, 5.9.2021
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53859586-roundup-nur-jeder-dritte-fernzug-faehrt-bahnstreik-auch-am-wochenende-016.htm
Bahn geht gerichtlich gegen GDL-Streik vor – dts, 2.8.2021
Nachdem die Lokführergewerkschaft GDL das neue Tarifangebot der Bahn zurückgewiesen hat, geht das Unternehmen gerichtlich gegen den laufenden Streik vor. Man habe vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Streiks eingereicht, teilte der Konzern am Donnerstag mit.
Streiks seien nur dann zulässig, „wenn sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. „Das ist nach unserer Auffassung bei den Streiks der GDL nicht der Fall.“ Nach den jüngsten Äußerungen der GDL gehe es bei dem Arbeitskampf „offenkundig mehr um rechtliche und politische Themen als darum, Lösungen für gute Arbeitsbedingungen am Verhandlungstisch zu finden“, so die Bahn. GDL-Chef Claus Weselsky hatte das neue Angebot zuvor zurückgewiesen.
„Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allen Dingen keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen“, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Es beinhalte die Beschränkung des Geltungsbereiches auf den derzeitigen Tarifvertrag. Die Bahn wolle die Gewerkschaft zwingen, für neue Mitglieder keine Tarifverträge abschließen zu können. Weselsky warf dem Konzernvorstand vor, damit die „Existenzvernichtung der GDL“ anzustreben.
Das Angebot der Bahn sei aber auch „inhaltlich nicht annehmbar“. Es beinhalte immer noch eine „Nullrunde“ für das Jahr 2021. Auch der „Angriff auf die Betriebsrente“ sei weiter vorhanden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53839446-bahn-geht-gerichtlich-gegen-gdl-streik-vor-003.htm
Bahn macht GDL neues Angebot – dts, 1.9.2021
Berlin – Unmittelbar zu Beginn der dritten Streikrunde hat die Bahn der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot unterbreitet. Es soll eine Corona-Prämie in Höhe von 400 bis 600 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten beinhalten, teilte die Bahn mit.
„Wir erfüllen zentrale Forderungen der GDL“, sagte Personalvorstand Seiler am Mittwoch. „Es gibt jetzt erst recht keinen Grund mehr für einen fast einwöchigen Streik.“ Die GDL hatte zuletzt mit kleineren Bahngesellschaften Tarifverträge abgeschlossen, die 1,4 Prozent Entgelterhöhung für 2021 und 600 Euro Corona-Prämie sowie 1,8 Prozent Entgelterhöhung 2022 bei einer Laufzeit von 28 Monaten für alle Berufe vorsehen. Die Bahn war bereits zu einer Lohnerhöhung im Gesamtvolumen von 3,2 Prozent bereit, aber erst später als von der Gewerkschaft gefordert.
Um 17 Uhr hatte am Mittwoch der GDL-Streik im Güterverkehr begonnen, in der Nacht zu Donnerstag soll ab 2 Uhr die Arbeitsniederlegung im Personenverkehr und in der Infrastruktur beginnen. Der Arbeitskampf endet laut Ankündigung der GDL erst am kommenden Dienstag (7. September) um 2 Uhr. Bereits gebuchte Tickets können storniert oder bis 17. September flexibel genutzt werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53833627-bahn-macht-gdl-neues-angebot-003.htm
Dritter GDL-Streik: Unternehmen und Fahrgäste planen um – Folgen für Unternehmen: hoher Personalaufwand und hohe Kosten – DBB: Stau von 200 bis 200 Zügen in Spitzenzeiten – Flexible Umweglösungen gesucht – 43 Prozent des Gütertransports werden durch die Bahn abgewickelt – Gefahrgüter müssen per Bahn transportiert werden, darunter viele der Chemieindustrie – „Strek gegen das Klima“: Umschichtung auf Schiff- und LKW-Transporte – ROUNDUP 2 / dpa-AFX, 1.9.2021
Die Streiks bei der Güterbahn machen den Unternehmen in Deutschland zunehmend zu schaffen. Die erneute Unterbrechung der ohnehin äußerst angespannten Lieferketten gefährde die wirtschaftliche Erholung, warnte der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen vor Beginn des dritten Arbeitskampfes bei der Deutschen Bahn. Die Unternehmen müssen viele Transporte umdisponieren.
„Das zieht einen immensen Personalaufwand und erhebliche zusätzliche Kosten nach sich“, hieß es etwa aus der Chemie-Branche. Der Bundesverband der Deutschen Industrie erneuerte seine Kritik am Vorgehen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL).
Neben dem Streik im Personenverkehr von Donnerstag an hat die GDL zu einem mehr als fünftägigen Streik im Güterverkehr der Bahn aufgerufen. Der Arbeitskampf sollte am Mittwochabend (17.00 Uhr) beginnen und bis Dienstag, 2.00 Uhr, andauern. Er trifft insbesondere die Stahlindustrie, Auto- und Maschinenbauzulieferer, die chemische und die Mineralölindustrie.
Bei den bisherigen Streiks stauten sich nach Bahnangaben in Spitzenzeiten 200 bis 300 Züge und erreichten nur verspätet ihre Ziele. Schwierigkeiten haben besonders Unternehmen, die just-in-time produzieren. Bei ihnen kommen Rohstoffe und Vorprodukte üblicherweise erst an, wenn sie benötigt werden. Das spart Lagerkosten.
„Auch bei Unternehmen, die vorgesorgt haben, sind irgendwann die Lager leer“, erklärte der Logistikexperte des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. „Es kann dadurch schon zu ersten Ausfällen kommen.“ Das gelte auch für Unternehmen im benachbarten Ausland, denn der Streik durchtrenne europäische Lieferketten.
Die Bahn fürchtet, Kunden langfristig zu verlieren. „Es ist damit ein Streik gegen das Klima“, teilte DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta am Mittwoch mit. Sie rechne damit, dass Kunden Transporte auf Lastwagen verlagern. DB Cargo habe auch Kooperationspartner mit dem Fahren von Zügen beauftragt, um system- und versorgungsrelevanten Verkehr sicherzustellen. Man setze alles daran, dass alle für die Industrie wichtigen Züge gefahren werden.
„Erneut müssen die Unternehmen mit ihren Kunden und Logistikdienstleistern kurzfristig flexible Lösungen entwickeln“, teilte der Verband der Chemischen Industrie mit. Während wegen Engpässen bei Vorprodukten schon jedes fünfte Unternehmen der Chemieindustrie die Produktion gedrosselt habe, verzögere der Streik nun auch die Auslieferung an Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie.
„Für viele Stoffe ist die Bahn das Transportmittel der Wahl, da für einige Chemikalien der Schienenweg üblicherweise vorgeschrieben ist.“ Das gilt etwa für viele Gefahrgüter, die wegen des geringeren Unfallrisikos in Zügen transportiert werden müssen.
Zwar hält die Deutsche Bahn nur noch rund 43 Prozent am Güterverkehr auf der Schiene, das übrige Geschäft übernehmen Konkurrenten. Doch die Bahn dominiert den Einzelwagenverkehr, auf den etwa die Chemie-Industrie in vielen Fällen angewiesen ist. Dabei werden Einzelwaggons in großen Rangierbahnhöfen zu langen Zügen zusammengestellt.
„Massenguttransporte, etwa die Rohstoffversorgung der Stahlindustrie, müssen jetzt so weit wie möglich auf die Binnenschifffahrt verlagert werden“, erklärte die BGA. „Zeitkritische Güter werden trotz knapper Laderaumkapazitäten nur mittels Lkw zu transportieren sein“, erklärte der Verkehrsexperte des Verbands, Carsten Taucke. Der Aufwand treibe die Transportkosten deutlich in die Höhe.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nannte auch den mittlerweile dritten Streik der GDL in der laufenden Tarifrunde unverhältnismäßig und unverantwortlich. BDI-Präsident Siegfried Russwurm warnte vor Produktionsausfällen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53830625-roundup-2-vor-dem-dritten-gdl-streik-unternehmen-und-fahrgaeste-planen-um-016.htm
SIEHE DAZU:
GDL lehnt vor fünftägigem Bahnstreik neue Schlichtung ab – Fünftägiger Streik ante portas – DJN, 31.8.2021
Die Lokführergewerkschaft GDL hat kurz vor Beginn ihres fünftägigen Bahnstreiks einen neuen Schlichtungsversuch im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn abgelehnt. „Die Bahn versucht nur Zeit zu gewinnen und mit Scheinangeboten die Öffentlichkeit und die Medienvertreter zu irritieren“ sagte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky der Augsburger Allgemeinen (Mittwochausgabe). Der Gewerkschafter wies zugleich Vorwürfe zurück, die GDL verweigere sich Gesprächen. Weselsky warf Bahnvorstand Martin Seiler vor, sich bei der letzten Verhandlungsrunde am 7. Juni 2021 geweigert zu haben, weiter zu verhandeln.
„Stattdessen wollte er in Sondierungen eintreten, um das Scheitern der Verhandlungen zu verhindern“, so der GDL-Chef. „Ich habe das nicht zugelassen, weil unsere Forderungen seit Wochen bekannt waren, und wir diese vor dem 7. Juni erheblich auf die bekannten Kennzahlen reduziert haben.“ Mit den drei privaten Bahnbetreibern Transdev, Netinera und Go-Ahead habe man erst vor kurzem neue Tarifverträge zu exakt den Konditionen abgeschlossen, welche die Bahn nun ablehne, habe Weselsky betont.
Der GDL-Bundesvorsitzende habe der Bahn vorgeworfen, das Tarifeinheitsgesetz (TEG) zum Nachteil der Beschäftigten ausnutzen zu wollen. Mit dem Gesetz gelten seit April 2021 nur noch in 16 der rund 300 Betriebsbestandteile der Bahn die Tarifverträge der GDL, in den anderen geben die Tarifverträge der Konkurrenzgewerkschaft EVG den Rahmen vor. „Die Stimmung in den Betrieben ist extrem angespannt, weil die Arbeitgeber den Eisenbahnern kaltschnäuzig ihre in den Tarifverträgen erworbenen Rechte entziehen“, sagte Weselsky. „Wir akzeptieren das TEG, aber wir kämpfen berechtigt um höhere Löhne und den Schutz der Betriebsrente für alle Eisenbahner“.
Zugleich habe der GDL-Chef den Vorwurf zurückgewiesen, er wolle der Konkurrenzgewerkschaft mit dem Streik Mitglieder abwerben. „Dass wir um Mitglieder werben, ist legitim“, sagte Weselsky. „Wir jagen aber nicht der EVG Mitglieder ab, denn nur 25 Prozent der Eintritte seit Juli 2020 stammen von der EVG. 75 Prozent der neuen Mitglieder waren vorher in keiner Gewerkschaft“.
Die GDL hat ihre Mitglieder ab Donnerstag zu einem fünftägigen Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn aufgerufen, bereits ab Mittwoch soll zudem der Güterverkehr des Unternehmens bestreikt werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53824758-gdl-lehnt-vor-fuenftaegigem-bahnstreik-neue-schlichtung-ab-015.htm
GDL ruft zu dritter Streikwelle auf – Streik soll vom 2. bis 7.September andauern – dpa-AFX, 30.8.2021
Im festgefahrenen Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ruft die Lokführergewerkschaft GDL zu einer dritten Streikwelle auf. Der Ausstand soll im Personenverkehr am Donnerstag beginnen und bis Dienstag, 7. September, 2.00 Uhr, dauern, wie Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt erklärte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53809074-gdl-ruft-zu-dritter-streikwelle-auf-016.htm
BA: Nachfrage nach Arbeitskräften wächst weiter – DJN, 30.8.2021
Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im August weiter gewachsen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg um 1 Punkt auf 123 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Damit setze sich das Nachfragewachstum nach Arbeitskräften fort, wenngleich mit schwächerer Dynamik als die Monate zuvor, erklärte die BA.
Im Vergleich zum August 2020 liegt der Stellenindex 30 Punkte im Plus. Der BA-X übertrifft auch um 9 Punkte den Wert vom März 2020, also dem letzten Berichtsmonat, bevor die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sichtbar wurden.
Gegenüber dem Vormonat ist in nahezu allen Branchen ein Stellenplus zu verzeichnen. „Die Belebung der Kräftenachfrage der letzten Zeit resultiert zu einem großen Teil aus der positiven Entwicklung des Gastgewerbes, der Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, des Handels sowie von Verkehr und Logistik aufgrund der Öffnungen seit Mai“, teilte die BA mit. Auch bei Unternehmensdienstleistungen sowie im verarbeitenden Gewerbe sei die Nachfrage gestiegen.
Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53804230-ba-nachfrage-nach-arbeitskraeften-waechst-weiter-015.htm
Hans Bentzien u.a.: Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im August trotz Sommerpause – Lage am deutschen Arbeitsmarkt besser als erwartet – Kurzarbeiterzahlen sinken – Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen nahmen zu – DJN/dpa-AFX, 31.8.2021
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August entgegen dem saisonalen Trend zurückgegangen und hat sich im August erneut besser als erwartet entwickelt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 53.000, nachdem sie im Juli nach revidierten Angaben um 90.000 (vorläufig: 91.000) zurückgegangen war. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verringerte sich auf 5,5 (Juli revidiert: 5,6) Prozent.
Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang der Arbeitslosenzahl um 30.000 und eine Quote von 5,7 Prozent prognostiziert. Basis war eine vorläufige Juli-Quote von 5,7 Prozent gewesen.
Ohne Saisonbereinigung verringerte sich die Arbeitslosenzahl um 12.000 auf 2.578.000 und lag um 377.000 unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die unbereinigte Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,6 Prozent.
Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, betrug im August 3.345.000 Personen. Das waren 355.000 weniger als vor einem Jahr.
„Der Arbeitsmarkt hat sich weiter erholt. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter kräftig gesunken, obwohl noch Sommerpause ist. Das Beschäftigungswachstum gewinnt an Schwung“, erklärte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele.
Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit im August, weil Unternehmen vor den Sommerferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Doch das wird in diesem Sommer von Nachholeffekten überlagert: Nach dem monatelangen Lockdown werden in vielen Branchen wieder verstärkt Arbeitskräfte gesucht. So sank nach Angaben der Bundesagentur zum ersten Mal seit 2010 die Zahl der Arbeitslosen im Monat August.
Die Folgen der Corona-Krise sind jedoch immer noch spürbar: Nach Schätzung der Bundesagentur liegt das Niveau der Arbeitslosigkeit dadurch noch um 261 000 Menschen höher.
Konjunkturelles Kurzarbeitergeld erhielten im Juni – aktuellere Zahlen liegen nicht vor – 1,59 Millionen Arbeitnehmer. Daten, wie viele Menschen tatsächlich Kurzarbeitergeld bezogen, liegen bis Juni vor. Nach den hochgerechneten Daten wurde in dem Monat für 1,59 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld gezahlt – damit rutschte die Summe seit Beginn der Krise erstmals unter die 2-Millionen-Marke.
Im April 2020 hatte das gezahlte Kurzarbeitergeld mit knapp 6 Millionen Euro einen Höchststand erreicht.
Auch die Anzeigen für Kurzarbeit gingen im August zurück. Vom 1. bis 25. August zeigten Unternehmen für 68 000 Menschen konjunkturelle Kurzarbeit an. Vor Beginn von Kurzarbeit müssen Betriebe eine Anzeige über den voraussichtlichen Arbeitsausfall machen. Nach aktuellen Daten zu geprüften Anzeigen wurde vom 1. bis einschließlich 25. August für 68.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt.
Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahmen weiter zu. Die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) stieg im Juli gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 100.000. Mit 44,97 Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 280.000 höher aus.
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm saisonbereinigt von Mai auf Juni um 79.000 zu. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie um 463.000 auf 33,79 Millionen. Die geringfügig entlohnte Beschäftigung erholte sich ebenfalls von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Im Juni betrug ihre Zahl 7,14 Millionen. Saisonbereinigt bedeutet das einen spürbaren Anstieg von 100.000 gegenüber dem Vormonat.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53815477-lage-am-deutschen-arbeitsmarkt-im-august-besser-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53815558-roundup-zahl-der-arbeitslosen-in-deutschland-sinkt-trotz-sommerpause-016.htm
Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im August auf 2,58 Millionen – dpa-AFX, 30.8.2021
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August entgegen dem saisonalen Trend zurückgegangen. Bundesweit waren 2,58 Millionen Menschen ohne Job, 12 000 weniger als im Juli und 377 000 weniger als im August 2020, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53815240-deutschland-zahl-der-arbeitslosen-sinkt-im-august-auf-2-58-millionen-016.htm
Heftige Kritik an Einführung von Online-Hinweisportal für Steuerbetrug – Überblick am Mittag / DJN, 2.9.2021
Die Einführung eines Online-Hinweisportals für Steuervergehen in Baden-Württemberg sorgt für heftige Kritik vor allem bei Union und FDP. Mehrere Politiker äußerten sich empört über die Initiative der grün-schwarzen Landesregierung. Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) wurde im Internet mit Hassnachrichten attackiert. Möglichkeiten, online Steuervergehen zu melden, gibt es jedoch auch in anderen Bundesländern.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53842260-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm
Umfrage: Acht von zehn Bürgern halten Schuldenbremse für richtig – dts, 2.9.2021
Berlin – 81 Prozent der Bundesbürger finden es grundsätzlich richtig, dass es die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gibt. Nur 15 Prozent sind gegenteiliger Meinung.
Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hervor, über die das „Handelsblatt“ (Freitagausgabe) berichtet. Am größten ist der Anteil der Befürworter der Schuldenbremse mit 88 Prozent bei Anhängern der Union, gefolgt von FDP-Anhängern (87 Prozent). Bei der SPD sind es 80 Prozent. Von den Anhängern der Linken und der Grünen findet es jeweils ein Fünftel nicht richtig, dass es die Schuldenbremse gibt.
Bei beiden Parteien ist die Ablehnung damit am größten. „Die Schuldenbremse hat Deutschland stark gemacht“, sagte BDA-Präsident Rainer Dulger dem „Handelsblatt“. Man sei so gut durch die Krise gekommen, weil „die Kassen voll“ gewesen seien. „Und den Zustand sollten wir auch wiederherstellen und möglichst zeitnah zur schwarzen Null zurückfinden.“
Für die Umfrage wurden vom 27. bis zum 31. August 1.001 Bürger über 18 Jahren befragt. Forsa hat dabei auch Meinungen zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme abgefragt. Nur sechs Prozent der Bürger sind der Ansicht, dass diese auch langfristig gesichert ist. 89 Prozent halten dagegen grundlegende Reformen und Veränderungen für nötig.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53846731-umfrage-acht-von-zehn-buergern-halten-schuldenbremse-fuer-richtig-003.htm
ÖSTERREICH
– STATISTIK
Umsatzplus von 20,3% bei den Dienstleistungsunternehmen im 2. Quartal 2021; dennoch deutlich unter dem Vorkrisenniveau
Austrian Recovery Barometer – Wirtschaft gelingt Turnaround im 2. Quartal 2021
Produktion tierischer Erzeugnisse 2020 weiterhin hoch; Verbrauch von Fleisch und Eiern rückläufig
Rinderbestand bleibt 2021 im Jahresvergleich stabil, leichtes Plus an Schweinen
QUELLE: https://www.statistik.at
– MELDUNGEN
„Times“-Uni-Ranking: Erstmals zwei Austro-Unis unter Top 200 – Science-APA, 2.9.2021 (aktualisierte Meldung)
Erstmals sind zwei österreichische Hochschulen im jährlichen „Times Higher Education Ranking“ in den Top 200 platziert. Neben der Uni Wien, die heuer um 27 Plätze auf Rang 137 kletterte, schaffte es in der am Donnerstag erschienenen neuen Rangliste auch die Medizin-Uni Graz in diese Gruppe. Sie kletterte von den Rangplätzen 201-250 (ab 201 wird in 50er-Schritten gerankt, später in 100ern und 200ern, Anm.) auf Platz 196.
Die Uni Wien machte heuer damit wieder in etwa jene Ränge gut, die sie im Vorjahr verloren hatte. „Die heurige Steigerung um 27 Plätze soll man nicht überbewerten, weil schon minimale Änderungen in einzelnen Indikatoren zu Ausschlägen nach unten oder oben führen können“, betonte denn auch Rektor Heinz Engl in einer Stellungnahme gegenüber der APA. „Die Uni Wien ist stabil unter den Top 200 weltweit platziert.“ Er erwartet allerdings, dass „die über 70 hochkarätigen Neuberufungen“ der vergangenen beiden Jahre die Ranking-Positionen der Uni Wien dauerhaft verbessern werden.
Für die Medizin-Uni Graz ist es der erste Vorstoß in die besten 200 Unis. Damit ist man auch dem Ziel der österreichischen Forschungsstrategie etwas nähergekommen: Diese strebt zwei Austro-Unis in den Top 100 an.
Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zeigte sich jedenfalls schon jetzt zufrieden: „Die guten Ergebnisse der österreichischen Universitäten im THE-Ranking, allen voran jene der Uni Wien und der Medizin-Uni Graz, bestätigen unseren erfolgreichen Weg und freuen mich auch persönlich sehr“, meinte er am Donnerstag in einer Aussendung. Jetzt gehe es darum, sich in jenen Bereichen zu verbessern, in denen man momentan noch Aufholbedarf habe. „Hier sehe ich vor allem noch Verbesserungsbedarf im Bereich der Kooperationen der Universitäten mit Playern aus der Wirtschaft“, erklärte Faßmann.
Die Medizin-Universitäten Innsbruck und Wien landeten jeweils auf den Plätzen 201-250, die Uni Klagenfurt auf 351-400. In der Bandbreite zwischen Platz 401 und 500 finden sich die Technische Universität (TU) Wien und die Uni Innsbruck. Plätze zwischen 601 und 800 teilen sich die TU Graz, die Uni Linz und die Uni Graz, auf 801 bis 1.000 platziert sich noch die Montanuni Leoben. Die Unis Klagenfurt und Innsbruck bzw. die TU Graz verloren dabei gegenüber dem Vorjahr leicht an Terrain, die anderen blieben gleich.
*** Platz eins erneut an University of Oxford ***
Platz eins des Times-Rankings geht bereits zum sechsten Mal in Folge an die University of Oxford. Ex aequo auf Platz zwei folgen das California Institute of Technology und die Harvard University, auf Platz vier die Stanford University (USA) und auf Platz fünf ex aequo die University of Cambridge (Großbritannien) und das Massachusetts Institute of Technology (USA). Beste kontinentaleuropäische sowie deutschsprachige Hochschule ist die ETH Zürich auf Platz 15, beste deutsche die Universität München auf Platz 32.
Für das Ranking wurden 1.662 Universitäten aus 99 Ländern und Regionen bewertet. Die Rangliste basiert auf 13 Indikatoren aus den Bereichen Forschung, Lehre, Zitierungen, Internationalisierung und Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft. Dafür wurden diesmal u.a. 108 Millionen Zitierungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen analysiert und 22.000 Wissenschafter weltweit befragt.
*** Uni Wien auch im Shanghai Ranking voran ***
Auch im kürzlich veröffentlichen Shanghai Ranking ist die Uni Wien die am besten platzierte heimische Hochschule. Sie erreichte wie im Vorjahr einen Platz zwischen 151 und 200. Die Medizin-Uni Wien sowie die Uni Innsbruck landeten ebenfalls unverändert auf den Plätzen 201 bis 300, die Technische Universität (TU) Wien wie 2020 auf Rang 301 bis 400.
Die Medizin-Uni Innsbruck, die Universität Graz und die Universität für Bodenkultur (Boku) klassierten sich im Rangbereich zwischen 401 bis 500, wobei die Uni Graz gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb, die Medizin-Uni Innsbruck sich um einen Hunderterschritt verbesserte und die Boku um einen Hunderterbereich absackte. Ebenfalls ins Ranking schafften es noch die Medizin-Uni Graz (601-700), die TU Graz (701-800), die Uni Linz, die Veterinärmedizinische Universität (jeweils 801-900) sowie die Unis Klagenfurt und Salzburg (jeweils 901 bis 1.000).
Das Shanghai-Ranking ist im Vergleich mit der Times-Rangliste stärker forschungsorientiert, herangezogen werden dafür vor allem öffentlich verfügbare Datenbanken. Die Resultate sind aber durchaus ähnlich. Global sicherte sich hier Harvard Platz eins, gefolgt von der Stanford University (USA) und der University of Cambridge (Großbritannien).
QUELLE: https://science.apa.at/power-search/11639213993058651018
Inflation im August 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 3,1% – Statistik Austria, 31.8.2021
Die Inflationsrate für August 2021 beträgt voraussichtlich 3,1%, wie aus Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat steigen die Verbraucherpreise um +0,1%.
„Im August 2021 sehen wir mit einer Inflationsrate von 3,1% den höchsten Wert seit Dezember 2011. Damals betrug die Inflation 3,2%. Die derzeit hohe Inflation ist insbesondere durch die niedrigen Energie- und Treibstoffpreise im vergangenen Sommer und den aktuellen Preisanstieg bei Flugreisen bedingt“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.“
Der Indexstand des Verbraucherpreisindex und weitere Ergebnisse für August 2021 werden am 17. September 2021 bekanntgegeben. …
QUELLE: http://www.statistik.at/web_de/presse/126630.html
Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex – WWWI: 32. und 33. Kalenderwoche 2021 – Die wöchentliche wirtschaftliche Aktivität gemäß WWWI verbesserte sich in den Kalenderwochen 32 und 33 (9. bis 22. August 2021) weiter. Nach vorläufiger Berechnung lag das BIP um 1,5% (Kalenderwoche 32) bzw. 1,25% (Kalenderwoche 33) über dem Vorkrisenniveau, einer Durchschnittswoche im Jahr 2019 als fixe Referenzperiode. – WIFO, 31.8.2021

GRAPHIK: https://www.wifo.ac.at/wwadocs/konjunktur/W%C3%B6chentlicherWIFOWirtschaftsindex/WIFO-Konjunkturberichterstattung_W%C3%B6chentlicherWIFOWirtschaftsindex_Ref.png
Im Vergleich zur selben Kalenderwoche im Vorjahr ist das BIP um 5,5% (Kalenderwoche 32) bzw. 5,1% (Kalenderwoche 33) höher. Die Bestimmungsfaktoren des WWWI zeichnen für die Kalenderwochen 32 und 33 zwar weiterhin ein günstiges Bild, die Dynamik der Expansion hat sich aber abgeschwächt.
Die Kreditkartenumsätze liegen in Summe leicht unter dem Niveau der Vorwochen. Das Passagieraufkommen auf dem Flughafen Wien nahm nicht weiter zu und auch die Google-Mobilitätsindikatoren stagnierten bzw. sanken leicht. Für die Industrie zeigt sich eine Abschwächung im Wachstum. Der temperaturbereinigte Stromverbrauch ließ im Vorwochenvergleich sowohl tagsüber als auch nachts nach und auch die Stickstoffdioxid-Emissionen an Messstationen in der Nähe von Industrieanlagen gingen leicht zurück. Die Transportindikatoren im österreichischen Güterverkehr (Lkw-Fahrleistung, Schienengütertransport und Luftfracht) zeigen am aktuellen Rand eine leichte Zunahme, während die Lkw-Fahrleistung auf deutschen Straßen wieder abnahm. Vom Arbeitsmarkt kommen gemischte Signale: Die Zahl arbeitslos gemeldeter Personen verringerte sich gegenüber den Vorwochen in vielen Branchen nur noch gering und erhöhte sich im Handel, in der Gastronomie und Beherbergung sowie den sonstigen Dienstleistungen leicht. Die Zahl offener Stellen liegt nach wie vor auf äußerst hohem Niveau.
Mit dem Beginn der Feriensaison ab der Kalenderwoche 26 und 27 zeigt sich eine weitere Zunahme der privaten Konsumausgaben. Ab der Kalenderwoche 30 nahm sowohl die Nachfrage nach Dienstleistungen, urlaubsbedingt vor allem im Bereich Gastronomie und Beherbergung, als auch jene nach Gütern zu und überschritt erstmals das Vorkrisenniveau. Während sich die Reiseverkehrsexporte am aktuellen Rand nur geringfügig veränderten, schwächte sich die Dynamik bei den Reiseverkehrsimporten etwas ab. Der BIP-Beitrag (netto) des Reiseverkehrs gegenüber der durchschnittlichen Referenzwoche 2019 verbesserte sich damit leicht. Der BIP-Beitrag (netto) des Außenhandels mit Waren ist noch positiv, hat sich gegenüber den Vorwochen aber leicht verringert.
In der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung zeigen sich weiterhin leichte Zuwächse. Der Bereich Gastronomie und Beherbergung stagnierte gegenüber den Vorwochen, in der Güterproduktion schwächt sich die Dynamik weiter ab, während die Bauwirtschaft wieder eine etwas stärkere Dynamik anzeigt.
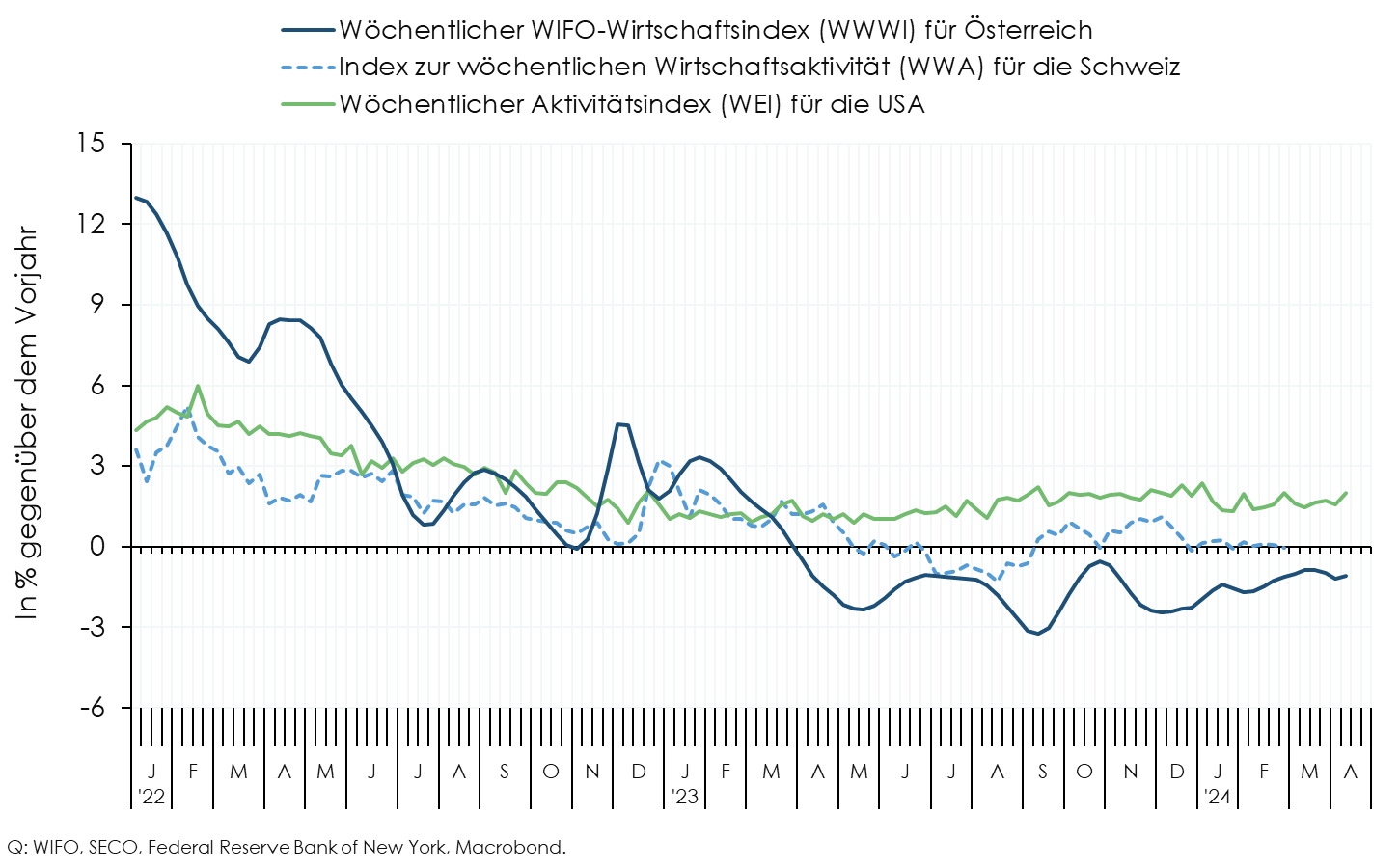
GRAPHIK: https://www.wifo.ac.at/wwadocs/konjunktur/W%C3%B6chentlicherWIFOWirtschaftsindex/WIFO-Konjunkturberichterstattung_W%C3%B6chentlicheWirtschaftsaktivit%C3%A4t.png
Der Wöchentliche WIFO-Wirtschaftsindex (WWWI) ist ein Maß für die realwirtschaftliche Aktivität der österreichischen Volkswirtschaft auf wöchentlicher Basis. Er beruht auf wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Indikatoren. Der Index ist auf die Werte der Veränderungsraten des BIP gegenüber einer entsprechenden Referenzperiode skaliert.
Ab dem 6. April 2021 wird die geschätzte prozentuelle Veränderung der saisonbereinigten realen gesamtwirtschaftlichen Aktivität in einer Kalenderwoche in zwei Varianten dargestellt: Erstens wie bisher als Veränderung gegenüber der Vorjahreswoche und zweitens als Vergleich zu einem durchschnittlichen Wochenwert im Jahr 2019 (fixe Referenzperiode). Diese erweiterte Darstellung soll die Einordnung der Ergebnisse unterstützen. Ab der Kalenderwoche 11 2021, 15. bis 21 März 2021, liegen für den Vorjahresvergleich beide Vergleichswerte in der pandemiebedingten Krisenperiode.
Da der wirtschaftliche Einbruch durch die COVID-19-Pandemie und die strikten behördlichen Restriktionen zu deren Eindämmung im Jahresverlauf 2020 in der ersten Lockdown-Periode, ab 16. März 2020, am stärksten ausfiel und folglich das Vergleichsniveau sehr niedrig ist, ist der prozentuelle Anstieg nach einem Jahr negativer Vorjahresveränderungsraten im Vorjahresvergleich außerordentlich kräftig. Die Berechnung gegenüber einer fixen Referenzperiode 2019 lässt einen Vergleich des aktuellen BIP-Niveaus mit dem Vorkrisenniveau zu.
QUELLE: https://www.wifo.ac.at/news/woechentlicher_wifo-wirtschaftsindex
Pensionskassen als Hauptbestandteil der betrieblichen Altersvorsorge – OeNB, September 2021
Die finanzielle Absicherung des Ruhestandes basiert auf drei Säulen. Die erste Säule stellt die gesetzliche Pension dar, wohingegen die zweite Säule auf die betriebliche Pension fokussiert ist und gemeinsam mit der dritten Säule (die private Vorsorge umfasst) ein wichtiges weiteres Standbein darstellt. Die zweite Säule ist im Gegensatz zur ersten Säule ein privatwirtschaftlich organisiertes Modell. Sie umfasst das veranlagte Vermögen der Pensionskassen, der betrieblichen Vorsorgekassen sowie der betrieblichen Kollektivversicherungen und schließt auch direkte Pensionszusagen von Unternehmen mit ein. In weiterer Folge wird der bedeutendste Teil der zweiten Säule dargestellt – die Pensionskassen.
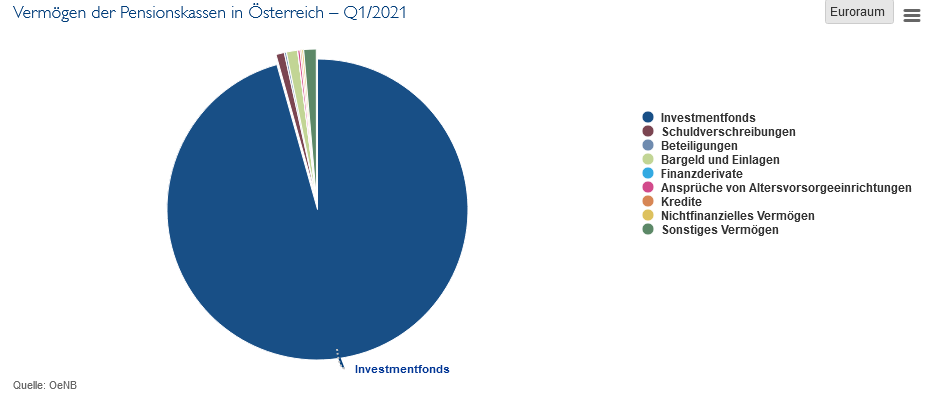
In Österreich verwalteten fünf überbetriebliche und vier betriebliche Pensionskassen im ersten Quartal 2021 ein Vermögen von 25,9 Mrd EUR. Der Vermögensbestand wuchs im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3,6 Mrd EUR, wobei dieser Anstieg fast ausschließlich (zu 3,4 Mrd EUR) auf Marktwertveränderungen zurückzuführen ist. Der Anteil an gehaltenen Investmentfonds (Drill in Grafik zu Investmentfondskategorien möglich) am gesamten Veranlagungsvermögen lag zum Ultimo des ersten Quartals 2021 bei rund 96 %. Bei Betrachtung der unterschiedlichen Vermögenskategorien im Euroraum zeigt sich, dass Investmentzertifikate mit einem Anteil von 48,2 % am Gesamtvermögen eine deutlich geringere Rolle spielten als in Österreich. Anders als in Österreich reduzierte sich das Gesamtvermögen der Pensionskassen im Euroraum im ersten Quartal 2021 – aufgrund negativer Nettotransaktionen – geringfügig und wies in Summe 3.105 Mrd EUR auf.
QUELLE (mit einer interaktiven Graphik) : https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/statistik-im-fokus/veranlagungsergebnisse-pensionskassen.html
Sozialstaat und Umverteilung gewinnen an Bedeutung – Arbeit & Wirtschaft Blog / Arbeiterkammer, 31.8.2021
Welche Rolle spielt der Sozialstaat in der Corona-Krise? Hat sich die Einstellung der Menschen zum Sozialstaat im Verlauf der Pandemie geändert? Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Sozialstaat in der Wahrnehmung vieler Menschen an Bedeutung gewonnen hat. Ein Großteil der Bevölkerung befürwortet die staatliche Einkommensumverteilung und eine Krisenfinanzierung durch Maßnahmen mit umverteilender Wirkung – wie zum Beispiel höhere Steuern auf große Unternehmen und Spitzeneinkommen.
Zustimmung zum Sozialstaat wird im Verlauf der Corona-Krise stärker
Im Juni 2020 und Jänner 2021 wurde im Rahmen der AKCOVID-Studie erhoben, ob sich die Bedeutung des Sozialstaats für die österreichische Bevölkerung seit Beginn der COVID-19-Pandemie verändert hat. Zu beiden Befragungszeitpunkten waren beinahe zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass der Sozialstaat seit Beginn der Corona-Krise „wichtiger“ geworden sei. Der Anteil der Befragten, die befanden, der Sozialstaat sei mit Beginn der Krise „viel wichtiger“ geworden, stieg im Verlauf der COVID-19-Pandemie von rund einem Drittel im Juni 2020 auf 40 Prozent im Jänner 2021. Diese Einschätzung deckt sich mit der Meinung von ExpertInnen, die dem Sozialstaat mit Andauern der Krise eine zunehmende Bedeutung für die Armutsbekämpfung zuschreiben.

GRAPHIK: https://awblog.at/wp-content/uploads/2021/08/awblog-210831-sozialstaat-1024×704.png
*** Einkommensumverteilung in der Corona-Krise ***
Viele Menschen gehen davon aus, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich im Zuge der Corona-Krise größer werden. Dementsprechend sprechen sich auch viele für staatliche Maßnahmen aus, die das Ausmaß der Einkommensungleichheit reduzieren bzw. Armut bekämpfen. In Österreich wird die staatliche Einkommensumverteilung im internationalen Vergleich stark befürwortet. Das war bereits vor Beginn der Krise der Fall. Wie schlägt sich nun die Corona-Krise auf die öffentliche Meinung zur staatlichen Einkommensumverteilung nieder?
Ein Vergleich der AKCOVID-Daten mit Daten aus dem European Social Survey aus den Jahren 2018/19 zeigt, dass sich der Grad der Zustimmung zu staatlicher Umverteilung im Zuge der COVID-19-Pandemie weiter erhöht hat. Zwar stand sowohl vor als auch während der Corona-Krise die überwiegende Mehrheit staatlicher Einkommensumverteilung positiv gegenüber. Eine Veränderung zeigt sich jedoch in der Stärke der Zustimmung: Zwischen 2018/19 und Juni 2020 ist der Anteil der Personen, die staatliche Einkommensumverteilung „voll und ganz“ befürworten, von knapp 30 Prozent auf über 40 Prozent angewachsen.
Dieser Einstellungswandel vollzog sich dabei vor allem innerhalb der Bevölkerung mit niedrigeren Bildungsabschlüssen, was durch ihre stärkere direkte Betroffenheit von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise (z. B. Kurzarbeit) erklärt werden kann: Der Anteil der „voll und ganz“ Zustimmenden erhöhte sich bei Personen ohne Matura um 16 Prozentpunkte auf rund 44 Prozent (signifikanter Anstieg), während sich dieser Anteil bei jenen mit höheren Bildungsabschlüssen nicht signifikant erhöhte.
*** Finanzierung der Krise ***
Obgleich teils argumentiert wird, dass die Krisenschulden durch ein Post-COVID-Wachstum „finanziert“ werden können, stellt sich die Frage, wie die Bevölkerung zu alternativen Finanzierungsoptionen mit umverteilender Wirkung steht. Die AKCOVID-Studie zeigt, dass höhere Steuern auf hohe Einkommen, große Unternehmen und Vermögen von der Bevölkerung grundsätzlich positiv gesehen werden. Etwa die Hälfte der Befragten war im Jänner 2021 für die stärkere Besteuerung hoher Einkommen und für Vermögenssteuern, um die Krisenfolgen zu finanzieren; mehr als zwei Drittel favorisierten eine höhere Besteuerung großer Unternehmen als Finanzierungsoption. Demgegenüber befürworten weniger als 10 Prozent der Befragten eine Kürzung von Sozialleistungen.

GRAPHIK: https://awblog.at/wp-content/uploads/2021/08/awblog-210831-sozialstaat1-1024×704.png
Fazit: Sozialstaat soll für Umverteilung sorgen
Seit Beginn der Corona-Krise hat sich für viele Menschen in Österreich die Bedeutung des Sozialstaates erhöht. Ein großer Teil der Bevölkerung sieht es als Aufgabe des Staates, soziale Ungleichheit zu verringern bzw. die Schere zwischen Arm und Reich im Zuge der Krise nicht noch weiter aufgehen zu lassen. Wie in den Befragungsdaten erkennbar ist, würde nur ein kleiner Teil der österreichischen Bevölkerung bekannte Konzepte – wie eine Erhöhung der Lohnsteuer auf besonders hohe Einkommen oder eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer – als staatliche Maßnahmen zur Reduktion sozialer Ungleichheit ablehnen. Große Teile der Bevölkerung würden hinter derartigen Maßnahmen stehen, wenn damit soziale Ungleichheit verringert werden kann und Verteilungsgerechtigkeit forciert wird.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um zentrale Ergebnisse der Studie: Bernd Liedl und Nadia Steiber: Einstellungen zum Sozialstaat im Verlauf der COVID-19-Pandemie. Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 223, 2021.
QUELLE: https://awblog.at/sozialstaat-und-umverteilung/
SIEHE DAZU:
=> Bernd Liedl und Nadia Steiber: Einstellungen zum Sozialstaat im Verlauf der COVID-19-Pandemie. Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 223, Juli 2021
QUELLE (33-Seiten-PDF): http://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/pdf/AC16251384/AC16251384.pdf
– UNTERNEHMEN
Ölkonzern OMV sieht sich vor großem Wandel – dpa-AFX, 3.9.2021
Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV steht nach den Worten seines neuen Vorstandsvorsitzenden Alfred Stern vor einem großen Wandel. Die künftige Ausrichtung werde Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz berücksichtigen, kündigte der 56-jährige Manager am Freitag an. „In einer nachhaltigen Zukunft ist es nicht vorstellbar, dass wir natürliche Ressourcen abbauen, verwenden und wegwerfen.“ Die gesamte Branche werde sich verändern.
Die teilstaatliche OMV baue zum Beispiel ihre Raffinerie in Wien-Schwechat bis 2023 für 200 Millionen Euro so um, dass zu einem Teil auch Pflanzenöle verarbeitet werden könnten. Ursprüngliche Ziele wie die Steigerung der Ölförderung waren schon unter Sterns Vorgänger Rainer Seele zu den Akten gelegt worden. Die Details der neuen Strategie sollen laut Stern im ersten Quartal 2022 vorgelegt werden, sobald der Aufsichtsrat sie gebilligt habe.
Seele hatte zuletzt noch ein Rekordergebnis für das erste Halbjahr 2021 präsentiert. Das operative Ergebnis der OMV lag bei 2,17 Milliarden Euro. Dank der Konsolidierung der Chemie-Tochter Borealis in den Konzern legte der Umsatz um 73 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zu. Die Entscheidung seines Vorgängers, einen 75-Prozent-Anteil der Borealis zu kaufen, habe der OMV ein Wachstumsfeld eröffnet, sagte Stern. Er will in dem Unternehmen mit seinen 25 000 Mitarbeitern eine Vertrauens- und Lernkultur etablieren, die die neue Ausrichtung erleichtern soll.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53850625-oelkonzern-omv-sieht-sich-vor-grossem-wandel-016.htm
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER
Eric Schmidt: Die KI-Revolution und der Wettbewerb mit China – Die Gefahr des techno-autoritären Modells – Die richtigen Standards setzen – Koalition entwickelter Demokratien – Den Wandel gestalten – Finanz & Wirtschaft / Project Syndicate, 1.9.2021
Die künstliche Intelligenz wird die Welt neu ordnen und den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern. Die demokratische Welt muss diesen Prozess anführen.
Die Welt fängt gerade erst an, sich damit auseinanderzusetzen, wie tiefgreifend die Revolution der künstlichen Intelligenz sein wird. KI-Technologien werden Wellen des Fortschritts in den Bereichen kritische Infrastruktur, Handel, Transport, Gesundheit, Bildung, Finanzmärkte, Nahrungsmittelproduktion und ökologische Nachhaltigkeit auslösen. Die erfolgreiche Einführung von künstlicher Intelligenz wird die Wirtschaft vorantreiben, die Gesellschaft umgestalten und bestimmen, welche Länder die Regeln für das kommende Jahrhundert festlegen.
Diese Chance fällt mit einem Moment der strategischen Verwundbarkeit zusammen. US-Präsident Joe Biden hat gesagt, dass sich Amerika in einem «langfristigen strategischen Wettbewerb mit China» befinde, womit er recht hat. Verwundbar sind jedoch nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch die gesamte demokratische Welt, denn die KI-Revolution untermauert den aktuellen Wertekampf zwischen Demokratie und Autoritarismus. Wir müssen beweisen, dass Demokratien in einer Ära der technologischen Revolution erfolgreich sein können.
China ist jetzt ein gleichwertiger technologischer Konkurrent. Es ist organisiert, mit Ressourcen ausgestattet und entschlossen, diesen Technologiewettbewerb zu gewinnen und die globale Ordnung zugunsten seiner eigenen begrenzten Interessen umzugestalten. KI und andere aufkommende Technologien sind von zentraler Bedeutung für Chinas Bemühungen, seinen globalen Einfluss auszuweiten, die wirtschaftliche und die militärische Macht der USA zu übertreffen und die Stabilität im eigenen Land zu sichern. China führt einen zentral gesteuerten systematischen Plan aus, um durch Spionage, Anwerbung von Talenten, Technologietransfer und Investitionen KI-Wissen aus dem Ausland zu gewinnen.
*** Die Gefahr des techno-autoritären Modells ***
Chinas Einsatz von künstlicher Intelligenz im eigenen Land ist für Gesellschaften, die individuelle Freiheit und Menschenrechte schätzen, äusserst bedenklich. Der Einsatz von KI als Instrument der Unterdrückung, der Überwachung und der sozialen Kontrolle im eigenen Land wird auch ins Ausland exportiert. China finanziert massive digitale Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt und versucht gleichzeitig, globale Standards zu setzen, die autoritäre Werte spiegeln. Seine Technologie wird zur sozialen Kontrolle und zur Unterdrückung abweichender Meinungen eingesetzt.
Um es klar zu sagen: Der strategische Wettbewerb mit China bedeutet nicht, dass wir nicht mit China zusammenarbeiten sollten, wo es sinnvoll ist. Die USA und die demokratische Welt müssen in Bereichen wie der Gesundheitsversorgung und dem Klimawandel weiterhin mit China zusammenarbeiten. Es wäre kein gangbarer Weg, den Handel und die Zusammenarbeit mit China einzustellen.
Chinas schnelles Wachstum und seine Konzentration auf soziale Kontrolle haben sein techno-autoritäres Modell für autokratische Regierungen attraktiv und für fragile Demokratien und Entwicklungsländer verlockend gemacht. Es muss noch viel getan werden, um sicherzustellen, dass die USA und die demokratische Welt wirtschaftlich tragfähige Technologie mit Diplomatie, Auslandhilfe und Sicherheitskooperation verbinden können, um mit Chinas exportiertem digitalen Autoritarismus zu konkurrieren.
*** Die richtigen Standards setzen ***
Die USA und andere demokratische Länder holen bei der Vorbereitung auf diesen globalen Technologiewettbewerb auf. Am 13. Juli hat die Nationale Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (NSCAI) einen globalen Gipfel für neue Technologien veranstaltet, der einen wichtigen komparativen Vorteil der USA und unserer Partner auf der ganzen Welt aufgezeigt hat: das breite Netzwerk von Allianzen zwischen demokratischen Ländern, das auf gemeinsamen Werten, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Anerkennung der grundlegenden Menschenrechte beruht.
Letztlich ist der globale Technologiewettbewerb ein Wettbewerb der Werte. Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern können wir bestehende Rahmenbedingungen stärken und neue erkunden, um die Plattformen, Standards und Normen von morgen zu gestalten und sicherzustellen, dass sie unsere Grundsätze spiegeln. Der Ausbau unserer globalen Führungsrolle in den Bereichen technologische Forschung, Entwicklung, Governance und Plattformen wird die Demokratien der Welt in die beste Lage versetzen, neue Chancen zu nutzen und sich gegen Schwachstellen zu schützen. Nur wenn wir in der Entwicklung von KI führend bleiben, können wir Standards für die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung dieser wichtigen Technologie setzen.
Internationale Strukturen nutzen
Der Abschlussbericht der NSCAI enthält einen Fahrplan für die demokratische internationale Gemeinschaft, um diesen Wettbewerb zu gewinnen.
Erstens muss die demokratische Welt die bestehenden internationalen Strukturen – einschliesslich der Nato, der OECD, der G-7 und der EU – nutzen, um die Bemühungen zur Bewältigung aller mit KI und neuen Technologien verbundenen Herausforderungen zu intensivieren. In diesem Zusammenhang ist die derzeitige G-7-Präsidentschaft des Vereinigten Königreichs mit ihrer soliden Technologieagenda und ihren Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit bei einer Reihe von digitalen Initiativen ermutigend. Die Entscheidung der G-7, Australien, Indien, Südkorea und Südafrika einzubeziehen, spiegelt die wichtige Erkenntnis, dass wir demokratische Länder aus aller Welt in diese Bemühungen einbinden müssen.
Ebenso ist der neu ins Leben gerufene Handels- und Technologierat zwischen den USA und der EU (der in vielerlei Hinsicht die Forderung der NSCAI nach einem strategischen Dialog zwischen den USA und der EU über aufkommende Technologien reflektiert) ein vielversprechender Mechanismus, um die grössten Handelspartner und Volkswirtschaften der Welt zusammenzubringen.
Zweitens brauchen wir neue Strukturen, wie z.B. die Vierergruppe – die USA, Indien, Japan und Australien –, um den Dialog über KI und neue Technologien sowie ihre Auswirkungen auszuweiten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Normenentwicklung, Telekommunikationsinfrastruktur, Biotechnologie und Lieferketten zu verbessern. Die Vierergruppe kann als Grundlage für eine breitere Zusammenarbeit in der indo-pazifischen Region zwischen Regierung und Industrie dienen.
*** Koalition entwickelter Demokratien ***
Drittens müssen wir mit unseren Verbündeten und Partnern zusätzliche Allianzen rund um KI und künftige Technologieplattformen aufbauen. Die NSCAI hat zur Gründung einer Koalition entwickelter Demokratien aufgerufen, um die Politik und die Massnahmen im Bereich der KI und neuer Technologien in sieben kritischen Bereichen zu synchronisieren:
& Entwicklung und Operationalisierung von Standards und Normen zur Unterstützung demokratischer Werte und der Entwicklung sicherer, zuverlässiger und vertrauenswürdiger Technologien,
& Förderung und Erleichterung koordinierter und gemeinsamer Forschung und Entwicklung im Bereich der KI und der digitalen Infrastruktur, die gemeinsame Interessen vorantreibt und der Menschheit zugutekommt,
& Förderung der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit durch gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung von Zensur, bösartigen Informationskampagnen, Menschenhandel und illiberaler Nutzung von Überwachungstechnologien,
& Erkundung von Möglichkeiten zur Erleichterung des Datenaustauschs zwischen Verbündeten und Partnern durch Schaffung von Vereinbarungen, gemeinsame Datenarchivierungsverfahren, gemeinsame Investitionen in Technologien zur Verbesserung des Schutzes der Privatsphäre und durch Beseitigung rechtlicher und regulatorischer Hindernisse,
& Förderung und Schutz von Innovationen, besonders durch Exportkontrollen, Investitionsscreening, Sicherung der Lieferketten, Investitionen in neue Technologien, Handelspolitik, Forschungs- und Cyberschutz sowie Angleichung der Rechte an geistigem Eigentum,
& Entwicklung von KI-bezogenen Talenten durch die Analyse von Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt, die Harmonisierung von Qualifikations- und Zertifizierungsanforderungen und den verstärkten Austausch von Talenten, gemeinsame Schulungen und Initiativen zur Entwicklung von Arbeitskräften,
& Lancierung einer internationalen Initiative für digitale Demokratie, um die internationalen Hilfsbemühungen zur Entwicklung, Förderung und Finanzierung der Übernahme von KI und damit verbundenen Technologien zu koordinieren, die mit demokratischen Werten und ethischen Normen in Bezug auf Offenheit, Datenschutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Einklang stehen.
*** Den Wandel gestalten ***
Dieser Schwung kann nur durch Zusammenarbeit aufrechterhalten werden. Partnerschaften – zwischen Regierungen, mit dem Privatsektor und mit der Wissenschaft – sind ein entscheidender asymmetrischer Vorteil, den die USA und die demokratische Welt gegenüber unseren Konkurrenten haben. Wie die jüngsten Ereignisse in Afghanistan gezeigt haben, sind die Fähigkeiten der USA für verbündete Operationen nach wie vor unverzichtbar, aber die USA müssen mehr tun, um Verbündete für eine gemeinsame Sache zu gewinnen. Diese Ära des strategischen Wettbewerbs verspricht, unsere Welt zu verändern. Wir können diesen Wandel entweder gestalten oder von ihm mitgerissen werden.
Wir wissen heute, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen zunehmen wird, da sich das Innovationstempo weiter erhöht. Wir wissen auch, dass unsere Gegner entschlossen sind, die Fähigkeiten der KI gegen uns einzusetzen. Jetzt müssen wir handeln.
Die Grundsätze, die wir aufstellen, die Investitionen, die wir vornehmen, die Anwendungen für die nationale Sicherheit, die wir einsetzen, die Organisationen, die wir umgestalten, die Partnerschaften, die wir schmieden, die Koalitionen, die wir bilden, und die Talente, die wir fördern, werden den strategischen Kurs für Amerika und die demokratische Welt bestimmen. Demokratien müssen investieren, was immer nötig ist, um die Führung im globalen Technologiewettbewerb zu behalten, um KI verantwortungsvoll zu nutzen, um freie Menschen und freie Gesellschaften zu verteidigen und um die Grenzen der Wissenschaft zum Wohl der gesamten Menschheit zu erweitern.
Die künstliche Intelligenz wird die Welt neu ordnen und den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern. Die demokratische Welt muss diesen Prozess anführen.
AUTOR: Eric Schmidt, ehemaliger CEO und Vorsitzender von Google/Alphabet, ist Vorsitzender der National Security Commission on Artificial Intelligence.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/die-ki-revolution-und-der-wettbewerb-mit-china/
Nouriel Roubini: The Stagflation Threat Is Real – There is a growing consensus that the US economy’s inflationary pressures and growth challenges are attributable largely to temporary supply bottlenecks that will be alleviated in due course. But there are plenty of reasons to think the optimists will be disappointed – Project Syndicate, 30.8.2021
I have been warning for several months that the current mix of persistently loose monetary, credit, and fiscal policies will excessively stimulate aggregate demand and lead to inflationary overheating. Compounding the problem, medium-term negative supply shocks will reduce potential growth and increase production costs. Combined, these demand and supply dynamics could lead to 1970s-style stagflation (rising inflation amid a recession) and eventually even to a severe debt crisis.
Until recently, I focused more on medium-term risks. But now one can make a case that “mild” stagflation is already underway. Inflation is rising in the United States and many advanced economies, and growth is slowing sharply, despite massive monetary, credit, and fiscal stimulus. There is now a consensus that the growth slowdown in the US, China, Europe, and other major economies is the result of supply bottlenecks in labor and goods markets. The optimistic spin from Wall Street analysts and policymakers is that this mild stagflation will be temporary, lasting only as long as the supply bottlenecks do. In fact, there are multiple factors behind this summer’s mini-stagflation. For starters, the Delta variant is temporarily boosting production costs, reducing output growth, and constraining labor supply. Workers, many of whom are still receiving the enhanced unemployment benefits that will expire in September, are reluctant to return to the workplace, especially now that Delta is raging. And those with children may need to stay at home, owing to school closures and the lack of affordable childcare. On the production side, Delta is disrupting the reopening of many service sectors and throwing a monkey wrench into global supply chains, ports, and logistics systems. Shortages of key inputs such as semiconductors are further hampering production of cars, electronic goods, and other consumer durables, thus boosting inflation. Still, the optimists insist that this is all temporary. Once Delta fades and benefits expire, workers will return to the labor market, production bottlenecks will be resolved, output growth will accelerate, and core inflation – now running close to 4% in the US – will fall back toward the US Federal Reserve’s 2% target by next year.
On the demand side, meanwhile, it is assumed that the US Federal Reserve and other central banks will start to unwind their unconventional monetary policies. Combined with some fiscal drag next year (when deficits may be lower), this supposedly will reduce the risks of overheating and keep inflation at bay. Today’s mild stagflation will then give way to a happy goldilocks outcome – stronger growth and lower inflation – by next year. But what if this optimistic view is incorrect, and the stagflationary pressure persists beyond this year? It is worth noting that various measures of inflation are not just well above target but also increasingly persistent. For example, in the US, core inflation, which strips out volatile food and energy prices, is likely still to be near 4% by year’s end. Macro policies, too, are likely to remain loose, judging by the Biden administration’s stimulus plans and the likelihood that weak eurozone economies will run large fiscal deficits even in 2022. And the European Central Bank and many other advanced-economy central banks remain fully committed to continuing unconventional policies for much longer. Although the Fed is considering tapering its quantitative easing (QE), it will likely remain dovish and behind the curve overall. Like most central banks, it has been lured into a “debt trap” by the surge in private and public liabilities (as a share of GDP) in recent years. Even if inflation stays higher than targeted, exiting QE too soon could cause bond, credit, and stock markets to crash. That would subject the economy to a hard landing, potentially forcing the Fed to reverse itself and resume QE. After all, that is what happened between the fourth quarter of 2018 and the first quarter of 2019, following the Fed’s previous attempt to raise rates and roll back QE. Credit and stock markets plummeted and the Fed duly halted its policy tightening. Then, when the US economy suffered a trade war-driven slowdown and a mild repo-market seizure a few months later, the Fed returned fully to cutting rates and pursuing QE (through the backdoor). This all happened a full year before COVID-19 broadsided the economy and pushed the Fed and other central banks to engage in unprecedented unconventional monetary policies, while governments engineered the largest fiscal deficits since the Great Depression. The real test of the Fed’s mettle will come when markets suffer a shock amid a slowing economy and high inflation. Most likely, the Fed will wimp out and blink. As I have argued before, negative supply shocks are likely to persist over the medium and long term. At least nine can already be discerned.
On the demand side, meanwhile, it is assumed that the US Federal Reserve and other central banks will start to unwind their unconventional monetary policies. Combined with some fiscal drag next year (when deficits may be lower), this supposedly will reduce the risks of overheating and keep inflation at bay. Today’s mild stagflation will then give way to a happy goldilocks outcome – stronger growth and lower inflation – by next year. But what if this optimistic view is incorrect, and the stagflationary pressure persists beyond this year? It is worth noting that various measures of inflation are not just well above target but also increasingly persistent. For example, in the US, core inflation, which strips out volatile food and energy prices, is likely still to be near 4% by year’s end. Macro policies, too, are likely to remain loose, judging by the Biden administration’s stimulus plans and the likelihood that weak eurozone economies will run large fiscal deficits even in 2022. And the European Central Bank and many other advanced-economy central banks remain fully committed to continuing unconventional policies for much longer. Although the Fed is considering tapering its quantitative easing (QE), it will likely remain dovish and behind the curve overall. Like most central banks, it has been lured into a “debt trap” by the surge in private and public liabilities (as a share of GDP) in recent years. Even if inflation stays higher than targeted, exiting QE too soon could cause bond, credit, and stock markets to crash. That would subject the economy to a hard landing, potentially forcing the Fed to reverse itself and resume QE. After all, that is what happened between the fourth quarter of 2018 and the first quarter of 2019, following the Fed’s previous attempt to raise rates and roll back QE. Credit and stock markets plummeted and the Fed duly halted its policy tightening. Then, when the US economy suffered a trade war-driven slowdown and a mild repo-market seizure a few months later, the Fed returned fully to cutting rates and pursuing QE (through the backdoor). This all happened a full year before COVID-19 broadsided the economy and pushed the Fed and other central banks to engage in unprecedented unconventional monetary policies, while governments engineered the largest fiscal deficits since the Great Depression. The real test of the Fed’s mettle will come when markets suffer a shock amid a slowing economy and high inflation. Most likely, the Fed will wimp out and blink. As I have argued before, negative supply shocks are likely to persist over the medium and long term. At least nine can already be discerned.
AUTOR: Nouriel Roubini, CEO of Roubini Macro Associates, is a former senior economist for international affairs in the White House’s Council of Economic Advisers during the Clinton Administration. He has worked for the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and the World Bank, and was Professor of Economics at New York University’s Stern School of Business. His website is NourielRoubini.com, and he is the host of NourielToday.com.
QUELLE: https://www.project-syndicate.org/commentary/mild-stagflation-is-here-and-could-persist-or-deepen-by-nouriel-roubini-2021-08