Views: 98
Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie in den letzten Wochen hier praktisch wortgleich festgehalten: so auch dieses Mal – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball “supertoll” geht – noch: neben kurzfristigen – oder vielleicht: mittelfristigen – Inflationsgefahren dämmert seit wenigen Wochen immer zudringlicher eine andere, in ihrem Ausmaß nicht ganz klar zu umreißende Gefahr namens Delta-Virus herauf: wachsende Unruhe herrscht deshalb nicht nur bei Gesundheitsexperten, sondern sie nimmt auch bei Finanzanlegern, Unternehmen und in der Politik zu.
SENTIX verweist auf eine ungewöhnlich stabile positive Einschätzung der Anlegerschaft trotz technisch angeschlagener Marktverfassung an den Börsen: das bedeute nichts Positives. Vor gut einem Jahr schrieb ich an anderer Stelle, die Pandemiefolgen kröchen langsam in das Getriebe der Wirtschaft, sorgten für Kursverluste spätestens im Herbst. Welch‘ eklatanter Irrtum! Nichts dergleichen passierte, offene Geldschleusen und aufmunternde Worte aus Politikermund, Friedhofszahlen der Wirtschaftsforscher, extrapoliert in die Zunkunft, hebelten den Optimismus an den Börsen höher und höher. Nach einem halben Jahrhundert Finanzmarktbeobachtung passierte mir eine mehr als bemerkenswerte Fehleinschätzung. Dass ich früher oft wenige Monate mit meinen Einschätzungen im Voraus recht hatte, ist eines, aber hier sind es nicht wenige, sondern viele Monate grober Fehleinschätzung. Kommt noch das dicke Ende wie erwartet? Gerade hat die EZB an ihrem Inflationsziel „geschraubt“: nach oben. Das bedeutet: weiter lockere Geldpolitik ohne Ende. Und die Folgen? Weiter „gut“ gehende Börsen? Alte Börsenweisheiten adé?
Wie so oft in letzter Zeit gibt es zahlreiche Meldungen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Wie an anderer Stelle bemerkt lese ich dies als Hinweis auf verstärkte Unruhe in den höheren Gremien dieser Institution; und siehe da: Kreise glauben, einen Dissens über die angekündigten geldpolitischen Maßnahmen erkennen zu können. Am 22. Juli wissen wir dazu mehr.
Weiter sehr gute Nachrichten von der Wirtschaftsfront weltweit, blickt man auf die Industrieländer. Zugemischt sind Meldungen von steigender Inflation, Lieferketten-Störungen und konsekutivem Missverhältnis zwischen drängender Nachfrage und knappem Angebot.
Das Kapital allerdings ist nicht knapp, es ist überreichlich vorhanden, auch und gerade in privater Hand: wohin damit? Eine Möglichkeit nach den neueren Theorien: weitere Verschuldung der öffentlichen Hand (!) und neuer natürlicher Zins im Negativbereich. Ja, da hat Carl Christian von Weizäcker schon recht: aus der Modellperspektive ist das alles rechtens. Aber ist das die einzig wahre Sicht? Und wie ist das mit der Saldenmechanik und dem wachsenden Schuldenberg? Und überhaupt: ist solch‘ lockere Geldpolitik, die bis ins Kleinste in das Leben aller hineinwirkt, alternativlos?
Und wie hängt die seit Jahren hochgetriebene Schuldenspirale mit der Klimakrise zusammen? Keine Frage, sie hängt damit zusammen, sie ist sogar damit engstens verzahnt. Politik des billigen Geldes als Rettung vor Arbeitslosigkeit sowie vor politischen und sozialen Unruhen? Rettung oder doch eher eine Verschiebung des Problems in die Zukunft hinein? Welches Problem? Dass man nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag über seine Verhältnisse leben kann: als Privater, als Unternehmen, als Staat, als Menschheit? Eine vernünftige Sicht oder die eines konservativen analen Zwangscharakters: Sparsamkeit als Selbstzweck oder nach Sigmund Freud als gefährliche, schärfer: gemeingefährliche neurotische Fehlhaltung, vor allem anzutreffen bei den „Stützen der Gesellschaft“?
IN DEN VORDERGRUND rücken diese Woche scheinbar wirtschaftsferne Themen:
Unwetterkatastrophen und Katastrophentourismus; man lese dazu das erhellende Interview mit Tourismusforscher Albrecht Steinecke. Alles halb so wild? Covidioten als Synonym für Irrationalismus, Ellbogen-Mentalität, Gier und Unverstand als Massenphänomen: vorübergehende Erscheinungen oder „nichts Neues unter der Sonne“? Wozu Gesellschaftswissenschaften und ethischer Unterricht in der Schule? Moral und Ethik als Schönwetterphänomen dank erzieherischer Übertünchung eines untilgbaren Urreflexes, ausgelöst in tatsächlicher oder vermeintlicher Not: Lefzen hoch, Zähne blecken und kräftig knurren, wenn es ums Eingemachte geht? Mir san mir- und i bin i-Haltung als Kernsubstanz des Menschseins? Das Zu- und Totbeißen als letzte Konsequenz wäre da nicht fern.
Cybercrime, Social Media und Mobbing: wohin führen diese Entwicklungen, nicht nur gesellschaftlich, auch wirtschaftlich, nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich? Inwieweit hängt das mit den Angriffen auf die Pressefreiheit zusammen? Auf den Flügeln des Pegasus zum Olymp oder in die Verließe von Geheimdiensten totalitärer Staaten?
Umwälzungen in der Arbeitswelt und das Eindringen der künstlichen Intelligenz in den Arbeitsalltag: kommen wir so Marx’sche Visionen näher, wenn auch nicht über Stufen einer revolutionären Entwicklung?
…oooOOOooo…
ÜBERSICHT
- UMWELT
- Folge des Klimawandels? Warum das Wetter immer extremer wird
INNOVATION – GESELLSCHAFT - Start-up Der Siegeszug der Softwareroboter: Uipath will die Büroarbeit revolutionieren – Börsenneuling Uipath ist Vorreiter bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen. CEO Daniel Dines verspricht ein Ende der manuellen Büroarbei
CYBERCRIME / SOCIAL MEDIA - Phänomen Racheporno – Bloßgestellt und abgezockt
- Erpressung: Hackerattacke auf Wolfenbütteler Klinikum, Spezialisten ermitteln – Bundesweit vereinzelte Fälle von Krankenhauserpressungen in den vergangenen Jahren – Aktuell wachsende Anzahl von schweren Cybercrime-Attacken in Deutschland
TOURISMUS - Katastrophenhochwasser in Nordrhein-Westfalen: Städte appellieren: Bitte keinen Sensationstourismus! – Absperrungen missachtet, Anweisungen ignoriert: massive Behinderung der Aufräumarbeiten
MEDIEN - Revealed: leak uncovers global abuse of cyber-surveillance weapon – Spyware sold to authoritarian regimes used to target activists, politicians and journalists, data suggests
- Pressefreiheit: Die gefährlichsten Länder für Journalist:innen
INTERNATIONAL - Wohnungsverkäufe binnen Minuten: Sorgen vor weltweiter Immobilienblase nehmen zu – Am Freitag spricht Fed-Chef Powell mit US-Finanzministerin Janet Yellen über die Risiken der steigenden Preise. Wie heiß ist der Markt weltweit gelaufen?
- Composite leading indicators (CLIs) continue to expand steadily
- OECD-Frühindikator weist auf stetiges Wachstum
BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Ungewöhnlich stabile Stimmung trotz Verschlechterung der technischen Marktverfassung signalisiert nichts Gutes
- LONDON – Frank Heiniger: Rekordverdächtiger Abschlag auf den MSCI UK
- DEUTSCHLAND – Mark Fehr: M&A-Markt im Aufwind: Investoren und Strategen kaufen wie wild Unternehmen – Beteiligungen an begehrten Geschäftsmodellen wechseln weit häufiger den Besitzer als vor der Krise. Auch die Preise steigen. Hier ein Blick auf die zehn größten Deals – Florierende Übernahmen als Zeichen für gute Laune in der Wirtschaft
- DEUTSCHLAND – COMDIREKT: IT-Panne macht Comdirect-Kunden zu schaffen – Der Zugriff auf die Konto- und Depotübersicht waren am Montag zeitweise nicht möglich, bestätigte die Onlinebank. Überweisungen und Wertpapieraufträge hingegen aber schon
- FRANKFURT/MAIN – Ab 3. September 40 Aktiengesellschaften im DAX – Die Dax-40-Kandidaten im Check – Für sieben Firmen ist der Aufstieg in den Dax 40 so gut wie sicher. Um die drei weiteren Plätze kämpfen sechs Unternehmen. Was Anleger über die Aktien wissen müssen
- FRANKFURT / MAIN – Kritischer Blick auf die 33 Jahre währende DAX-Karriere: „Dividenden-Kosmetik“ vernebelt eigentliche Wertentwicklung seit 2000 von mageren plus 11 Prozent
- FRANKFURT/MAIN – DAX-Ausblick: Privatanleger spekulieren dennoch auf ein neues Rekordhoch
- WIEN – Über 50 neue US-Titel im Segment „global market“
ZENTRALBANKEN
– JAPAN - Japan: Zentralbank legt Klimaprogramm auf
– EUROPÄISCHE UNION / EZB - EZB startet Projekt für digitalen Euro: Untersuchungsphase dauert zwei Jahre – Bargeld soll auf jeden Fall erhalten bleiben – EZB will Auswirkungen digitalen Euros für Nutzer und Banken prüfen
- EZB läutet zweijährige Untersuchungsphase für digitalen Euro ein
- EZB macht Weg frei für weitere Arbeiten am digitalen Euro: zweijährige Untersuchungsphase am Anfang – Digital-Euro noch keine beschlossene Sache – Digital-Euro als Ergänzung: Bargeld soll jedenfalls erhalten bleiben – Reaktionen aus Poltik und Wirtschaft
- EZB treibt digitalen Euro voran – Die Währungshüter der EZB fassen einen wichtigen Beschluss, sie wollen die Entwicklung einer digitalen Version des Euros vorantreiben
- Panetta: Noch keine Entscheidung für digitalen Euro gefallen
- Deutsche Kreditwirtschaft fordert tokenisierten digitalen Euro
- Augen auf die Inflationserwartungen: langfristige Inflationserwartungen liegen deutlich unter neuem Inflationziel der EZB
- EZB/Lagarde – Präzisierung: Im aktuellen Umfeld ist Hartnäckigkeit gefragt
- Lagarde zum neuen Inflationsziel: Neue Strategie macht EZB flexibler – „Hartnäckige“ Geldpolitik: Verfrühte geldpolitische Straffung ausgeschlossen
- EZB wird Forward Guidance ändern – Notwendige Hartnäckigkeit bei Umsetzung der EZB-Verpflichtungen an Zinsuntergrenze: Zins für Überschusseinlagen von Banken auf minus 0,5 Prozent gesenkt – Inflationsziel auf glatt zwei Prozent mit der Option des Überschießens: PEPP mindestens bis März 2022 – Künftige Wirtschaftsentwicklung: Lagarde wegen Delta-Variante vorsichtig – TV
- EZB-Präsidentin Lagarde deutet Änderungen an – Geldpolitische Anpassungen unter Berücksichtigung von Klimaaspekten und Kosten für selbstgenutzten Wohnungseigentums – PEPP nach Auslaufen in allgemeine Wertpapierkäufe eingliedern
- De Guindos: Entscheiden bald über Übergang von PEPP auf andere Programme – PEPP-Überführung in ein neues Format: weitreichende geldpolitische Beschlüsse bereits am 22. Juli?
- Streit im EZB-Rat über Entwurf für die nächste Sitzung am 22. Juli
- EZB/Kazimir: Lassen zu niedrige Inflation nicht mehr zu – 2 Prozent als klares und einfaches Inflationsziel
- Schnabel: EZB kann langsamer auf besseren Inflationsausblick reagieren
- EZB-Aufseherin will bei Banken-Dividenden weiter Vorsicht sehen – Auslaufen des Dividenden-Stopps bereits im September möglich – Bei außergewöhnlichen Umständen sind höhere Kapitalpuffer der Banken einzufordern
- Ökonomen schlagen fünf Kategorien für Zentralbankaktivitäten vor
– ÖSTERREICH / OeNB - OeNB revidiert Inflationsprognose für 2021 um + 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 % – Analyse stellt geringe Übertragungseffekte der Material- und Baukostenanstiege auf Endverbraucherpreise sowie Miet- und Immobilienpreise fest
USA - König Dollar schlägt alle: Abwertungsreigen der Währungen im Juni gegenüber dem US-Dollar
- US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet
- API-Daten zeigen achten Rückgang der US-Rohöllagerbestände in Folge
- Inflationserwartungen laut Beige Book nach oben gerichtet
- Preisauftrieb von Importgütern schwächt sich im Juni von 11,6 auf 11,2 Prozent ab – Mai-Rate war höchste seit zehn Jahren – Starker Preisanstieg für Exportgüter
- US-Erzeugerpreise steigen im Juni stärker als erwartet
- US-Preise steigen mit höchster Jahresrate von 5.4 Prozent seit 13 Jahren
- US-Realeinkommen sinken im Juni um rund 1 Prozent
- Philly-Fed-Index gibt im Juli stärker als erwartet nach
- New Yorker Konjunkturindex steigt im Juli überraschend stark auf Rekordhoch
- US-Industrie steigert Produktion im Juni moderat
- Stimmung der US-Verbraucher im Juli deutlich eingetrübt
- Umsätze der US-Einzelhändler steigen im Juni leicht
- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken – tiefster Wert seit März 2020
GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Inflation steigt weiter über zwei Prozent
- Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht
SCHWEIZ - Luxushäuser boomen
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - EU-Behörde sieht raschen, starken Anstieg der Infektionsfälle – Auch starker Anstieg für Österreich erwartet
- Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent
- Industrie in der Eurozone drosselt Produktion im Mai
- EU verschiebt wegen starken Drucks der USA Digitalsteuer bis Oktober – Janet Yellen lobbiert in Brüssel
- EU stellt Pläne für CO2-Grenzsteuer vor – Die EU-Kommission stellt die weltweit ersten Pläne für eine Art CO2-Steuerabgabe bei energie-intensiven Importgütern vor
- Klimaschutz gibt’s nicht umsonst: EU hat neuen Plan für CO2-Ziel – Gemischte Reaktionen aus Politik und Wirtschaft – EU-Pläne für klimaverbessernde Verkehrs-Infrastruktur – Deutsche Bundesumweltministerin (SPD) fordert rasche Umsetzung einer „neuen industrielle Revolution, angeführt von der Europäischen Union“, Bundesverkehrsminister (CSU) reagiert deutlich verhaltener
- Wirtschaft und Umweltschützer: EU-Kommisison muss mehr für Klima tun
- Inflation legt wie erwartet leicht zu
FRANKREICH - Frankreich: Inflation zieht leicht an
DEUTSCHLAND - Destatis: Deutsche Inflation im zweiten Halbjahr mit kräftigem Schub
- IfW-Präsident: Engpässe und höhere Preise bei Weihnachtsgeschenken
- Stärkster Anstieg der Großhandelspreise seit 1981
- Deutscher harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) lässt im Juni auf 2,1 Prozent Jahresrate nach – Nationaler Verbraucherpreisindex schwächt sich leicht auf 2,3 Prozent Jahresrate ab
- IWF hebt deutsche BIP-Prognose 2022 auf +4,1% (bisher: +3,4%) an
- IMK: Konjunkturelle Erholung setzt sich fort
- Commerzbank: Lockerungen und schwächerer Euro lässt Frühindikator Early Bird steigen
- HDE: Einzelhandelsumsatz wächst dieses Jahr um 1,5 Prozent
- Deutscher Einzelhandelsumsatz für Mai nach oben revidiert
- Einzelhandel: Niedrige Margen, hoher Wettbewerbsdruck – Händler in der Onlinefalle –
Nicht zuletzt der Onlineboom in Corona-Zeiten zeigt: Investition ins Digitale ist ein Muss - Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand steigt im Mai
- VDMA: EU-Kommission darf Weg zu eFuels mit Wasserstoff-Motoren nicht verbauen
- Elektromobilität Die Batterie-Lücke: Der Boom der Elektromobilität überfordert die Hersteller – Der Hochlauf der Stromauto-Produktion trifft auf Engpässe bei den Rohstoffen. Ab 2023 fehlen so Millionen Batteriezellen. Die Konzerne reagieren
- Deutschland: Noch kein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen erkennbar
- Ausgesetzte Insolvenzanstragspflicht: Insolvenzen in Deutschland weiter unter Vorjahresniveau
- Ifo-Institut nennt Anpassung des Klimaschutzgesetzes „überhastet“
- BDI: EU sollte Pläne für Digitalsteuer dauerhaft beerdigen
- Scholz dringt auf schnelle Verständigung zu Details einer Mindeststeuer – Verschiebung des EK-Vorschlags zur Digital-Abgabe begünstigt Einführung einer globalen Mindeststeuer – Rasche Boosterung der Wirtschaft wahrscheinlich: viele Aufbaupläne von EU-Staaten bereits von der Kommission akzeptiert
- Rekordwert : Geldvermögen der Deutschen steigt erstmals über Sieben-Billionen-Schwelle – Fondsbeteiligungen „so viel wie nie zuvor“: Börsenengagement nimmt 2021Q1 weiter zu – Privatverschuldung wächst weniger stark als der Vermögenszuwachs
ÖSTERREICH
– STATISTIK
Regionaler Außenhandel 2020: starke Rückgänge für fast alle Bundesländer
Baukosten im Juni 2021 weiter gestiegen
Inflation bleibt im Juni 2021 bei 2,8%
(*) Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, stieg im Jahresvergleich um 1,5% (Mai: +2,8%).
(*) Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand um 5,8% (Mai: +6,6%).
Rekordwert bei Baubewilligungen im 1. Quartal 2021; hohe Wohnbautätigkeit im Jahr 2020
Pkw-Gebrauchtzulassungen im 1. Halbjahr 2021 um ein Sechstel gestiegen
Anzahl der unter Dreijährigen in Kindertagesheimen stieg binnen zehn Jahre um 77,0%
– MELDUNGEN - Anti-Geldwäschepläne der EU-Kommission: Österreich gegen EU-Obergrenze für Bargeldzahlungen – Der ÖVP-Politiker bewertet EU-Pläne zur Geldwäschebekämpfung skeptisch. Mit Frankfurt als Sitz der neuen Geldwäschebehörde fremdelt er
- Öffnung der Hotellerie führt zu raschem Anstieg der Nächtigungen von Inländern im Juni 2021 – Inländische Gäste überwiegen – Im Vergleich zu 2019 Nächtigungseinbußen: Inländer minus 3, Ausländer minus 61, alle minus 41 Prozent – Zahlungskartendienstleister: internationaler Tourismus leidet weiter stark, ausgenommen Deutschland und Schweiz, größeres Minus bei kontinentaleuropäischen Touristen und Überseetouristen (USA!) – Totalausfall der Touristen aus China
MEINUNGEN UND KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Soziologe Wolfgang Streeck: EU will Regimewechsel in Polen und Ungarn – Aufreizende Aussage: Nationalstaat als einzige Institution, die Komplexität der Weltgesellschaft zerlegen und demokratisch regierbar macht – Plädoyer für einen genossenschaftlich-kooperativen statt imperial-hierarchischen europäischen Staatenverbund
- Interview mit Tourismusforscher Steinecke: Dark Tourism an Schauplätzen des Schreckens: Gänsehaut inklusive – Schauplätze des Schreckens wie KZ-Gedenkstätten ziehen viele Menschen an. Ist das verwerflich? Tourismusforscher Albrecht Steinecke über die dunkle Seite des Reisens
- András Szigetvari: Nach der Pandemie: Kanzler Kurz jubelt über wirtschaftliche Erholung. Zu Recht?
…oooOOOooo…
UMWELT
Folge des Klimawandels? Warum das Wetter immer extremer wird – n-tv, 15.7.2021
Die Erde erwärmt sich, die Folgen sind gravierend: Immer häufiger wird Deutschland von Starkregen oder Hitzewellen heimgesucht. Wie es zu solchen extremen Wetterphänomen kommt und welche Rolle der Klimawandel spielt, erklärt ntv.de.
Nach den sommerlichen Dürren der vergangenen Jahre scheint das Wetter in diesem Jahr in die andere Richtung umzuschlagen: Überflutungen, Dauerregen, Hagel, Sturmböen, Gewitter. Tief „Bernd“ hinterlässt im Westen Deutschlands eine Spur der Verwüstung. Solche Wetter-Extreme sind hierzulande immer häufiger zu beobachten und können laut Experten nicht allein auf den kurzfristigen Zustand des Wetters zurückgeführt werden. Wenn es um die Intensität und Häufigkeit von Starkregen sowie Hitzewellen geht, spielt auch der Klimawandel eine Rolle.
„Bei den extremen Niederschlägen, die wir in den letzten Tagen in Europa erleben, handelt es sich um Extremwetter, das durch den Klimawandel verstärkt wird“, sagt Klimaforscherin Friederike Otto von der Oxford-Universität. Auch Greenpeace macht die Klimakrise für die „aktuellen Extremwetter“, zu denen Starkregenfälle mit Hochwasser und Überschwemmungen gehören, verantwortlich: „Mit der globalen Erhitzung steigen weltweit die Temperaturen auf immer neue Rekordwerte“, sagt Klimaexperte Karsten Smid. Die Atmosphäre heize sich auf und entlade sich in Form von Unwettern.
Zwar sträuben sich Meteorologen und Wissenschaftler, einzelne Wetter-Phänomene auf die Klimakrise zurückzuführen. Denn tatsächlich ist ein kausaler Zusammenhang nur schwer nachzuweisen. Aber die Häufung der Extremwetter-Ereignisse hat weltweit die gleiche Ursache: Die Erde erwärmt sich immer mehr – und mit ihr die Luft. Das führt zu Veränderungen der wettersteuernden Luftströme, die auch als Jetstreams bezeichnet werden.
*** Erderwärmung führt zu Hitzerekorden ***
Diese Luftströme, die sich über die gesamte Erde ziehen, werden größtenteils durch die Temperaturunterschiede zwischen dem Äquator und den Polen angetrieben, erklärt ntv-Meteorologe Björn Alexander. Weil die Polregionen sich allerdings rascher erwärmen als die Bereiche in Äquatornähe, wird der sogenannte Westwinddrift schwächer und die Wetterlagen können somit grundsätzlich länger andauern.
Das bedeutet, dass beispielsweise Tiefdruckgebiete wochenlang über Deutschland verweilen, ohne zwischendurch von einem sonnigen Hochdruckgebiet verdrängt zu werden. Das aktuelle Tief „Bernd“ wäre ungefährlich, wenn es sich in zwölf Stunden über Deutschland hinwegbewegt hätte. Seine langsame Zuggeschwindigkeit macht es jedoch zum folgenreichen Problem. Das gleiche Phänomen konnte man bereits im vergangenen Jahr beobachten, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Im Sommer 2020 hatten sich Hochdruckgebiete wochenlang nicht von der Stelle bewegt, und somit jeglichen Niederschlag verhindert. Dies führte vielerorts zu heftigen Hitzewellen und Dürreperioden.
„Das Wettergeschehen ist heute immer ein Zusammenspiel aus dem üblichen Wetterzufall und den veränderten Randbedingungen durch die stark erhöhte Treibhausgasmenge in unserer Atmosphäre“, sagt Stefan Rahmstorf, Leiter des Forschungsbereiches Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Manche Hitzerekorde seien derart extrem, dass sie ohne Erderwärmung praktisch unmöglich wären, wie jüngst im Westen Nordamerikas.
„Bei Niederschlagsextremen ist die Zunahme noch nicht so groß, weil die natürlichen Schwankungen im Vergleich zum Effekt der Erderwärmung stärker sind“, erklärt Rahmsdorf. Laut Nationalem Klimareport unterliegt der Niederschlag starken Schwankungen von Jahr zu Jahr. Die deutschlandweit jährliche durchschnittliche Niederschlagsmenge nahm seit 1881 um 66 Millimeter zu – beziehungsweise um acht Prozent im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990. Auffällig sei vielmehr, dass die extremen Niederschläge häufiger werden, während Tage mit schwachem Regen seltener werden, so Rahmsdorf weiter.
„Das ist eine Folge der Physik: Pro Grad Erwärmung kann die Luft sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen und dann auch abregnen“, sagt der Wissenschaftler. Weil mehr Wasser an starken Regentagen falle, bliebe weniger für den Rest der Zeit. „Denn der Wasserdampfnachschub durch Verdunstung nimmt nur um zwei bis drei Prozent pro Grad Erwärmung zu und kann daher die Zunahme um sieben Prozent pro Grad nicht ausgleichen.“
Mit Blick auf die nächsten Jahre bedeutet das, dass die Extremwetterlagen in Deutschland zunehmen werden. Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen: Das letzte Jahrzehnt war rund 1,9 Grad Celsius wärmer als die ersten Jahrzehnte (1881 bis 1910) der Aufzeichnungen. Zudem hat das Tempo des Temperaturanstiegs in Deutschland in den vergangenen 50 Jahren deutlich zugenommen. Den Prognosen zufolge wird sich die Erhitzung fortsetzen. Dabei wirken immer natürliche Schwankungen mit, aber der Trend ist klar: aufwärts.
QUELLE (inkl. 11:22-min-Audio): https://www.n-tv.de/wissen/Warum-das-Wetter-immer-extremer-wird-article22684873.html
SIEHE DAZU:
=> Kurzvideo 0:36-min – Hochwasserschäden im Überwemmungsgebiet
=> Häuser brechen zusammen: Unwetter: Wassermassen fordern Menschenleben – n-tv, 15.7.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/panorama/Unwetter-Wassermassen-fordern-Menschenleben-article22683597.html
=> Unwetterkatastrophe im Westen: Bundeswehr hilft mit Panzern bei Rettung – n-tv, 15.7.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/panorama/Bundeswehr-hilft-mit-Panzern-bei-Rettung-article22684051.html
=> Vier Grad mehr durch Klimawandel: Städte werden deutlich trockener und heißer – n-tv, 6.1.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Staedte-werden-deutlich-trockener-und-heisser-article22273147.html
=> „Es gibt Grenzen der Anpassung“: Deutschland von Extremwetter bedroht – n-tv, Juni 2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Deutschland-von-Extremwetter-bedroht-article22619193.html
=> Dramatische Hochwasserzahlen: Wer sich nicht schützt, geht unter – n-tv, 2018
QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Wer-sich-nicht-schuetzt-geht-unter-article20225002.html
=> Massenflucht und Krankheiten: Weltklimarat zeichnet düsteres Zukunftsbild – n-tv, 23.6.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Weltklimarat-zeichnet-duesteres-Zukunftsbild-article22637742.html
INNOVATION – GESELLSCHAFT
Start-up Der Siegeszug der Softwareroboter: Uipath will die Büroarbeit revolutionieren – Börsenneuling Uipath ist Vorreiter bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen. CEO Daniel Dines verspricht ein Ende der manuellen Büroarbeit – CORONA SPEZIAL / HANDELSBLATT, 11./12.7.2021
Wer zurück im Büro ist, schätzt den Austausch mit Kollegen. Zug um Zug holen die Unternehmen ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice. Doch so manche Bürotätigkeit wird vielleicht schon bald gar nicht mehr gebraucht. Unternehmen wie Uipath entwickeln eine Software, die Routinetätigkeit von Angestellten erkennt und ersetzt. Das könnte manchen Bürojob überflüssig machen – oder dafür sorgen, dass sich die Menschen wieder mehr mit kreativen Tätigkeiten beschäftigen können.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/start-up-der-siegeszug-der-softwareroboter-uipath-will-die-bueroarbeit-revolutionieren/27398236.html
CYBERCRIME / SOCIAL MEDIA
Phänomen Racheporno – Bloßgestellt und abgezockt – TV-Programm/n-tv 14.7.2021
Nacktaufnahmen können schnell zum Albtraum werden. Einmal hochgeladen, verbreiten sie sich auf Pornoseiten unkontrollierbar schnell. Sogenannte Rachepornos sind heutzutage ein weltweites Massenphänomen, meist ausgelöst durch rachsüchtige Ex-Partner, die ihre Verflossenen mit der Veröffentlichung demütigen wollen. Die Dokumentation zeigt, welche Gefahren drohen, wenn intime Fotos und Videos in die falschen Hände geraten.
QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/tvprogramm/
CYBERCRIME
Erpressung: Hackerattacke auf Wolfenbütteler Klinikum, Spezialisten ermitteln – Bundesweit vereinzelte Fälle von Krankenhauserpressungen in den vergangenen Jahren – Aktuell wachsende Anzahl von schweren Cybercrime-Attacken in Deutschland – Deutsches Ärzteblatt, 16.7.2021
Hacker wollen Geld vom Klinikum in Wolfenbüttel erpressen. Die Ermittlungen zu dem digitalen Angriff hat die für Cybercrime in der Region zuständige Staatsanwaltschaft Göttingen übernommen.
Derzeit würden noch alle Ermittlungsmaßnahmen geprüft und nach dem möglichen Einfallstor gesucht, sagte der Behördensprecher für Internetkriminalität Mohamed Bou Sleiman gestern. Die strafrechtliche Auswertung habe gerade erst begonnen, der Angriff sei aber schnell erkannt worden.
Vorgestern hatte die Stadt Wolfenbüttel mitgeteilt, dass nach einer Hackerattacke auf das IT-System des Klinikums die Computersysteme vorsorglich heruntergefahren worden seien.
In der Mitteilung betonte der stellvertretende ärztliche Direktor Thomas Hockertz, dass „die medizinische Versorgung sichergestellt ist“. Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Daten gestohlen worden, hieß es. „Dem Hacker geht es um Geld – das Klinikum wird erpresst“, teilte die Stadt mit.
Die IT-Abteilung des Krankenhauses arbeite mit Hilfe von externen Experten daran, die Systeme wieder verfügbar zu machen, sagte Klinik-Geschäftsführer Axel Burghardt. Aufgrund der Komplexität und der Datenmenge sei der Abschluss dieses Prozesses nicht abzuschätzen.
Es müsse jetzt geprüft werden, wie die Schadsoftware auf die Klinikserver gelangen konnte. Die Netzwerke seien getrennt und die automatische Dokumentation vorerst auf Papier und Hand umgestellt, sagte Stadtsprecher Thorsten Raedlein gestern.
Zuständig für die Ermittlungen sind die Göttinger Experten, weil bei der Staatsanwaltschaft die Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) für die Region angegliedert ist.
In einer ersten Einschätzung von dort attestierte Sprecher Bou Sleiman dem Klinikum eine gute Vorbereitung auf einen solchen Angriff. Nicht nur wegen des frühen Alarms, sondern auch für ein aktuelles Back-up von wichtigen Daten. Für eine weitere Analyse sei es aber noch zu früh, sagte der Staatsanwalt gestern Nachmittag.
Vergleichbare Vorfälle im Land sind bei der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) nicht bekannt. Bundesweit habe es in den vergangenen Jahren aber vereinzelte Fälle geben, in denen Krankenhäuser Opfer von erpresserischen Attacken gewesen seien, um Geldforderungen durchzusetzen, sagte ein NKG-Sprecher. Schlagzeilen machte ein Angriff im September 2020, bei dem Hacker rund 30 Server der Düsseldorfer Uniklinik verschlüsselten, um sie zu erpressen.
Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, twitterte gestern, dass die Bonner Behörde eine wachsende Zahl von schweren Cybervorfällen sehe. Zusammen mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der Landesregierung habe er deshalb über den Ausbau der Zusammenarbeit gesprochen. Eine BSI-Sprecherin betonte, dass diese Kooperationsgespräche noch keinen Bezug zum aktuellen Angriff in Wolfenbüttel hatten.
QUELLE: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125630/Hackerattacke-auf-Wolfenbuetteler-Klinikum-Spezialisten-ermitteln
MEDIEN
Revealed: leak uncovers global abuse of cyber-surveillance weapon – Spyware sold to authoritarian regimes used to target activists, politicians and journalists, data suggests – The Guardian, 18.7.2021
Human rights activists, journalists and lawyers across the world have been targeted by authoritarian governments using hacking software sold by the Israeli surveillance company NSO Group, according to an investigation into a massive data leak.
The investigation by the Guardian and 16 other media organisations suggests widespread and continuing abuse of NSO’s hacking spyware, Pegasus, which the company insists is only intended for use against criminals and terrorists.
Pegasus is a malware that infects iPhones and Android devices to enable operators of the tool to extract messages, photos and emails, record calls and secretly activate microphones.
The leak contains a list of more than 50,000 phone numbers that, it is believed, have been identified as those of people of interest by clients of NSO since 2016.
Forbidden Stories, a Paris-based nonprofit media organisation, and Amnesty International initially had access to the leaked list and shared access with media partners as part of the Pegasus project, a reporting consortium.
The presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. However, the consortium believes the data is indicative of the potential targets NSO’s government clients identified in advance of possible surveillance attempts.
Forensics analysis of a small number of phones whose numbers appeared on the leaked list also showed more than half had traces of the Pegasus spyware.
The Guardian and its media partners will be revealing the identities of people whose number appeared on the list in the coming days. They include hundreds of business executives, religious figures, academics, NGO employees, union officials and government officials, including cabinet ministers, presidents and prime ministers.
The list also contains the numbers of close family members of one country’s ruler, suggesting the ruler may have instructed their intelligence agencies to explore the possibility of monitoring their own relatives.
The disclosures begin on Sunday, with the revelation that the numbers of more than 180 journalists are listed in the data, including reporters, editors and executives at the Financial Times, CNN, the New York Times, France 24, the Economist, Associated Press and Reuters.
The phone number of a freelance Mexican reporter, Cecilio Pineda Birto, was found in the list, apparently of interest to a Mexican client in the weeks leading up to his murder, when his killers were able to locate him at a carwash. His phone has never been found so no forensic analysis has been possible to establish whether it was infected.
NSO said that even if Pineda’s phone had been targeted, it did not mean data collected from his phone contributed in any way to his death, stressing governments could have discovered his location by other means. He was among at least 25 Mexican journalists apparently selected as candidates for surveillance over a two-year period.
Without forensic examination of mobile devices, it is impossible to say whether phones were subjected to an attempted or successful hack using Pegasus.
NSO has always maintained it “does not operate the systems that it sells to vetted government customers, and does not have access to the data of its customers’ targets”.
In statements issued through its lawyers, NSO denied “false claims” made about the activities of its clients, but said it would “continue to investigate all credible claims of misuse and take appropriate action”. It said the list could not be a list of numbers “targeted by governments using Pegasus”, and described the 50,000 figure as “exaggerated”.
The company sells only to military, law enforcement and intelligence agencies in 40 unnamed countries, and says it rigorously vets its customers’ human rights records before allowing them to use its spy tools.
The analysis also uncovered some sequential correlations between the time and date a number was entered into the list and the onset of Pegasus activity on the device, which in some cases occurred just a few seconds later.
Amnesty shared its forensic work on four iPhones with Citizen Lab, a research group at the University of Toronto that specialises in studying Pegasus, which confirmed they showed signs of Pegasus infection. Citizen Lab also conducted a peer-review of Amnesty’s forensic methods, and found them to be sound.
The consortium’s analysis of the leaked data identified at least 10 governments believed to be NSO customers who were entering numbers into a system: Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia, Hungary, India and the United Arab Emirates (UAE).
Analysis of the data suggests the NSO client country that selected the most numbers – more than 15,000 – was Mexico, where multiple different government agencies are known to have bought Pegasus. Both Morocco and the UAE selected more than 10,000 numbers, the analysis suggested.
The phone numbers that were selected, possibly ahead of a surveillance attack, spanned more than 45 countries across four continents. There were more than 1,000 numbers in European countries that, the analysis indicated, were selected by NSO clients.
The presence of a number in the data does not mean there was an attempt to infect the phone. NSO says there were other possible purposes for numbers being recorded on the list.
Rwanda, Morocco, India and Hungary denied having used Pegasus to hack the phones of the individuals named in the list. The governments of Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Saudi Arabia, Mexico, the UAE and Dubai did not respond to invitations to comment.
The Pegasus project is likely to spur debates over government surveillance in several countries suspected of using the technology. The investigation suggests the Hungarian government of Viktor Orbán appears to have deployed NSO’s technology as part of his so-called war on the media, targeting investigative journalists in the country as well as the close circle of one of Hungary’s few independent media executives.
The leaked data and forensic analyses also suggest NSO’s spy tool was used by Saudi Arabia and its close ally, the UAE, to target the phones of close associates of the murdered Washington Post journalist Jamal Khashoggi in the months after his death. The Turkish prosecutor investigating his death was also a candidate for targeting, the data leak suggests.
Claudio Guarnieri, who runs Amnesty International’s Security Lab, said once a phone was infected with Pegasus, a client of NSO could in effect take control of a phone, enabling them to extract a person’s messages, calls, photos and emails, secretly activate cameras or microphones, and read the contents of encrypted messaging apps such as WhatsApp, Telegram and Signal.
By accessing GPS and hardware sensors in the phone, he added, NSO’s clients could also secure a log of a person’s past movements and track their location in real time with pinpoint accuracy, for example by establishing the direction and speed a car was travelling in.
The latest advances in NSO’s technology enable it to penetrate phones with “zero-click” attacks, meaning a user does not even need to click on a malicious link for their phone to be infected.
Guarnieri has identified evidence NSO has been exploiting vulnerabilities associated with iMessage, which comes installed on all iPhones, and has been able to penetrate even the most up-to-date iPhone running the latest version of iOS. His team’s forensic analysis discovered successful and attempted Pegasus infections of phones as recently as this month.
Apple said: “Security researchers agree iPhone is the safest, most secure consumer mobile device on the market.”
NSO declined to give specific details about its customers and the people they target.
However, a source familiar with the matter said the average number of annual targets per customer was 112. The source said the company had 45 customers for its Pegasus spyware.
QUELLE (mit Intratext- und anderen sachbezogenen Links sowie Schaubildern): https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus
SIEHE AUCH:
=> The Pegasus Project – The Guardian
QUELLE: https://www.theguardian.com/news/series/pegasus-project
=> Stefan Krempl: „Digitale Gewalt: Wie die NSO Group Staatsterror ermöglicht“ – Die Organisation Forensic Architecture dokumentiert auf einer interaktiven Plattform über 60 Fälle, in denen mit einer NSO-Spyware Aktivisten ausgespäht wurden – Heise, 4.7.2021
QUELLE: https://www.heise.de/news/Digitale-Gewalt-Wie-die-NSO-Group-Staatsterror-ermoeglicht-6128257.html
René Bocksch: Pressefreiheit: Die gefährlichsten Länder für Journalist:innen – Statista, 8.7.2021

GRAPHIK: https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/6533.jpeg
Der Mordanschlag auf Kriminaljournalist Peter R. De Vries schockt die Niederlande. Der 64-Jährige wurde am Dienstagabend auf offener Straße niedergeschossen und kämpft seitdem um sein Leben.
Derartige Angriffe auf Journalist:innen sind in Europa eher unüblich, aber weltweit keine Seltenheit. Die Statista-Grafik zeigt die Anzahl der Medienschaffenden, die seit 2010 während und oder gerade wegen der Ausübung ihrer Arbeit getötet wurden. Den Daten des Committee to Protect Journalists zufolge ist die Berichterstattung in Syrien innerhalb der vergangenen zehn Jahre am gefährlichsten – rund 141 Medienschaffende haben hier ihr Leben verloren. Vor allem Kriegsgebiete sind die größte Gefahrenzone für Journalist:innen. Neben Syrien sind im Irak, Somalia und Afghanistan die meisten Personen getötet worden. Doch auch in Ländern wie Indien und den Philippinen werden häufig Anschläge auf die Presse verübt. In den meisten Fällen handelte es sich hier um politisch oder ideologisch motivierte Angriffe.
QUELLE: https://de.statista.com/infografik/6533/gefaehrlichste-laender-fuer-journalisten/
TOURISMUS
Katastrophenhochwasser in Nordrhein-Westfalen: Städte appellieren: Bitte keinen Sensationstourismus! – Absperrungen missachtet, Anweisungen ignoriert: massive Behinderung der Aufräumarbeiten – RTL/dpa, 18.7.2021
Mehrere Städte im Hochwassergebiet von Nordrhein-Westfalen haben an die Menschen appelliert, die betroffenen Einsatzorte zu umfahren und die Helfer nicht zu behindern. „Bitte keinen Sensationstourismus!“, hieß es am Sonntag auf der Homepage von Erftstadt. Das Stadtgebiet solle nicht zum Ausflugziel gemacht werden – ob mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß – um die Aufräumarbeiten nicht zu behindern oder sich selbst zu gefährden.
„Gaffer und Katastrophentouristen“ behindern massiv die Aufräumarbeiten, hieß es aus der Städteregion Aachen. Es gebe eine überwältigende Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, ein großes Problem seien aber diejenigen, die aus anderen Orten, Regionen und Ländern kämen, um sich die Lage anzuschauen, möglichst spektakuläre Fotos aufzunehmen und Videos zu drehen. „Wir bekommen etliche Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von professionellen Hilfskräften, dass die sogenannten Gaffer massiv die Aufräum- und Rettungsarbeiten stören“, hieß es weiter.
Sie blockierten Straßendurchfahren für schwere Fahrzeuge von Feuerwehren, DRK, THW und Müllentsorgern, die dabei sind, die Keller abzupumpen und Sperrgut abzuholen. Schaulustige missachteten zudem Absperrungen und Anweisungen von Ordnungskräften, um Katastrophenopfer beim Ausräumen der Häuser zu filmen. „Das macht mich fassungslos“, sagt Städteregionsrat Tim Grüttemeier. Polizei und Ordnungskräfte würden noch einmal deutlich verstärkt.
Auch die Stadt Leverkusen fordert Schaulustige auf, sich von den Einsatzorten fernzuhalten. Zudem gab es den dringenden Aufruf, keinen Sperrmüll oder Unrat auf die Straßen oder die Wege zu Häusern zu stellen, um mögliche Rettungseinsätze nicht zu behindern. Auch Mülltonnen sollten vom Gewicht nicht überladen werden. (© dpa-infocom, dpa:210718-99-427392/2)
QUELLE: https://www.rtl.de/cms/staedte-appellieren-bitte-keinen-sensationstourismus-4798444.html
INTERNATIONAL
Dana Heide und Kolleg*innen: Wohnungsverkäufe binnen Minuten: Sorgen vor weltweiter Immobilienblase nehmen zu – Am Freitag spricht Fed-Chef Powell mit US-Finanzministerin Janet Yellen über die Risiken der steigenden Preise. Wie heiß ist der Markt weltweit gelaufen? – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 15./16.7.2021
Die Immobilienpreise steigen – und nicht nur in Deutschland. Laut Berechnungen des Großmaklers Knight Frank steigen die Bewertungen weltweit so schnell wie seit 2006 nicht mehr. Das weckt neue Sorgen vor einer Immobilienblase.
Die Gründe für den Kaufrausch sind laut einer Deloitte-Studie dabei weltweit bemerkenswert einheitlich: billige Hypotheken, der Wunsch nach mehr Platz nach der Pandemie, Anlagenotstand, Bevölkerungszuwachs in den Metropolen – und die Furcht vieler Käufer, dass sie jetzt zuschlagen müssen, weil sie sich den Hauskauf in einigen Jahren möglicherweise nicht mehr leisten können.
Heute spricht Fed-Chef Jerome Powell mit US-Finanzministerin Janet Yellen über die Risiken der steigenden Immobilienpreise. Die Frage, die alle dabei umtreibt, lautet: Wie heiß ist der Markt weltweit gelaufen?
() In den USA liegt der mediane Hauspreis derzeit bei 350.000 Dollar. Das ist fast doppelt so viel wie vor zehn Jahren.
() In China greifen die Behörden in den Städten mit neuen Restriktionen bei der Ausgabe von Krediten zum Kauf von Immobilien in den Markt ein. So betrug die durchschnittliche Wartezeit auf eine Genehmigung für eine Hypothek im Juni in 72 Großstädten im Durchschnitt 50 Tage – ein Drittel länger als vor einem Jahr.
() In Großbritannien kostet eine Wohnung nun im nationalen Durchschnitt 246.000 Pfund, umgerechnet rund 287.000 Euro. In London liegt der Durchschnittspreis bei 510.000 Pfund. Hier stiegen die Preise im Jahresvergleich nur um 7,3 Prozent.
„Wir beobachten zum Teil ein Umsatzwachstum in einem noch nie da gewesenen Ausmaß.“ Sven Odia, Vorstandchef von Engel & Völkers
(*) In Deutschland sahen die Preissteigerungen im zweiten Quartal 2021 Rekordzuwächse mit einem Plus von 16,4 Prozent bei Eigentumswohnungen und 16,3 Prozent bei Einfamilienhäusern, so Daten des Immobilienspezialisten Value AG.
(*) Vor allem in den Metropolen fällt das Plus schmerzhaft aus: In Frankfurt verdoppelten sich die Preise für Eigentumswohnungen zwischen 2011 und 2020. Noch höhere Steigerungen verzeichnete Berlin: Eigentumswohnungen verteuerten sich um 148 Prozent, Einfamilienhäuser um 122 Prozent. Die teuerste Stadt in Deutschland bleibt jedoch München. Quadratmeterpreise von mehr als 10.000 Euro sind dort laut den Wirtschaftsforschern vom HWWI jetzt schon normal.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/marktueberblick-wohnungsverkaeufe-binnen-minuten-sorgen-vor-weltweiter-immobilienblase-nehmen-zu/27420094.html
Composite leading indicators (CLIs) continue to expand steadily – OECD, 12.7.2021
GRAPHIK: https://www.oecd.org/media/oecdorg/directorates/statisticsdirectorate/2021/CLI500-07-21.png
The OECD Composite leading indicators (CLIs), designed to anticipate turning points in economic activity relative to trend, continue to expand steadily in the OECD area as a whole and in some large emerging-market economies.
Among major OECD economies, the CLIs remain above trend and continue to expand at a steady pace in the United States, Japan and Canada as well as in the euro area as a whole, including Germany and Italy. The CLI for the United Kingdom is still expanding and has now reached above trend levels. In France, the CLI continues to grow steadily but remains below trend.
Among major emerging-market economies, the CLIs for Russia and China (industrial sector) point to steady increase. In India, the CLI now indicates stable growth whereas it continues to signal slowing growth in Brazil.
Despite the gradual lifting of COVID-19 containment measures in some countries and the progress of vaccination campaigns, persisting uncertainties might result in higher than usual fluctuations in the CLI and its components. As such, the CLIs should be interpreted with care and their magnitude should be regarded as an indication of the strength of the signal rather than as a measure of the degree of growth in economic activity.
QUELLE: https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-july-2021.htm
OECD-Frühindikator weist auf stetiges Wachstum – DJN, 12.7.2021
Der Frühindikator der OECD liegt für die meisten großen Volkswirtschaften weiter über dem Trend und deutet auf ein stetiges Wachstum. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitteilte, stieg der Indikator im Juni um 0,25 Prozent auf 100,8 Punkte. Im Mai hatte der Index um 0,23 Prozent und im April um 0,27 Prozent zugelegt.
Der Frühindikator der OECD dient dazu, sehr früh Anzeichen für konjunkturelle Wenden festzustellen. Die OECD spricht davon, dass Wendepunkte relativ zum Trend sechs bis neun Monate vor der Änderung antizipiert werden sollen.
Der Frühindikator des Euroraums stieg im Juni um 0,32 Prozent auf 100,6 Punkte, Deutschlands Indikator erhöhte sich um 0,29 Prozent auf 101,6 Punkte und der US-Indikator um 0,24 Prozent auf 100,7 Punkte. Japans Indikator legte um 0,15 Prozent auf 100,8 Punkte zu und Chinas um 0,19 Prozent auf 102,3 Punkte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53383982-oecd-fruehindikator-weist-auf-stetiges-wachstum-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-july-2021.htm
BÖRSE
SENTIX-Sentimente: Ungewöhnlich stabile Stimmung trotz Verschlechterung der technischen Marktverfassung signalisiert nichts Gutes – SENTIX, 18.7.2021
Am Aktienmarkt messen wir weiter ungewöhnliche Stimmungsentwicklungen. Obwohl sich die technische Verfassung der Aktienmärkte im Wochenverlauf verschlechtert hat, eindrucksvoll belegt zum Beispiel durch den Rückgang der Aktien über der 250 Tage-Linie im Russell 2000 Index und daraus folgend einer negativen Divergenz im Indikator, hat sich so gut wie nichts bei Sentiment und Bias getan. Dies ist u.E. kein positives Vorzeichen.
Weitere Ergebnisse: Bonds: * Private entwickeln strategisches Vertrauen * Rohöl: Strategischer Bias fällt erneut
QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-29-2021.html
LONDON – Frank Heiniger: Rekordverdächtiger Abschlag auf den MSCI UK – Der Chart des Tages/Finanz & Wirtschaft, 13.7.2021
GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/screenshot-2021-07-12-135525-640×448.jpg
Der britische Aktienmarkt hat den Anlegern über die vergangenen Jahre wenig Freude bereitet. Während beispielsweise US-Valoren gemessen am Leitindex S&P 500 auf Höchstständen notieren, hat sich das britische Pendant FTSE 100 seit Ende 2016 kaum bewegt. Langfristigen Investoren aus dem Ausland dürfte zudem die Pfundabwertung die Nettorendite verhagelt haben.
Einer der Gründe, weshalb der britische Aktienmarkt anderen Börsenplätzen hinterherhinkt, ist in der Sektorzusammensetzung zu finden: Energie- und Rohstoffunternehmen, die vergleichsweise prominent vertreten sind, kamen über die letzten Jahre kaum in die Gänge. Zudem sorgte die unklare Ausgestaltung des EU-Austritts lange für Unsicherheit.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2095/
DEUTSCHLAND – Mark Fehr: M&A-Markt im Aufwind: Investoren und Strategen kaufen wie wild Unternehmen – Beteiligungen an begehrten Geschäftsmodellen wechseln weit häufiger den Besitzer als vor der Krise. Auch die Preise steigen. Hier ein Blick auf die zehn größten Deals – Florierende Übernahmen als Zeichen für gute Laune in der Wirtschaft – Drankfurter Allgemeine Zeitung, 17.7.2021
Das Geschäft mit Unternehmenskäufen hat trotz der andauernden Verunsicherung durch die Pandemie rasant an Fahrt aufgenommen. Das zeigt eine breite Auswertung von mehreren Transaktionsdatenbanken durch die M&A-Beratung Oaklins. Demnach wurden in der ersten Hälfte des Jahres gut 63 Prozent mehr Deals mit Beteiligung deutscher Unternehmen abgeschlossen als im Vorjahreszeitraum, der durch den Corona-Ausbruch stark belastet war. Besonders bemerkenswert jedoch ist, dass die aktuelle Erholung so stark verläuft, dass auch das Vorkrisenniveau weit übertroffen wird. Denn im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 beträgt der Anstieg 19 Prozent.
Florian von Alten, Vorstand von Oaklins, erwartet daher ein außergewöhnlich gutes Jahr für die deutsche M&A-Branche. „Der Markt ist nach der Corona-Schockstarre sehr schnell zurückgekommen“, sagt von Alten. Er glaubt, dass in diesem Jahr 2200 Transaktionen stattfinden können. Betrachtet werden hier Transaktionen, bei denen entweder der Käufer oder das gekaufte Unternehmen in Deutschland sitzt.
Die Entwicklung des M&A-Marktes ist nicht nur interessant für Unternehmensberater und Juristen, die an den Deals viel Geld verdienen. Florierende Übernahmen sind auch ein Zeichen für gute Laune in der Wirtschaft insgesamt. Wenn wieder kräftig in Unternehmensbeteiligungen investiert wird, macht das Hoffnung für die Zukunft. Oder brummt das M&A-Geschäft nur, weil von der Krise zermürbte Unternehmen zu Schnäppchenpreisen an opportunistische Firmenjäger verscherbelt werden? Diese Sorge ist offenbar unbegründet: „Wir hatten kaum mit Sanierungsfällen zu tun“, sagt Transaktionsfachmann von Alten. Zudem zeigten die Auswertung von Datenbanken und die Erfahrung mit eigenen Projekten, dass nicht nur die Zahl der Transaktionen stark gewachsen sei, sondern auch die gezahlten Preise.
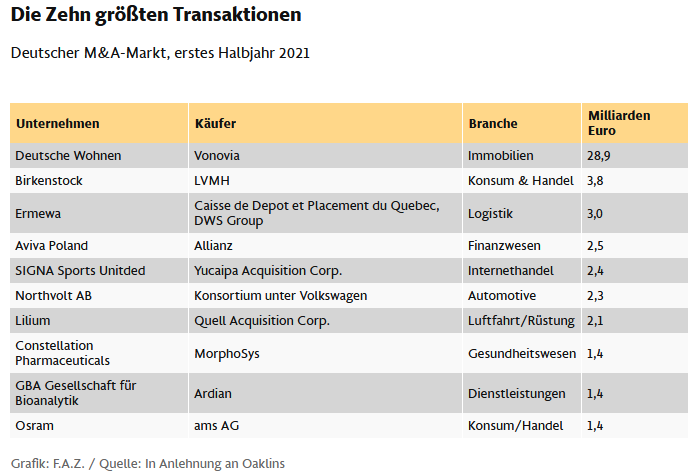
In vielen Branchen liegen die Bewertungen der Unternehmensanteile laut Oaklins schon wieder auf dem Niveau vor der Krise, teils sogar darüber. Das gelte insbesondere für die aus Sicht von Käufern begehrten Geschäftsbereiche Digitalisierung, Maschinen- und Anlagenbau sowie Gesundheitswesen. Für gute Unternehmen herrsche ein Verkäufermarkt. Eigentümer können also hohe Preise verlangen. „Angesichts der starken wirtschaftlichen Erholung schwindet bei vielen Käufern mittlerweile sogar die Hoffnung, angeschlagene Unternehmen übernehmen zu können“, sagt von Alten. Allerdings bleibe die Lage von Unternehmen aus den stark von Corona betroffenen Branchen wie Gastronomie, Messen oder Veranstaltungen immer noch prekär.
Finanzinvestoren machen Rekorde
Übernahmen werden nicht nur durch Strategen getätigt, also Unternehmen, die Konkurrenten übernehmen oder ihr Geschäft auf andere Branchen ausdehnen. Auch Finanzinvestoren kaufen in großem Stil Firmen, um ihre Beteiligungen nach einigen Jahren mit Gewinn verkaufen oder an die Börse bringen zu können. So steigert die Beteiligungsbranche die Rendite ihrer Kapitalgeber, etwa Pensionsfonds oder Versicherungen. Finanzinvestoren haben ihren Anteil an den deutschen M&A-Transaktionen im ersten Halbjahr auf 37 Prozent gesteigert. Das ist laut den Oaklins-Fachleuten ein Rekord. Sie erklären die Entwicklung damit, dass die Finanzinvestoren auf außergewöhnlich viel Kapital sitzen und zu niedrigen Zinsen Kredite aufnehmen können, um ihre Unternehmenskäufe zu finanzieren.
So schaffte es der Finanzinvestor Ardian, hervorgegangen aus der französischen Versicherungsgruppe Axa und mittlerweile eigenständig, mit einer Übernahme unter die zehn größten Transaktionen des ersten Halbjahrs. Ardian kaufte für knapp 1,4 Milliarden Euro die GBA Gesellschaft für Bioanalytik, ein deutscher Dienstleister, zu dessen Kunden etwa die Labore der Lebensmittel-, Umwelt- und Pharmabranche zählen. Die mit weitem Abstand größte Transaktion stellte jedoch ein strategischer Käufer auf die Beine. Es handelt sich um die Übernahme des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen durch den Großvermieter Vonovia für 28,9 Milliarden Euro. Beide Unternehmen sind börsennotiert und gehören dem Leitindex Dax an.
Strategisch deutlich überraschender war der zweitgrößte Deal: Die einst als leicht spießig geltende Schuhmarke Birkenstock war ausgerechnet in den Augen des französischen Luxuskonzerns LVMH so viel wert, dass er fast 3,8 Milliarden Euro für das deutsche Unternehmen zahlte. Für Aufsehen sorgte auch die Übernahme des Internethandelsunternehmens SIGNA Sports United durch das amerikanische Akquisitionsvehikel Yucaipa. Die Transaktion dient dazu, das Unternehmen in New York an die Börse zu bringen.
Investoren hatten große Teile des Kapitals schon bereitgestellt, bevor überhaupt feststand, in welche Beteiligung die Mittel investiert würden. Solche sogenannten SPAC-Transaktionen haben in den Vereinigten Staaten einen Boom erlebt. Am deutschen Transaktionsmarkt dagegen dürfte diese Spielart nach Ansicht von Oaklins-Vorstand Florian von Alten eher kein Massenphänomen werden.
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/investoren-und-strategen-kaufen-wie-wild-unternehmen-17441459.html
DEUTSCHLAND – COMDIREKT: IT-Panne macht Comdirect-Kunden zu schaffen – Der Zugriff auf die Konto- und Depotübersicht waren am Montag zeitweise nicht möglich, bestätigte die Onlinebank. Überweisungen und Wertpapieraufträge hingegen aber schon – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT/dpa, 12./13.7.2021
Eine IT-Panne hat Kunden der Comdirect gestern zu schaffen gemacht. Der Zugriff auf die Konto- und Depotübersicht war zeitweise nicht möglich. Nicht zum ersten Mal. So konnten sich Kunden der Onlinebank auch an einem Dienstagvormittag im Februar dieses Jahres nicht einloggen.
Problematisch war dies vor allem deshalb, weil der Dax nach einem stabilen Handelsstart just zu dieser Zeit deutlich ins Minus rutschte. Viele Comdirect-Kunden wollten deshalb aktiv werden – konnten es wegen der Panne aber nicht. „Was nützt ein Onlinebroker, wenn er nicht funktioniert, wenn was los ist?“, hatte damals ein Kunde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kritisiert. Comdirect hatte sich „für die Unannehmlichkeiten“ entschuldigt.
QUELLE: https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzsektor-it-panne-macht-comdirect-kunden-zu-schaffen/27413302.html
FRANKFURT/MAIN – Andrea Cünnen: Ab 3. September 40 Aktiengesellschaften im DAX – Die Dax-40-Kandidaten im Check – Für sieben Firmen ist der Aufstieg in den Dax 40 so gut wie sicher. Um die drei weiteren Plätze kämpfen sechs Unternehmen. Was Anleger über die Aktien wissen müssen – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 16.7.2021
Am 3. September gibt die Deutsche Börse die im vergangenen November beschlossene größte Veränderung in der 33-jährigen Geschichte des Dax bekannt: Deutschlands wichtigster Börsenindex wird von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. Bei der Auswahl wird nur noch die Marktkapitalisierung der frei gehandelten Aktien der letzten 20 Handelstage entscheidend sein. Der Rang im Börsenumsatz am deutschen Handelsplatz Xetra spielt keine Rolle mehr. Künftig reicht ein Mindestumsatz.
Luca Thorißen, Indexexperte bei der Stifel Europe Bank, hat sich für das Handelsblatt angesehen, welche Unternehmen neu in den Dax 40 einziehen könnten. Alle Unternehmen kommen aus dem MDax der bislang 60 größten deutschen Unternehmen, der im September auf 50 Werte verkleinert wird.
Auf Rang 18 der Marktkapitalisierung steht laut Thorißen der Onlinemodehändler Zalando, es folgen der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers (26), der Duft- und Aromenhersteller Symrise (27), der Kochboxenversender Hellofresh (29), die Porsche Automobilholding (30) und der Chemikalienhändler Brenntag (33). „Für diese Unternehmen ist der Dax-Einzug so gut wie sicher“, sagt Thorißen.
Danach wird es aber schon enger. Aktuell kämen auch der Labortechnikkonzern Sartorius (Rang 36), Puma (39) und Beiersdorf (40) in den Dax 40. Doch auch der Diagnostikkonzern Qiagen, LEG Immobilien und Hannover Rück auf den Rängen 41 bis 43 haben noch Chancen auf den Aufstieg. Thorißen spricht von einem „Sechskampf“.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/index-erweiterung-die-dax-40-kandidaten-im-check/27420082.html
FRANKFURT / MAIN – Kritischer Blick auf die 33 Jahre währende DAX-Karriere: „Dividenden-Kosmetik“ vernebelt eigentliche Wertentwicklung seit 2000 von mageren plus 11 Prozent – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING, 16.7.2021
Ein bisschen ist es mit dem Dax wie mit Bundestrainer Jogi Löw: Beide haben den besten Moment für ihren Abgang verpasst. So wie bei der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren wenig klappte, so hat auch der 33 Jahre alte deutsche Leitindex seine besten Zeiten hinter sich. Viel Old Economy sammelt sich dort, und als es mit Wirecard endlich mal ein junger Techwert in den Dax schaffte, bescherte er dem Auswahlindex die erste Pleite seiner Geschichte.
Dass der Dax immer wieder Rekordstände vermelden kann, liegt an einer ganz eigenen Form der Bilanzkosmetik: Im Unterschied zu den meisten anderen internationalen Börsenindizes werden beim Dax die Dividenden mit in die Wertentwicklung eingerechnet. Der Kursindex des Dax ohne Dividenden liegt heute gerade mal elf Prozent höher als Ende Februar 2000. Inflationsbereinigt haben die 30 wichtigsten deutschen Börsenkonzerne in den letzten 21 Jahren also in Summe keinen Wert gewonnen. So klingen ökonomische Trauerspiele.
Um ein bisschen Schwung ins Team zu bringen, erweitert die Deutsche Börse den Kader um Talente aus der zweiten Reihe. Aus dem Dax 30 wird im September der Dax 40. Sieben Aufsteiger in den Leitindex stehen faktisch schon fest, von Airbus bis Zalando. Für die übrigen drei Plätze kommen sechs weitere Unternehmen in Frage. Werden die Neuzugänge die erhoffte Dynamik in den Index bringen? Und welche Chancen bieten sie für Aktionäre? Das analysiert unsere Finanzmarkt-Reporterin Andrea Cünnen in einem großen Spielercheck.
QUELLE nicht verlinkbar.
FRANKFURT/MAIN – DAX-Ausblick: Privatanleger spekulieren dennoch auf ein neues Rekordhoch – CORONA SPEZIAL / HANDELSBLATT, 12.7.2021
Die vergangene Handelswoche hat gezeigt, dass eine Dax-Sommerkorrektur noch nicht in Sicht ist. Im Gegenteil: Bald könnte es eine neue Bestmarke geben.
An den Aktienmärkten bleibt das Vertrauen in den Post-Corona-Aufschwung groß. Vor allem Privatanleger steigen immer stärker ein und halten den deutschen Aktienindex knapp unter seinem Rekordhoch. In den kommenden Wochen bilanzieren die Unternehmen das zweite Quartal, die Anleger hoffen auf starke Zahlen.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-dax-kann-anfangsgewinne-nicht-halten-privatanleger-spekulieren-dennoch-auf-ein-neues-rekordhoch-/27406880.html
WIEN – Über 50 neue US-Titel im Segment „global market“ – Wiener Börse, 12.7.2021
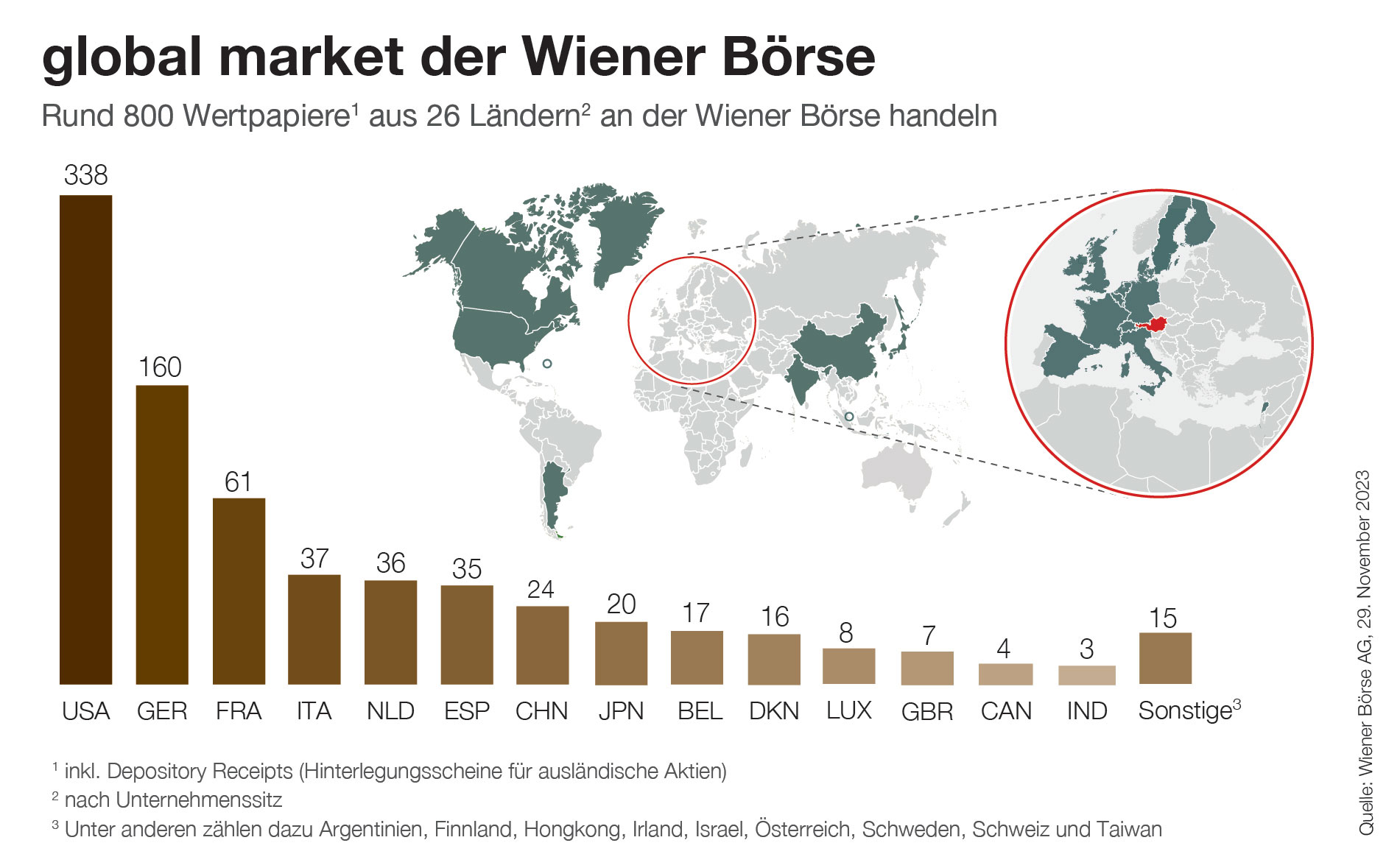
GRAPHIK: https://www.wienerborse.at/uploads/u/cms/images/fotos/presse/infografiken/global-market.jpg
Ab Montag, dem 12.7., sind 52 neue US-Aktien fortlaufend im internationalen Marktsegment der Wiener Börse, dem global market, handelbar. Die neu gelisteten Blue Chips sind geschäftlich in einem breiten Spektrum an Branchen tätig: Dem gesteigerten Interesse an dem Gesundheitssektor wird etwa mit Medtronic Plc (Medizintechnik) oder auch Moderna Inc (Biotech, mRNA-Impfstoff-Entwickler) nachgekommen. MSCI Inc als globaler Indexanbieter oder State Street Corp als Finanzdienstleister und Depotbank, operieren im Finanzbereich. Investitionsmöglichkeiten für Anleger in Bezug auf Lebensmittel bieten Hershey Co, einer der weltweit größten Schokoladenhersteller, Kroger Co, größter Lebensmittelsupermarkt der USA, oder auch Tyson Foods. Weitere klingende Namen sind Unternehmen wie Peloton Interactive Inc (Fitnessgeräte) und Otis Worldwide Corp (weltweit größter Produzent von Aufzugsanlagen).
Auch bei den meistgehandelten Titeln im globalen Segment stechen US-Unternehmen hervor. So war im vergangenen Monat BioNTech SE ADR erstmals Spitzenreiter (17 Mio. EUR), gefolgt von Tesla Inc (13 Mio. EUR) sowie Amazon.com Inc (9 Mio. EUR). Der global market kam im Juni auf durchschnittliche Tagesumsätze von 15,3 Mio. EUR.
Nach einer Ende April stattgefundenen Erweiterung durch asiatische Titel setzt sich also das Wachstum an Anlagemöglichkeiten im international ausgerichteten Segment fort. Nach heutigem Stand umfasst das Angebot rund 800 Wertpapiere aus 27 Ländern. Besonders für heimische Privatanleger ergeben sich Vorteile durch die Heimatbörse, wie etwa die Möglichkeit des Handels von internationalen Wertpapieren zu Inlandskonditionen.
QUELLE (inkl. Links auf eine Liste der Unternehmen): https://r.info.wienerborse.at/mk/mr/wrRvNIT1OzCuiAf5W0W1BWw-3tp3xJbrY9XMZ0-sxtsCRbPzunwjesa0_i3LMr-ZOnE87DN7T-u8z6p0oyR9m7pi-XTxyv4n4R6XFUCqvSb9aQ
SIEHE DAZU:
Liste der Unternehmen (2-Seiten-PDF)
ZENTRALBANKEN
– JAPAN
Japan: Zentralbank legt Klimaprogramm auf – dpa-AFX, 16.7.2021
Die japanische Notenbank folgt anderen großen Zentralbanken und legt ein Programm gegen den Klimawandel auf. Dazu will sie den Banken Kredite zum Nullzins leihen, damit diese das Geld für klimafreundliche Projekte weiterreichen können, wie aus einer Mitteilung der Bank of Japan (BoJ) vom Freitag hervorgeht. Zum anderen will die Notenbank „grüne“ Anleihen mit umweltfreundlichem Charakter kaufen, die in Fremdwährung notiert sind. Ihre sonstige Geldpolitik hat die Zentralbank weitgehend unverändert gelassen.
Das neue Klima-Kreditprogramm soll laut Notenbank noch im laufenden Jahr starten. Es sollen Kredite zum Nullzins mit einer Laufzeit von einem Jahr vergeben werden. Die entsprechenden Projekte sollen klimafreundlichen Charakter aufweisen. Letztlich stellt der Nullzins eine Entlastung für die japanischen Banken dar, die gegenwärtig zumindest teilweise einen negativen Leitzins für kurzfristige Einlagen bei der Notenbank zahlen müssen. Die Notenbank will zugleich die Einlagen ausweiten, die von diesem Negativzins ausgenommen sind.
Darüber hinaus will die Bank of Japan „grüne“ Wertpapiere in Fremdwährung kaufen. Sie betrachtet diesen Schritt als Teil ihres Managements der Währungsreserven, über die sie in erheblichem Ausmaß verfügt. Konkrete Summen, die in derartige Anleihen gesteckt werden sollen, nannte die Zentralbank nicht.
Die Klimaoffensive der Bank of Japan bleibt etwas hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Einige Experten hatten damit gerechnet, dass die Notenbank den Geschäftsbanken etwas stärkere Anreize geben werde, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Eine Erwartung war, dass die Banken für die Finanzierung umweltfreundlicher Projekte eine kleine Zinsgutschrift erhalten. Die Notenbank hebt jedoch hervor, dass ihr die Marktneutralität ihres Ansatz wichtig sei. Möglicherweise hat sie deshalb auf ein entschlosseneres Vorgehen verzichtet.
Ihre sonstige Geldpolitik beließ die Bank of Japan weitgehend unverändert. Der kurzfristige Leitzins beträgt weiterhin minus 0,1 Prozent, der Zielsatz für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt unverändert auf der Nulllinie. Letzteres erreicht die Notenbank, indem sie am Anleihemarkt Staatspapiere kauft. Ziel des Vorgehens ist es, die Finanzierungskosten für die Wirtschaft niedrig zu halten und dadurch die coronageschwächte Konjunktur zu unterstützen.
Ihre Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr (ab April) senkte die Notenbank etwas, für das kommende Fiskaljahr wurde die Prognose hingegen etwas angehoben. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt kurz vor Austragung der Olympischen Sommerspiele belastet.
Die Inflationsprognose wurde für das laufende Jahr von zuvor 0,1 auf 0,6 Prozent erhöht. Für das kommende Jahr wurde sie leicht auf 0,9 Prozent angehoben. Japan weist seit Jahrzehnten eine ungewöhnlich schwache Preisentwicklung mit teils fallenden Lebenshaltungskosten auf. Der Notenbank ist es trotz immensen Einsatzes bisher nicht gelungen, daran etwas grundlegend zu ändern.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53428208-japan-zentralbank-legt-klimaprogramm-auf-016.htm
– EUROPÄISCHE UNION / EZB
Hans Bentzien: EZB startet Projekt für digitalen Euro: Untersuchungsphase dauert zwei Jahre – Bargeld soll auf jeden Fall erhalten bleiben – EZB will Auswirkungen digitalen Euros für Nutzer und Banken prüfen – DJN, 14.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) beginnt mit Untersuchungen zur Schaffung eines digitalen Euro. Die in einer Vorprüfungsphase durchgeführten Analysen und Experimente sowie Meinungen von Fachleuten hätten den EZB-Rat veranlasst „einen Gang höher zu schalten und das Projekt eines digitalen Euro zu starten“, heißt es in einer Erklärung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Mit unserer Arbeit wollen wir sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld, haben“, fügte sie hinzu.
Die Untersuchungsphase wird laut EZB 24 Monate dauern und zielt darauf ab, Schlüsselfragen der Gestaltung und Verteilung zu klären. Ein digitaler Euro müsse in der Lage sein, die Bedürfnisse der Europäer zu erfüllen und gleichzeitig dazu beitragen, illegale Aktivitäten zu verhindern und unerwünschte Auswirkungen für die Finanzstabilität und die Geldpolitik zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung weiter.
*** Bargeld soll auf jeden Fall erhalten bleiben ***
Zugleich stellte die EZB klar: „Dies greift einer künftigen Entscheidung über die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro nicht vor, die erst später erfolgen wird. In jedem Fall würde ein digitaler Euro das Bargeld ergänzen, nicht ersetzen.“
Während der Untersuchungsphase wird sich das Eurosystem auf das mögliche funktionale Design eines digitalen Euro konzentrieren, das sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren soll. Es sollen die Anwendungsfälle untersucht werden, die ein digitaler Euro vorrangig bieten sollte, um seine Ziele zu erreichen: eine risikolose, zugängliche und effiziente Form von digitalem Zentralbankgeld.
Geprüft werden soll zudem, welche Änderungen des EU-Rechtsrahmens erforderlich sein könnten, die mit den europäischen Mitgesetzgebern diskutiert und von diesen beschlossen werden müssten. Die EZB will während der Untersuchungsphase mit dem Europäischen Parlament und anderen europäischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten. Auch die technische Arbeit am digitalen Euro mit der Europäischen Kommission soll intensiviert werden.
*** EZB will Auswirkungen digitalen Euros für Nutzer und Banken prüfen ***
Schließlich werden in der Untersuchungsphase die möglichen Auswirkungen eines digitalen Euro für den Markt bewertet, und die Gestaltungsoptionen zur Gewährleistung des Datenschutzes und zur Vermeidung von Risiken für die Bürger des Euroraums, für Intermediäre und die Gesamtwirtschaft werden identifiziert. Zudem soll ein Geschäftsmodell für Intermediäre innerhalb des digitalen Euro-Ökosystems definiert werden.
Eine Beratergruppe soll während der Untersuchungsphase dafür sorgen, dass die Ansichten der potenziellen Nutzer und Händler zu einem digitalen Euro berücksichtigt werden. Diese Ansichten sollen auch im Euro-Retail Payments Board diskutiert werden.
Die EZB weist auf Experimente hin, die sie in den vergangenen neun Monaten durchgeführt hat und die Nutzung der Distributed Ledger Technology, den Schutz der Privatsphäre, die Verhinderung von Geldwäsche, den Zugang für Endnutzer ohne Internetverbindung, sowie die Begrenzung des Umlaufs digitaler Euros betrafen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53408347-ezb-startet-projekt-fuer-digitalen-euro-015.htm
EZB läutet zweijährige Untersuchungsphase für digitalen Euro ein – dpa-AFX, 14.7.2021
Europas Währungshüter machen den nächsten Schritt auf dem Weg zur möglichen Einführung eines digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss am Mittwoch, in eine zweijährige Untersuchungsphase für eine solche Digitalwährung einzutreten, in der es um Aspekte wie Technologie und Datenschutz gehen soll. „Dies greift einer künftigen Entscheidung über die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro nicht vor, die erst später erfolgen wird“, bekräftigte die Notenbank in Frankfurt. „In jedem Fall würde ein digitaler Euro das Bargeld ergänzen, nicht ersetzen.“
Eine digitale Version der europäischen Gemeinschaftswährung könnte es Privatleuten erlauben, Geld direkt bei der Zentralbank zu hinterlegen. Diese Möglichkeit steht normalerweise nur gewerblichen Kreditgebern wie Banken, Regierungen und anderen Zentralbanken offen. Die Bemühungen der Euro-Notenbanken sind eine Antwort auf den steilen Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Der große Unterschied: Im Gegensatz dazu stünde ein digitaler Euro unter Aufsicht einer Zentralbank, die die Stabilität der Währung sichert.
Die EZB hatte Anfang Oktober bekanntgemacht, dass sie ihre Arbeiten an einem digitalen Euro vorantreibt. Bürger wie Fachleute aus Wissenschaft und Finanzsektor konnten sich zum Für und Wider äußern. Nun sei es an der Zeit „einen Gang höher zu schalten und das Projekt des digitalen Euro zu starten“, erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Mit unserer Arbeit wollen wir sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld, haben.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53407976-ezb-laeutet-zweijaehrige-untersuchungsphase-fuer-digitalen-euro-ein-016.htm
EZB macht Weg frei für weitere Arbeiten am digitalen Euro: zweijährige Untersuchungsphase am Anfang – Digital-Euro noch keine beschlossene Sache – Digital-Euro als Ergänzung: Bargeld soll jedenfalls erhalten bleiben – Reaktionen aus Poltik und Wirtschaft – dpa-AFX, 14.7.2021
Europas Währungshüter heben ihre mehrjährigen Arbeiten an einem digitalen Euro auf die nächste Stufe: Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss am Mittwoch, in eine 24 Monate dauernde Untersuchungsphase für eine solche Digitalwährung einzutreten, in der es um Aspekte wie Technologie und Datenschutz gehen soll.
Ob eine digitale Version der europäischen Gemeinschaftswährung ergänzend zu Schein und Münze kommen wird, ist damit aber noch nicht entschieden. „Wir werden (…) erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob ein digitaler Euro eingeführt wird oder nicht“, erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta. „In jedem Fall würde ein digitaler Euro das Bargeld nur ergänzen und nicht ersetzen.“
Bis zur möglichen Einführung eines digitalen Euro wird es somit noch dauern, wie Panetta bekräftigte: Nach Ablauf der zweijährigen Untersuchungsphase wolle die EZB bereit sein, mit der Entwicklung eines digitalen Euro zu beginnen. „Dies könnte rund drei Jahre dauern.“ Panetta hatte bereits im Mai gesagt, frühestens im Jahr 2026 sei mit der Einführung eines digitalen Euro zu rechnen.
Ein digitaler Euro könnte es Privatleuten erlauben, Geld direkt bei der Zentralbank zu hinterlegen. Diese Möglichkeit steht normalerweise nur gewerblichen Kreditgebern wie Banken, Regierungen und anderen Zentralbanken offen. Theoretisch denkbar wäre, dass Bürger ein Konto bei der EZB eröffnen. Das schließt die EZB aber im Grunde schon im jetzigen Stadium aus. Für wahrscheinlicher halten es Experten, dass elektronische Geldbörsen, sogenannte Wallets, von Geschäftsbanken oder anderen Finanzdienstleistern in Verbindung mit einem herkömmlichen Konto angeboten würden.
„Ein digitaler Euro wird nicht wie Paypal sein“, betonte Panetta in einer Fragerunde mit Journalisten mit Blick auf den auch in Europa sehr erfolgreichen US-Bezahldienst Paypal. „Wir werden keine Dienstleistung anbieten, sondern ein Zahlungsmittel.“
Diskutiert wird, ob es für Verbraucher eine Obergrenze für die Nutzung eines digitalen Euro von beispielsweise 3000 Euro geben soll. „Ohne Haltelimit könnten Guthaben sehr schnell von Bankkonten abgezogen und in sicheres Zentralbankgeld getauscht werden – so genannte Bank Runs würden wahrscheinlicher“, warnte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt des Fondsanbieters Union Investment. Die EZB hat auch in dieser Frage noch nicht entschieden. Die Notenbank lässt sich technisch und vom Konzept her bei der Ausgestaltung eines digitalen Euro weitgehend alle Möglichkeiten offen.
*** Reaktionen aus Poltik und Wirtschaft ***
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nannte die Weichenstellung der EZB „wegweisend“: „Wir müssen den Euro fit machen für das digitale Zeitalter, nur so können wir unsere währungspolitische Souveränität erhalten und stärken. Bei den weiteren Arbeiten müssten die Mitgliedstaaten eingebunden werden.“
Befeuert werden die Anstrengungen der Euro-Notenbanken von der zunehmenden Nutzung digitaler Bezahlmöglichkeiten. Schon vor der Corona-Krise hatte sich der Trend zum Bezahlen ohne Scheine und Münzen in Deutschland und im Euroraum verstetigt. Zudem will die EZB eine Antwort geben auf den steilen Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Der große Unterschied: Im Gegensatz dazu stünde ein digitaler Euro unter Aufsicht einer Zentralbank, die die Stabilität der Währung sichert.
„Private Lösungen für digitale und Online-Zahlungen bieten wichtige Vorteile wie Komfort Geschwindigkeit und Effizienz. Sie sind jedoch auch mit Risiken verbunden, was Datenschutz, Sicherheit und Zugänglichkeit betrifft“, erklärte Panetta. Auch andere Notenbanken weltweit beschäftigen sich mit digitalem Zentralbankgeld. China beispielsweise ist nach eigenen Angaben schon deutlich weiter als das Eurosystem.
Die EZB hatte Anfang Oktober bekanntgemacht, dass sie ihre Arbeiten an einem digitalen Euro vorantreibt. Bürger wie Fachleute aus Wissenschaft und Finanzsektor konnten sich zum Für und Wider äußern. Nun sei es an der Zeit „einen Gang höher zu schalten und das Projekt des digitalen Euro zu starten“, teilte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Entscheidung des EZB-Rates vom Mittwoch mit. „Mit unserer Arbeit wollen wir sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld, haben.“
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) als Dachverband der fünf großen Bankenverbände in Deutschland hatte kürzlich in einem Grundsatzpapier ihre Vorstellungen für einen digitalen Euro festgehalten. Demnach soll das Digitalgeld drei wesentliche Ausgestaltungen haben: ein digitaler Euro für den Alltagsgebrauch der Bürger als Ergänzung zum Bargeld, eine spezielle Form für die Kapitalmärkte und den Interbankenverkehr sowie sogenannte Giralgeldtoken für den Einsatz in der Industrie.
„Ein digitaler Euro ist wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit Europas und seiner Unternehmen in einer immer stärker digitalisierten Geschäftswelt“, befand am Mittwoch Joachim Schmalzl, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), der derzeit DK-Federführer ist. Wichtig sei jedoch, dass die EZB alle drei von der Kreditwirtschaft genannten Möglichkeiten einbeziehe.
Der Digitalverband Bitkom berichtete anhand einer Umfrage unter 652 Unternehmen in Deutschland von großer Zustimmung für einen digitalen Euro: Gut drei Viertel (78 Prozent) der befragten Unternehmen ab 50 Beschäftigten wollten, dass die EZB einen digitalen Euro einführe. Nur jedes Fünfte (20 Prozent) halte nichts von solchen Plänen. Die Befürworter versprechen sich demnach eine neue technische Möglichkeit zur nahtlosen Abwicklung von Zahlungsvorgängen.
Technisch können digitale Währungen zum Beispiel auf Basis einer sogenannten Blockchain funktionieren, also über eine Kette von Datenblöcken, die sich mit jeder Transaktion ausbaut. Nach Einschätzung des Fondsverbandes BVI könnten Marktteilnehmer Finanztransaktionen „schneller und sicherer durchführen, wenn sowohl Finanzinstrumente als auch der Euro blockchainfähig werden“.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53410192-ezb-macht-weg-frei-fuer-weitere-arbeiten-am-digitalen-euro-016.htm
EZB treibt digitalen Euro voran – Die Währungshüter der EZB fassen einen wichtigen Beschluss, sie wollen die Entwicklung einer digitalen Version des Euros vorantreiben – Finanz & Wirtschaft/Reuters, 14.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine wichtige Weiche für die mögliche Einführung eines digitalen Euro gestellt. Die Währungshüter beschlossen, die Entwicklung einer digitalen Version der Gemeinschaftswährung zu starten, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Diese Untersuchungsphase soll nun 24 Monate dauern. Dabei sollen Kernfragen wie die Ausgestaltung und die Verteilung eines digitalen Euro geklärt werden. Bislang hatte es bei der EZB dazu lediglich Vorarbeiten gegeben. Die Untersuchungsphase werde die Entscheidung zur Einführung eines digitalen Euro nicht vorwegnehmen, erklärte die EZB. Diese Entscheidung werde später gefällt werden.
Rund um den Globus prüfen derzeit Notenbanken die Einführung digitaler Versionen ihrer Währungen, um ihren Zahlungsverkehr zu modernisieren. Dabei spielt auch die drohende Konkurrenz durch Cyberwährungen internationaler Technologiekonzerne, wie etwa die geplante Kryptodevise Diem von Facebook (FB 344.46 -0.91%), eine wichtige Rolle.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/ezb-treibt-digitalen-euro-voran/
Hans Bentzien: Panetta: Noch keine Entscheidung für digitalen Euro gefallen – DJN, 14.7.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta noch keine grundsätzliche Entscheidung zur Emission eines digitalen Euro getroffen. Der Rat habe den offiziellen Start eines Projekts beschlossen, mit dem die mögliche Einführung eines digitalen Euro vorbereitet werde, schreibt Panetta in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Beitrag.
„Konkret bedeutet das, dass wir die erforderlichen Ressourcen bereitstellen, um ein marktfähiges Produkt zu entwerfen“, so Panetta. Die EZB werde jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob ein digitaler Euro eingeführt werde oder nicht. „In jedem Fall würde ein digitaler Euro das Bargeld nur ergänzen und nicht ersetzen“, versicherte der EZB-Direktor.
Laut Panetta hat die EZB in den vergangenen Wochen praktische Tests durchgeführt, deren Ergebnisse die nationalen Zentralbanken in den nächsten Wochen veröffentlichen würden. Die jetzt beginnende zweijährige Untersuchungsphase umfasst laut Panetta die Bildung von Fokusgruppen, den Austausch mit Finanzintermediären, die Erstellung von Prototypen und konzeptionelle Arbeit.
„Nach Ablauf dieser zwei Jahre möchten wir bereit sein, mit der Entwicklung eines digitalen Euro zu beginnen. Dies könnte rund drei Jahre dauern“, schreibt der EZB-Direktor.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53408799-panetta-noch-keine-entscheidung-fuer-digitalen-euro-gefallen-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche Kreditwirtschaft fordert tokenisierten digitalen Euro – DJN, 14.7.2021
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) begrüßt, ein Projekt zur Vorbereitung eines digitalen Euros zu starten. Zugleich bezeichnete sie die Pläne der EZB aber als unzureichend. „Es braucht zusätzlich sowohl tokenisiertes Giralgeld als auch tokenisiertes Zentralbankguthaben, um unsere Volkswirtschaft sicher in die Zukunft zu begleiten“, heißt es in einer Stellungnahme. Die EZB müsse alle drei heutigen Geldarten in das Projekt einbeziehen.
Ein digitaler Euro sollte nach Ansicht der Kreditwirtschaft für Verbraucher wie eine digitale Banknote funktionieren. Wie Bargeld sollte er weder verzinst noch programmierbar sein. Auch sollte ein digitaler Euro ohne Verbindung zum Internet funktionieren. Der digitale Euro sollte den Europäern nach Vorstellung des Verbands durch Kreditinstitute über elektronische Portemonnaies, sogenannte „CBDC-Wallets“, zur Verfügung gestellt werden.
Dabei sollte die Menge an digitalen Euro durch eine Obergrenze pro Wallet limitiert werden, die sich beispielsweise am typischen Zahlungsbedarf orientieren könnte. Nicht zuletzt muss die EZB in ihrem Projekt die Anonymität des digitalen Euro betrachten, die Verbraucher am Bargeld sehr schätzen“, fordert die Kreditwirtschaft.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53408505-deutsche-kreditwirtschaft-fordert-tokenisierten-digitalen-euro-015.htm
Andreas Neinhaus: Augen auf die Inflationserwartungen: langfristige Inflationserwartungen liegen deutlich unter neuem Inflationziel der EZB – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 12.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/daiwa-new-ecb-inflation-target-and-5y5y-swap-rate-640×390.png
Die Strategierevision der Europäischen Zentralbank gibt weiter zu reden. Früher als erwartet hat sie vergangene Woche beschlossen, dass das Inflationsziel künftig höher liegen wird. Bisher galt «nahe, aber unter 2%» als Richtwert. Fortan sind es 2%. De facto steigt das Zielniveau damit um etwa 0,2 Prozentpunkte.
Aktuell macht das keinen Unterschied. Denn die langfristigen Inflationserwartungen liegen deutlich darunter. Der Chart zeigt das anhand der fünfjährigen Forward-Swapsätze in fünf Jahren. Sie sind ein viel beachtetes Mass für die zehnjährigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer. Auch die EZB zieht sie in ihrer Analyse zurate.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2094/
Hans Bentzien: EZB/Lagarde – Präzisierung: Im aktuellen Umfeld ist Hartnäckigkeit gefragt – DJN, 13.7.2021
Die neue Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht an der effektiven Zinsuntergrenze eine besonders „kraftvolle oder hartnäckige“ Reaktion der Zentralbank vor. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nun im Interview mit der Financial Times klargestellt, dass im aktuellen Umfeld vor allem Hartnäckigkeit gefragt sei.
„Es geht darum, hartnäckig zu sein“, sagte sie. Es gehe darum, die nächsten Projektionen sehr aufmerksam zu verfolgen und zu sehen, wie sich Gesamtinflation und Kerninflation und andere Indikatoren von Inflation und Inflationserwartungen entwickeln, um zu sehen, „dass die Hartnäckigkeit, die wir gezeigt haben“ tatsächlich etwas bewege. Besonders „kraftvoll“ müsse die EZB im Falle eines negativen Schocks agieren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53393634-ezb-lagarde-im-aktuellen-umfeld-ist-hartnaeckigkeit-gefragt-015.htm
Hans Bentzien: Lagarde zum neuen Inflationsziel: Neue Strategie macht EZB flexibler – „Hartnäckige“ Geldpolitik: Verfrühte geldpolitische Straffung ausgeschlossen – DJN, 13.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) erhält nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde durch ihre neue Strategie mehr Flexibilität. In einem Interview mit der Financial Times verneinte sie jedoch die Frage, ob die EZB nun noch lockerer („akkommodierender“) werde. „Ich denke, die neue Strategie gibt uns die Möglichkeit, um die Marke von 2 Prozent Inflation herum flexibel zu sein, weil wir anerkennen, dass 2 Prozent keine Obergrenze sind und weil wir anerkennen, dass es Schwankungen um 2 Prozent herum geben wird“, sagte Lagarde.
Laut Lagarde erhält die EZB außerdem mehr Flexibilität dadurch, dass sie den Effekt der effektiven Zinsuntergrenze und die Einschränkungen, die sie ihr auferlegt, anerkennt. Das ermögliche eine besonders „kraftvolle oder hartnäckige Reaktion“, die vorübergehend zu einer moderaten Abweichung über das Ziel hinaus führen könne. „In diesem Sinne ist es also flexibler“, sagte Lagarde. Das bedeute auch, dass die EZB ihre Geldpolitik nicht verfrüht straffen werde.
„Aber das wird in der Forward Guidance, die wir in Kürze überarbeiten werden, um sie mit der Strategieüberprüfung in Einklang zu bringen, noch ein wenig geklärt werden müssen“, fügte sie hinzu. Aber die Verwendung des Begriffs „hartnäckig“ sei ein Hinweis darauf, dass es nicht zu einer verfrühten geldpolitischen Straffung kommen könne, wie das in der Vergangenheit geschehen sei.
Die Bereitschaft des EZB-Rats hierzu werde von nun alle sechs Wochen geprüft werden, sagte Lagarde und fügte hinzu: „Ich mache mir keine Illusionen, dass wir alle sechs Wochen einhellige Zustimmung und universelle Akzeptanz haben werden, denn es wird einige Variationen geben, einige leicht unterschiedliche Positionierungen. Und das ist in Ordnung.“
Die EZB-Chefin machte außerdem klar, dass die Erwähnung von Finanzstabilität als Voraussetzung von Preisstabilität in der neuen Strategie ein Bekenntnis zu Marktinterventionen der EZB ist. „Das haben wir in der Vergangenheit bewiesen – wir haben sicherlich gegen die Gefahr einer Fragmentierung gekämpft, einfach weil wir wollen, dass unsere Geldpolitik im gesamten Euroraum richtig übertragen wird“, sagte sie. Wenn das wieder passieren sollte, würde die EZB sicherlich die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Übertragung ihrer Geldpolitik abzusichern. „Um es mit den Worten eines meiner Vorgänger zu sagen: Der Euro ist unumstößlich, und die Geldpolitik muss in alle Ecken des Euroraums durchdringen.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53393147-lagarde-neue-strategie-macht-ezb-flexibler-015.htm
Hans Bentzien: Lagarde: EZB wird Forward Guidance ändern – Notwendige Hartnäckigkeit bei Umsetzung der EZB-Verpflichtungen an Zinsuntergrenze: Zins für Überschusseinlagen von Banken auf minus 0,5 Prozent gesenkt – Inflationsziel auf glatt zwei Prozent mit der Option des Überschießens: PEPP mindestens bis März 2022 – Künftige Wirtschaftsentwicklung: Lagarde wegen Delta-Variante vorsichtig – TV – DJN, 12.7.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird bei seinen Beratungen am 22. Juli nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde seine Forward Guidance der veränderten geldpolitischen Strategie anpassen. „Angesichts der Hartnäckigkeit, die wir zeigen müssen, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, wird die Forward Guidance sicher überprüft werden“, sagt Lagarde zu Bloomberg TV.
Die EZB hat ihren Zins für Überschusseinlagen von Banken auf minus 0,50 Prozent gesenkt und fasst zumindest derzeit keine weiteren Senkungen ins Auge. Die Nähe zur effektiven Zinsuntergrenze erfordert laut der neuen Strategie besonders „kraftvolle oder hartnäckige“ geldpolitische Maßnahmen. Dabei würde auch ein leichtes Überschießen der Inflation toleriert werden.
Die aktuelle Forward Guidance zu den Zinsen besagt, dass Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis der Rat feststellt, dass sich die Inflationsaussichten deutlich einem Niveau annähern, das hinreichend nahe, aber unter 2 Prozent liegt, und dass sich diese Annäherung in der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation widerspiegelt.
Da sich das Inflationsziel auf glatt zwei Prozent mit der Option des Überschießens geändert hat, ist hier zumindest eine sprachliche Anpassung zu erwarten. Die Forward Guidance zum APP-Anleihekaufprogramm stellt eine monatliche Erhöhung der Anleihebestände um 20 Milliarden Euro bis kurz vor der ersten Zinserhöhung in Aussicht, die nun in noch etwas weitere Ferne gerückt sein könnte. Die Forward Guidance des Pandemiekaufprogramms PEPP besagt, dass zu seiner Beendigung der EZB-Rat der Ansicht sein muss, dass die Corona-Krise vorbei ist.
Lagarde sagte in dem Interview, es werden „einige interessante Variationen und Veränderungen“ geben. Das PEPP könnte laut Lagarde mindestens bis Ende März 2022 laufen. Darauf könnte der „Übergang in ein neues Format folgen“. Sie sei wegen der Delta-Variante des Corona-Virus nur vorsichtig optimistisch hinsichtlich der Erholung der Wirtschaft. „Wir müssen sehr flexibel sein und dürfen nicht die Erwartung wecken, dass der Exit in den nächsten Wochen oder Monaten stattfinden wird“, sagte sie.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53381282-lagarde-ezb-wird-forward-guidance-aendern-tv-015.htm
EZB-Präsidentin Lagarde deutet Änderungen an – Geldpolitische Anpassungen unter Berücksichtigung von Klimaaspekten und Kosten für selbstgenutzten Wohnungseigentums – PEPP nach Auslaufen in allgemeine Wertpapierkäufe eingliedern – dpa-AFX, 12.7.2021
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat für die nächste Zinssitzung in etwa eineinhalb Wochen einige Änderungen angedeutet. Für die Sitzung am 22. Juli seien interessante Abwandlungen und Veränderungen zu erwarten, sagte sie dem Fernsehsender Bloomberg TV am Rande des G20-Gipfels am Sonntag. „Es wird ein wichtiges Treffen.“
In der vergangenen Woche hatte die Notenbank ihre geldpolitische Strategie angepasst. Neben einem neuen Inflationsziel wurde beschlossen, Klimaaspekte stärker in der Geldpolitik zu berücksichtigen und die Kosten des selbstgenutzten Wohneigentums perspektivisch in die Inflationsrate einfließen zu lassen. Zudem will die EZB ihre Kommunikation vereinfachen. Letzteres könnte sich in der Erklärung zum Zinsentscheid niederschlagen.
Das Corona-Krisenprogramm Pepp, mit dem die EZB vor allem Staatsanleihen der Euroländer erwirbt, soll laut Lagarde wie geplant bis „mindestens“ März 2022 fortgeführt werden. Danach könnte es in ein neues Format überführt werden, sagte die Französin, ohne dies näher zu erläutern. Einige Notenbanker haben bereits vorgeschlagen, Teile oder Aspekte des 1,85 Billionen Euro umfassenden Programms nach dessen Auslaufen in die allgemeinen Wertpapierkäufe (APP) der Notenbank zu überführen.
Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage zeigte sich Lagarde moderat optimistisch. Bedenken löse bei ihr die rasche Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus aus. „Wir müssen sehr flexibel sein und dürfen nicht die Erwartung wecken, dass der Ausstieg in den nächsten Wochen oder Monaten erfolgt“, sagte sie mit Blick auf die nicht erst seit der Corona-Pandemie extrem lockere Geldpolitik der Notenbank.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53381017-ezb-praesidentin-lagarde-deutet-aenderungen-an-016.htm
Hans Bentzien: De Guindos: Entscheiden bald über Übergang von PEPP auf andere Programme – PEPP-Überführung in ein neues Format: weitreichende geldpolitische Beschlüsse bereits am 22. Juli? – DJN, 12.7.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bald darüber beraten, wie er ohne das temporäre Pandemiekaufprogramm PEPP für ausreichend geldpolitische Unterstützung sorgen will. „Wir haben den Übergang vom PEPP zu anderen Programmen nicht diskutiert, darüber wird der EZB-Rat in naher Zukunft beschließen“, sagte de Guindos in einem Gespräch mit dem Chairman des Think Tanks Omfif, David Marsh. Der EZB-Rat kommt am 22. Juli zu den nächsten geldpolitischen Beratungen zusammen, um seine konkrete Geldpolitik der in der vergangenen Woche beschlossenen neuen Strategie anzupassen.
Der EZB-Vizepräsident nährte mit seiner Aussage die Erwartung, dass es bereits in der kommenden Woche zu weitreichenden geldpolitischen Beschlüssen kommen könnte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in einem in der Nacht gesendeten Interview mit Bloomberg TV gesagt, dass die Sitzung am 22. Juli ein wichtiges werde. Das PEPP könnte laut Lagarde mindestens bis Ende März 2022 laufen. Darauf könnte der „Übergang in ein neues Format folgen“.
„Wir werden uns die Rahmenbedingungen ansehen, wir werden uns ansehen, welche Forward Guidance wir überdenken müssen, wir werden uns die Kalibrierung aller Instrumente ansehen, die wir einsetzen, um sicherzustellen, dass sie mit unserer neuen Strategie übereinstimmen“, sagte sie. Details nannte sie nicht.
De Guindos wies darauf hin, dass das PEPP ein zeitlich begrenztes Programm und an die Pandemie und deren ökonomische Konsequenzen gebunden sei. Er fügte hinzu: „Ich betone, dass es eine akkommodierende Geldpolitik geben wird.“ Die EZB operiere an der effektiven Zinsuntergrenze, sie könne daher „kraftvoll“ handeln. Der EZB-Vizepräsident bezog sich dabei auf einen Passus in der in der vergangenen Woche beschlossenen Strategie, derzufolge „kraftvolle oder hartnäckige“ geldpolitische Maßnahmen notwendig seien, wenn die EZB an der Zinsuntergrenze operiere.
Lagarde hatte in dem Interview den anderen Aspekt dieses Strategieelements angesprochen, als sie sagte: „Angesichts der Hartnäckigkeit, die wir zeigen müssen, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, wird die Forward Guidance sicher überprüft werden.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53384581-de-guindos-entscheiden-bald-ueber-uebergang-von-pepp-auf-andere-programme-015.htm
Kreise: Streit im EZB-Rat über Entwurf für die nächste Sitzung am 22. Juli – dpa-AFX, 16.7.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank ist sich offenbar uneins wie sich die jüngsten Änderungen der geldpolitischen Strategie sich auf die Kommunikation auswirken. Streit gebe es unter den Ratsmitgliedern über einen Entwurf für das Treffen am 22. Juli, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag von Personen die mit dem Thema vertraut sind. Dann könnte die EZB ihre Leitlinien (Guidance) zu den wichtigsten Instrumenten einschließlich der Zinssätze an die geänderte geldpolitische Strategie anpassen.
Die EZB hatte in der vergangenen Woche die Änderungen beschlossen. So strebt die Notenbank jetzt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Bisher hat sie eine Rate von unter, aber nahe bei zwei Prozent, als ihr Ziel ausgegeben. Zudem soll ein gewisses Überschießen der Inflation hingenommen werden.
Die Änderung der Strategie war einstimmig angenommen worden. Laut dem Bericht gibt es aber wohl Streit, wie sich die neue Strategie auf die konkrete Geldpolitik auswirken soll. Laut dem Bloomberg-Bericht werden die Diskussionen intensiver und hitziger.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am vergangenen Sonntag Änderungen bei der Kommunikation in Aussicht gestellt. „Es wird ein wichtiges Treffen“, sagte sie. Laut Ökonomen könnte die EZB ihr Versprechen verschärfen, wie lange sie mit den extrem niedrigen Zinssätzen und Anleihekäufen die Inflation stützen will.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53434335-kreise-streit-im-ezb-rat-ueber-entwurf-fuer-die-naechste-sitzung-016.htm
Hans Bentzien: EZB/Kazimir: Lassen zu niedrige Inflation nicht mehr zu – 2 Prozent als klares und einfaches Inflationsziel – DJN, 12.7.2021
Die neue Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage des slowakischen Ratsmitglieds Peter Kazimir darauf gerichtet, eine zu niedrige Inflation nicht mehr zuzulassen. „Die niedrige Inflation hat sich in den letzten Jahren verfestigt, und unsere überarbeitete Strategie besagt, dass wir dies in Zukunft nicht zulassen werden“, schrieb Kazimir im Kurznachrichtendienst Twitter. Das bedeute auch, dass die EZB künftig Inflationsraten zulassen werde, die moderat und vorübergehend über 2 Prozent lägen, fügte er hinzu.
Die EZB hatte ihr Inflationsziel in der vergangenen Woche von „unter, aber nahe“ auf glatt 2 Prozent geändert. „Dieses Politikziel ist klar und einfach“, schrieb Kazimir. Diese Klarheit werde das Instrumentarium der EZB stärken und bei der Verankerung der Inflationserwartungen und insgesamt beim Erreichen des Preisstabilitätsmandats helfen.
Teil der neuen Stratege ist auch ein besonders entschlossenes Handeln der Zentralbank an der Zinsuntergrenze. Das bedeutet, dass die EZB, wenn sie in der Nähe dieser Grenze operiert, eine besonders „kraftvolle oder hartnäckige“ Politik betreiben soll. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte am Vormittag, gegenwärtig arbeite die EZB unter solchen Bedingungen. Der EZB-Rat berät in der nächsten Woche über die unmittelbaren Auswirkungen der Strategiereform für die konkrete Geldpolitik.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53386925-ezb-kazimir-lassen-zu-niedrige-inflation-nicht-mehr-zu-015.htm
Hans Bentzien: Schnabel: EZB kann langsamer auf besseren Inflationsausblick reagieren – DJN, 14.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel wegen der Nähe zur effektiven Zinsuntergrenze langsamer als bisher auf einen sich bessernden Inflationsausblick reagieren. Die EZB habe klargestellt, dass eine besonders kraftvolle oder hartnäckige Reaktion der EZB zu Phasen führen könne, in denen die Inflation die Marke von 2 Prozent vorübergehend und moderat übersteige, sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext bei einer Konferenz des Peterson Institute for International Economics.
„In der Praxis können Überschreitungen der Inflationsrate darauf zurückzuführen sein, dass der EZB-Rat angesichts der sich verbessernden Aussichten Geduld bei der Anpassung seines geldpolitischen Kurses walten lässt“, erläuterte Schnabel.
Eine „lange Phase niedrigen Preisdrucks und jahrelange wiederholte Überprognosen des künftigen Inflationspfads“ erfordern laut Schnabel, dass sich höhere Inflationsaussichten sichtbar in der tatsächlichen zugrunde liegenden Inflationsdynamik niederschlagen müssen, bevor die EZB eine grundlegendere Neubewertung der mittelfristigen Inflationsaussichten vornehme.
EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hatte in seinem Kommentar zur EZB-Strategiereform gesagt: „Wir machen unsere Geldpolitik nicht von Zielverfehlungen in der Vergangenheit abhängig. Unsere Strategie bleibt nach vorne gerichtet und berücksichtigt die neue Herausforderung der effektiven Zinsuntergrenze.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53409645-schnabel-ezb-kann-langsamer-auf-besseren-inflationsausblick-reagieren-015.htm
EZB-Aufseherin will bei Banken-Dividenden weiter Vorsicht sehen – Auslaufen des Dividenden-Stopps bereits im September möglich – Bei außergewöhnlichen Umständen sind höhere Kapitalpuffer der Banken einzufordern – dpa-AFX, 12.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) pocht trotz des wohl bald auslaufenden Dividendenstopps auf maßvolle Ausschüttungen der Banken im Euroraum. Die EZB werde als Aufseherin die Institute aufrufen, weiter „vorsichtig“ zu sein, sagte die spanische EZB-Aufseherin Margarita Delgado in einem am Montagabend veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg in Madrid. Die Zentralbank könne auch die dazu nötigen Schritte ergreifen. Ausufernde Ausschüttungen könnten zunächst die Empfehlung der EZB nach sich ziehen, zu einer eher durchschnittlichen Verteilungspolitik zurückzukehren, sagte Delgado. „Wir haben andere Werkzeuge, falls die Bank der Empfehlung der Aufsicht nicht nachkommt.“
In der Corona-Krise hatte die EZB den größten Banken im Euroraum einen Dividendenstopp auferlegt, um eine mögliche Schieflage der Bilanzen in der Konjunkturkrise nicht durch zu hohe Geldabflüsse zu verschärfen. Der Stopp könnte laut EZB-Chefin Christine Lagarde im September auslaufen. Die Warnung der spanischen Vertreterin im EZB-Aufsichtsgremium dürfte nun die Hoffnung der Anleger auf allzu stark sprudelnde Ausschüttungen dämpfen.
In außergewöhnlichen Umständen und begleitet von „konstruktivem Dialog“ könnten die Aufseher von den Banken höhere Kapitalpuffer verlangen oder andere finanzielle Maßnahmen anwenden, sagte Delgado. Zusätzlich zur finanziellen Stärke würden Ausschüttungspläne mit denen anderer Banken einer ähnlichen Größe oder einem ähnlichen Geschäftsmodell verglichen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53393404-destatis-deutsche-inflation-im-zweiten-halbjahr-mit-kraeftigem-schub-015.htm
Hans Bentzien: Ökonomen schlagen fünf Kategorien für Zentralbankaktivitäten vor – DJN, 13.7.2021
Zentralbanken haben ihre Aktivitäten in den vergangenen Jahren deutlich über die Geldpolitik im engeren Sinne hinaus ausgeweitet. Zwei renommierte Wissenschaftler schlagen fünf Kategorien für diese Aktivitäten vor und fordern die Gesetzgeber dazu auf, Regeln für die Regimes festzulegen.
„Ihre rechtlichen Befugnisse mögen klar sein, aber ausgenommen die Geldpolitik, wie sie traditionell verstanden wird, sehen wir keine Regelungen, die Zwecke, Ziele und Beschränkungen klar darlegen“, schreiben Stephen Cecchetti (Brandeis International Business School) und Paul Tucker (Chef des britischen Systemic Risk Council) in einem Aufsatz. Dies führe dazu, dass die Öffentlichkeit nicht überprüfen könne, was ihre Zentralbanken tun.
Folgende Kategorien schlagen Cecchetti und Tucker vor:
1) Geldpolitik: Stimulierung oder Dämpfung der Gesamtnachfrage, um Preisstabilität bei voller Nutzung der produktiven Ressourcen der Wirtschaft zu erreichen
Zentralbanken nutzen ihre Bilanzen, um die Menge oder den Preis ihres Geldes festzulegen, um ihre Preisstabilitätsziele zu erreichen. In den vergangenen Jahren, als die Leitzinsen an der effektiven Untergrenze lagen, verlagerte sich ihr Hauptinstrument von den Preisen (kurzfristiger Zins) zu den Mengen.
Durch den Ankauf von Wertpapieren versuchen die Zentralbanken, die langfristigen Zinssätze zu senken und verschiedene Risikoprämien zu senken, wodurch die finanziellen Bedingungen gelockert wurden, um die gesamtwirtschaftliche Aktivität und die Inflation zu erhöhen. Wie gut diese quantitative Lockerung (QE) funktioniert, ist umstritten. Sie entspricht aber dem traditionellen Verständnis von Geldpolitik.
2) Lender of last resort: Kreditvergabe an grundsätzlich solvente Unternehmen oder andere kollektive Vehikel, die einen Liquiditätsbedarf haben, der nicht über private Märkte gedeckt werden kann
Da die Zentralbank unbegrenzt Geld ausgeben kann, ist sie die einzige Institution, die diese Rolle kurzfristig übernehmen kann. Als die Banken der dominierende Akteur im Geld- und Finanzsystem waren, wurden nur an sie verliehen. Heute gibt es eine Reihe von Intermediären, darunter Broker-Dealer, Geldmarktfonds und andere, die bankähnliche Aktivitäten ausüben und Verbindlichkeiten anbieten, die durch weniger liquide Aktiva unterlegt sind, und die keinen direkten Zugang zur Zentralbank haben. Jüngste Erfahrungen legen nahe, dass sie trotzdem Hilfe erhalten, wenn sie unter Druck geraten.
Die Ökonomen schlagen vor: „Wenn Nicht-Banken Zugang haben sollen, dann sollte es eine offene ständige Fazilität geben, allerdings mit regulatorischen Einschränkungen. Wenn nicht, muss es strukturelle Reformen geben, um sicherzustellen, dass die Nicht-Banken niemals einen Kredit bei der Zentralbank aufnehmen müssen und dass die Investoren ihre Verbindlichkeiten nicht als sicher behandeln.“
3) Market Maker of last resort: Bewältigung von Liquiditätsproblemen in bestimmten Märkten
Die Operationen letztinstanzlicher Market Maker zielen darauf ab, die Liquidität in einem Markt wiederherzustellen, der direkt oder indirekt als kritisch für die Realwirtschaft angesehen wird. Bei Zinssätzen von Null können so motivierte Staatsanleihekäufe wie QE aussehen, ohne es zu sein. Solche Aktionen könnten bei jeder Höhe des Leitzinses stattfinden. Wie der letztinstanzliche Kreditgeber muss ein richtig konstruierter Market Maker eine große Kapazität haben, muss aber möglicherweise nur wenig tun.
„Wenn der Market Maker Käufe tätigt, dann sollten diese wieder rückgängig gemacht werden, sobald der Zielmarkt wieder funktioniert“, fordern Cecchetti und Tucker. Geschehe dies nicht, müssten die Bestände einem anderen Zweck dienen, der seine eigene Rechtfertigung erfordere. Beispiele für Market-Maker-of-Last-Resort-Operationen sind leicht zu finden. Der Klassiker ist Mario Draghis „whatever it takes“, bei dem die EZB einen Backstop für Staatsanleihen der Eurozone bereitstellte, aber am Ende nichts kaufte.
4) Selektive Kreditunterstützung: Steuerung des Kreditflusses in bestimmte Sektoren, Regionen oder Firmen
Politische Entscheidungsträger könnten dies aus einer Vielzahl von Gründen tun, von denen viele ein politisches Motiv haben und somit politischen Druck erzeugen können. „Dass Politiker versuchen könnten, die Zentralbank für gezielte Programme zu benutzen, unterstreicht die Notwendigkeit eines klaren Rahmens. Unabhängige Zentralbanken müssen erklären, was sie tun und warum“, so die Wissenschaftler. Ein gutes Beispiel für Kreditunterstützung sind die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) der EZB.
5) Staatliche Notfinanzierung: Bereitstellung benötigter Mittel direkt an den Staat
Schließlich können die Zentralbanken ihre Bilanzen nutzen, um Regierungen Notfinanzierungen zu gewähren. In gewisser Weise führt das zurück zu einem der Ursprünge des Zentralbankwesens – der Kriegsfinanzierung. In der heutigen Zeit gibt es, um Missbrauch zu verhindern, gesetzliche Beschränkungen für die direkte Staatsfinanzierung durch Zentralbanken. Da dies aber nicht unter allen Umständen ausgeschlossen werden kann, sollte es einen Rahmen geben, der festlegt, wie und wann dies geschehen darf – einschließlich des Rückwegs in die Unabhängigkeit. „Wenn dies der Fall wäre, müssten Zentralbanken Regierungen vielleicht nicht mehr via QE helfen“, meinen die Ökonomen.
Bei der Gestaltung spezifischer Regelungen für jede Art von Bilanzoperationen können nach ihrer Einschätzung die bestehenden Strukturen zur Unterstützung der herkömmlichen Geldpolitik als Leitfaden dienen. „Wann immer die Zentralbank handelt, sollte das entsprechende Entscheidungsgremium innerhalb der Zentralbank klar sagen, was es tut und warum, wobei der Gouverneur und seine entsprechenden Kollegen rechenschaftspflichtig sind.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53396712-oekonomen-schlagen-fuenf-kategorien-fuer-zentralbankaktivitaeten-vor-015.htm
SIEHE DAZU:
=> Stephen Cecchetti, Paul Tucker: Understanding how central banks use their balance sheets: A critical categorisation – VOXEU, 1.6.2021
QUELLE: https://voxeu.org/article/understanding-how-central-banks-use-their-balance-sheets
– ÖSTERREICH / OeNB
OeNB revidiert Inflationsprognose für 2021 um + 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 % – Analyse stellt geringe Übertragungseffekte der Material- und Baukostenanstiege auf Endverbraucherpreise sowie Miet- und Immobilienpreise fest – OeNB, 12.7.2021
In ihrer aktuellen Inflationsprognose erwartet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für Österreich im Jahr 2021 eine am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 2,2 % und damit eine um 0,2 Prozentpunkte höhere Teuerung als in der Projektion vom Juni 2021. Ausschlaggebend dafür ist der überraschend starke Anstieg der Energiepreise, der sich im Frühjahr in entsprechend hohen monatlichen Inflationsraten niederschlug. Diese Entwicklung basiert aber zum Großteil auf den im ersten Lockdown 2020 drastisch gesunkenen Rohölpreisen und wird sich darum laut OeNB nicht fortsetzten. Im Rahmen des Schwerpunktthemas werden die Auswirkungen der stark gestiegenen Bau- und Materialkosten beleuchtet. Die OeNB geht davon aus, dass sich diese Teuerungen künftig kaum in den Verbraucherpreisen sowie Miet- und Immobilienpreisen niederschlagen werden.
QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20210712.html
SIEHE AUCH das Periodikum „Inflation aktuell“ der OeNB
QUELLE: https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/inflation-aktuell.html
USA
Alexander Trentin: König Dollar schlägt alle: Abwertungsreigen der Währungen im Juni gegenüber dem US-Dollar – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 16.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/dollar-640×416.jpg
Die US-Valuta wertet sich auf – teils massiv. Die obige Grafik zeigt die Veränderung seit Mitte Juni: Abgesehen vom mexikanischen Peso (MXN) haben fast alle wichtigen Währungen gegenüber dem Dollar an Wert verloren. Der südafrikanische Rand (ZAR) hat sich zum Dollar gar fast 6% abgewertet, die norwegische Krone (NOK) und der Thai-Baht über 4%.
Mitte Juni gab es ein folgenreiches Treffen der US-Notenbank, betont Jonas Goltermann, Ökonom beim Researchhaus Capital Economics, in einer Studie. Anfänglich sei die Dollaraufwertung durch «einen Sprung der kurzfristigen US-Zinserwartungen» getrieben worden. Seitdem aber bemüht sich das Fed, demonstrativ eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik auszuschliessen, und die Zinserwartungen sind zurückgekommen.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2098/
US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet – DJN/dpa-AFX, 14.7.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 9. Juli verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,9 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,866 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 4,1 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1 Million Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 6,075 Millionen gesunken waren. Die API-Daten hatten einen Rückgang von 1,5 Millionen Barrel angezeigt.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11,4 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.
Die Daten im Überblick:
Aktuell Vorwoche
Rohöllagerbestände 437,6 445,5
Benzinlagerbestände 236,5 235,5
Destillatebestände 142,3 138,7°
(in Mio Barrel)
Hinweis: Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53410960-us-rohoellagerbestaende-sinken-staerker-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53410735-usa-rohoelvorraete-fallen-staerker-als-erwartet-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
API-Daten zeigen achten Rückgang der US-Rohöllagerbestände in Folge – DJN, 13.7.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche bereits das achte Mal in Folge gesunken, diesmal um 4,1 Millionen Barrel, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 8,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,5 Millionen Barrel nach minus 2,7 Millionen eine Woche zuvor.
Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 4,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,8 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53400958-api-daten-zeigen-achten-rueckgang-der-us-rohoellagerbestaende-in-folge-015.htm
Inflationserwartungen laut Beige Book nach oben gerichtet – DJN, 14.7.2021
Laut dem neuesten Konjunkturbericht „Beige Book“ der US-Notenbank hat die wirtschaftliche Aktivität in den USA seit Ende Mai bis Anfang Juli zugenommen. Dabei habe es Preisdruck auf breiter Basis gegeben, insbesondere in der Gastronomie. Während einige Bereiche der Wirtschaft davon ausgingen, dass der erhöhte Preisanstieg vorübergehender Natur sei, rechne die Mehrheit damit, dass in den kommenden Monaten die Einstandskosten und die Verkaufspreise weiter steigen werden, so die US-Notenbank.
Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Am 27. und 28. Juli werden keine Änderungen in der Geldpolitik erwartet. Allerdings befindet sich die Fed derzeit in einer Kampagne, um die Märkte auf die Reduzierung ihrer Anleihekäufe vorzubereiten.
Zuletzt ist die Inflation in den USA aufgrund von Sonder- und Nachholeffekten im Zuge der Corona-Krise in die Höhe geschnellt. Die Fed geht jedoch davon aus, dass die anziehende Inflation ein vorübergehendes Phänomen bleibt, denn die hohen Inflationsraten sind auch Resultat des Konjunktureinbruchs im Jahr 2020. Sollte die Inflation jedoch so bleiben, gerät die Fed schnell unter Handlungsdruck.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53412210-inflationserwartungen-laut-beige-book-nach-oben-gerichtet-015.htm
USA: Preisauftrieb von Importgütern schwächt sich im Juni von 11,6 auf 11,2 Prozent ab – Mai-Rate war höchste seit zehn Jahren – Starker Preisanstieg für Exportgüter – dpa-AFX/DJN, 15.7.2021
Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich von erhöhtem Niveau aus abgeschwächt. Die Einfuhrpreise stiegen im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate laut Ministerium 11,6 Prozent betragen. Das war die höchste Jahresrate seit knapp zehn Jahren.
Auch im Monatsvergleich nahm der Preisdruck aus dem Ausland etwas ab. Die Importpreise erhöhten sich von Mai auf Juni um 1,0 Prozent, nach 1,4 Prozent im Mai. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 1,2 Prozent erwartet. Die Preise für importierte Kraftstoffe stiegen zwar immer noch deutlich, allerdings weniger stark als im Vormonat.
Unter Herausrechnung von Öl erhöhten sich die Importpreise um 0,7 Prozent. Die Ölpreise alleine waren verglichen mit dem Vormonat um 4,6 Prozent höher. Die Jahresraten betrugen bei den Importpreisen insgesamt plus 11,2 Prozent und ohne Öl plus 6,8 Prozent.
Die Einfuhrpreise fließen teilweise in die Verbraucherpreise ein, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Nach jüngsten Zahlen ist die Inflationsrate im Juni auf ein 13-Jahreshoch von 5,4 Prozent gestiegen. Obwohl dies deutlich über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent liegt, will die Fed geldpolitisch nicht reagieren, da sie die Entwicklung als temporäres Phänomen betrachtet.
Die Exportpreise verzeichneten den Angaben zufolge im Juni einen Anstieg um 1,2 Prozent nach plus 2,2 Prozent im Vormonat. Auf Jahressicht wurde ein Preisanstieg von 16,8 Prozent genannt.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420851-usa-preisauftrieb-von-importguetern-schwaecht-sich-ab-016.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420983-us-importpreise-steigen-im-juni-spuerbar-015.htm
Gwynn Guilford u.a.: US-Erzeugerpreise steigen im Juni stärker als erwartet – DJN, 14.7.2021
Die US-Erzeugerpreise sind im Juni spürbar gestiegen, was den Inflationsdruck in der US-Wirtschaft weiter erhöht. Die Preise auf der Produzentenebene kletterten im Schnitt um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet.
Auf Jahressicht lagen die Erzeugerpreise um 7,3 Prozent höher, die größte Steigerung seit November 2010.
Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 6,7 Prozent gerechnet, nachdem der Anstieg im Vormonat bei 6,6 Prozent gelegen hatte.
Für die Kernrate – ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie – wurde ein Plus von 5,5 Prozent gemeldet, die höchste Rate seit August 2014, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Verglichen mit dem Vormonat stiegen sie um 1,0 Prozent. Ökonomen hatten nur 0,5 Prozent prognostiziert.
Der jüngste Schub bei den Produzentenpreisen spiegelt viele Faktoren wider, darunter durcheinander geratene Lieferketten, verlängerte Lieferzeiten, höhere Transportkosten und einen grassierender Material- und Arbeitskräftemängel sowie die Erholung der Energie- und Rohstoffpreise.
Die Erzeugerpreise geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.
Die Daten dürften die Inflationserwartungen weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Verbraucherpreise waren im Juni um 5,4 Prozent gestiegen und damit deutlich stärker als von der Fed angestrebt.
Allerdings spielen bei der Preisentwicklung Sonderfaktoren eine Rolle, die mit der Aufhebung von Corona-Beschränkungen zusammenhängen. Die Fed erachtet die Probleme jedoch als temporär und will zunächst noch mit einer Änderung der Geldpolitik abwarten.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53408868-us-erzeugerpreise-steigen-im-juni-staerker-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53408821-usa-erzeugerpreise-steigen-deutlich-staerker-als-erwartet-016.htm
Gwynn Guilford u.a.: US-Preise steigen mit höchster Jahresrate von 5.4 Prozent seit 13 Jahren – DJN/dpa-AFX, 13.7.2021
Die US-Verbraucherpreise sind im Juni weiter stark gestiegen und hielten die jährliche Inflationsrate mit einem Plus von 5,4 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 13 Jahren. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist die höchste Steigerung seit Juni 2008. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. Die für den Mai gemeldete Preissteigerung von 0,6 Prozent wurde bestätigt.
Dadurch erhöhte sich die Jahresteuerung auf 5,4 (Vormonat: 5,0) Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit August 2008. Volkswirte hatten lediglich mit einer Rate von 5,0 Prozent gerechnet. Die Fed verfolgt ein flexibles Inflationsziel: Die Preissteigerung darf für eine Weile höher als 2 Prozent liegen, wenn sie sich zuvor für einen längeren Zeitraum darunter bewegt hat.
In der Kernrate, die die besonders volatilen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor lässt, stiegen die Preise um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten nur eine Rate von 0,5 Prozent erwartet. Die Jahresteuerung betrug 4,5 (Vormonat: 3,8) Prozent. Die Prognose hatte auf 4,0 Prozent gelautet.
Der Preisindex für gebrauchte Pkw und Lkw stieg im Juni mit 10,5 Prozent weiter stark an. Dieser Anstieg machte mehr als ein Drittel des saisonbereinigten Anstiegs aller Positionen aus. Nahrungsmittel verteuerten sich um 0,8 Prozent und damit stärker als im Mai mit 0,4 Prozent. Der Energieindex stieg um 1,5 Prozent, wobei der Benzinpreise um 2,5 Prozent zulegte.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53397073-us-preise-steigen-mit-hoechster-jahresrate-seit-13-jahren-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53396776-usa-inflationsrate-steigt-auf-hoechsten-stand-seit-august-2008-016.htm
SIEHE DAZU:
=> USA: Autopreise gehen durch die Decke, ebenso Miet- und Gebrauchtwagen teurer – Preisspirale auch bei lebenswichtigen Dingen wie Essen, Kleidung und Unterkunft – – Anstieg der Hauspreise innerhalb eines Jahres um 20 Prozent – Pressetext, 15.7.2021
QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210715003
US-Realeinkommen sinken im Juni um rund 1 Prozent – DJN, 13.7.2021
Die Realeinkommen in den USA sind im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Mai ein Rückgang um 0,5 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Juni saison- und inflationsbereinigt 389,28 US-Dollar nach 392,64 Dollar im Vormonat.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53397074-us-realeinkommen-sinken-im-juni-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Philly-Fed-Index gibt im Juli stärker als erwartet nach – DJN/dpa-AFX, 15.7.2021
Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Juli eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf 21,9 Punkte von 30,7 im Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von 27,0 erwartet.
Liegt der Philly-Fed-Index über null geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index darunter, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.
Schwächer entwickelte sich der Subindex für den Auftragseingang, er fiel auf 17,0 Punkte von 22,2 im Vormonat. Auch der Subindex für die Beschäftigung ermäßigte sich auf 29,2 Zähler von 30,7 im Vormonat.
Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420920-philly-fed-index-gibt-im-juli-staerker-als-erwartet-nach-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53421063-usa-philly-fed-index-truebt-sich-staerker-als-erwartet-ein-016.htm
New Yorker Konjunkturindex steigt im Juli überraschend stark auf Rekordhoch – DJN, 15.7.2021
Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juli überraschend auf ein Rekordhoch gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index erhöhte sich auf 43,0. Das ist der höchste jemals erreichte Wert. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Stand von 17,3 prognostiziert. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf im Schnitt 18,0 Punkte gerechnet. Im Vormonat hatte der Index bei plus 17,4 gelegen.
Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.
Die Indexkomponente für den Ordereingang stieg im Juli auf 33,2 (Vormonat: 16,3), jene für die Beschäftigung auf 20,6 (12,3). Für die erzielten Preise wurde ein Wert von 39,4 (33,3) ausgewiesen.
Dabei stieg der Indikator für die Aufträge auf den höchsten Stand seit 17 Jahren. Der Wert für die Verkaufspreise kletterte auf ein Rekordniveau.
Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420828-new-yorker-konjunkturindex-steigt-im-juli-auf-rekordhoch-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420664-usa-empire-state-index-steigt-auf-rekordstand-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html
US-Industrie steigert Produktion im Juni moderat – DJN, 15.7.2021
Die Industrie in den USA hat im Juni ihre Produktion moderat gesteigert. Die Erzeugung legte um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Zugleich stieg die Kapazitätsauslastung um 0,3 Prozentpunkte auf 75,4 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Ökonomen hatten einen Anstieg der Produktion um 0,6 Prozent prognostiziert, für die Kapazitätsauslastung war ein Wert von 75,7 Prozent vorhergesagt worden.
Im Vormonat hatte sich die Industrieproduktion um 0,7 Prozent (vorläufig: 0,8 Prozent) erhöht. Die Kapazitätsauslastung wurde auf 75,1 (75,2) revidiert.
Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde im Juni binnen Monatsfrist ein Produktionsminus von 0,1 Prozent (Vormonat: plus 0,9 Prozent) verzeichnet. Hinter diesem Rückgang stand ein anhaltender Mangel an Halbleitern, der zu einem Rückgang von 6,6 Prozent bei der Produktion von Kraftfahrzeugen und Teilen beitrug. Ohne Berücksichtigung von Kraftfahrzeugen und Teilen stieg die Produktion um 0,4 Prozent.
Die Erzeugung von Versorgungsunternehmen legte um 2,7 Prozent zu, was die erhöhte Nachfrage nach Klimaanlagen widerspiegelt, da große Teile des Landes im Juni eine Hitzewelle erlebten. Der Bergbau steigerte seinen Ausstoß um 1,4 Prozent.
Mit 100,1 Prozent des Durchschnittswerts von 2017 lag die gesamte Industrieproduktion im Juni um 9,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, aber 1,2 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie (Februar 2020).
Im gesamten zweiten Quartal stieg die Industrieproduktion mit einer Jahresrate von 5,5 Prozent. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe erhöhte sich um 3,7 Prozent, trotz eines Rückgangs von 22,5 Prozent bei Kraftfahrzeugen und Kfz-Teilen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53421630-us-industrie-steigert-produktion-im-juni-moderat-015.htm
Stimmung der US-Verbraucher im Juli deutlich eingetrübt – DJN/dpa-AFX, 16.7.2021
Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli überraschend abgeschwächt. Der von der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte um 4,7 Punkte auf 80,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 86,3 erwartet. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg auf 86,5 Punkten gerechnet. Im Juni hatte sich das Konsumklima noch verbessert. Bei der Umfrage Ende Juni lag der Index noch bei 88,6.
Der Index für die Erwartungen belief sich auf 78,4 (Vormonat: 83,5), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 84,5 (85,5) angegeben.
Sowohl bei der Beurteilung der aktuellen Lage, als auch bei der Einschätzung der künftigen Geschäfte gingen die Indexwerte für Juli zurück. Bei beiden Unterindizes hatten Analysten im Schnitt eine Verbesserung erwartet.
Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,8 von 4,2 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 2,9 von 2,8 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.
Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53434150-stimmung-der-us-verbraucher-im-juli-deutlich-eingetruebt-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53433159-usa-konsumklima-der-uni-michigan-truebt-sich-ueberraschend-ein-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.sca.isr.umich.edu/
Amara Omeokwe: Umsätze der US-Einzelhändler steigen im Juni leicht – DJN, 16.7.2021
Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Juni wider Erwarten leicht gesteigert, da die Wirtschaft auf breiter Front wieder ansprang. Die Autohändler kämpften unterdessen mit Lieferengpässen. Die gesamten Umsätze des Einzelhandels stiegen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet.
Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, fielen die Umsätze im Kfz-Bereich um 4,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Umsätze ohne Kfz stiegen indes um 1,3 Prozent. Ökonomen hatten in dieser Kategorie nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.
Für den Mai gab das Ministerium einen Rückgang von revidiert 1,7 (vorläufig: 1,3) Prozent für die Gesamtrate an. Die Veränderung ex Kfz wurde auf minus 0,9 (vorläufig: minus 0,7) Prozent revidiert.
Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53432334-umsaetze-der-us-einzelhaendler-steigen-im-juni-leicht-015.htm
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken – tiefster Wert seit März 2020 – DJN, 15.7.2021
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 10. Juli deutlich abgenommen und das niedrigste Niveau seit Mitte März 2020 erreicht, ehe die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt durchschlug. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 26.000 auf 360.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 360.000 vorhergesagt. Analysten hatten im Schnitt allerdings einen etwas stärkeren Rückgang auf 350 000 erwartet.
Für die Vorwoche wurde der Wert allerdings nach oben revidiert, auf 386.000 von ursprünglich 373.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 14.500 auf 382.500, auch dies der beste Wert seit Mitte März 2020.
Zuletzt war die Erholung am amerikanischen Arbeitsmarkt etwas ins Stocken geraten. Die Zahl der Hilfsanträge war zeitweise sogar gestiegen. Die Zahl der Hilfsanträge war zeitweise sogar gestiegen.
In der Woche zum 3. Juli erhielten 3,241 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 126.000.
Tendenziell geht die Zahl der Erstanträge aber seit Beginn des Jahres zurück. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt verbessert sich dank eines robusten Aufschwungs wegen enormer Staatshilfen, Lockerungen der Corona-Maßnahmen und den Corona-Impfungen.
Die Hilfsanträge liegen aber nach wie vor über dem Niveau, das vor der Corona-Krise üblich war. In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420826-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-sinken-tiefster-wert-seit-maerz-2020-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420666-usa-erstantraege-auf-arbeitslosenhilfe-gesunken-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
GROSSBRITANNIEN
Großbritannien: Inflation steigt weiter über zwei Prozent – dpa-AFX, 14.7.2021
In Großbritannien sind die Lebenshaltungskosten auch im Juni kräftig gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen 2,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie die Statistikbehörde ONS am Mittwoch in London mitteilte. Die Teuerung ist damit so stark wie seit August 2018 nicht mehr gestiegen. Im Mai hatte die Inflationsrate 2,1 Prozent betragen, im April 1,5 Prozent und im März 0,7 Prozent.
Analysten wurden von der Stärke des neuerlichen Teuerungsschubs überrascht. Sie hatten für Juni im Schnitt nur mit einer Inflationsrate von 2,2 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau ebenfalls unerwartet stark. In dieser Betrachtung meldete die Statistikbehörde einen Preisanstieg um 0,5 Prozent, während Analysten mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet hatten.
Preisauftrieb kam laut ONS unter anderem durch steigende Transportkosten und durch einen überdurchschnittlich starken Anstieg der Preise für Kleidung und Schuhe. Leicht gesunken sind dagegen im Jahresvergleich die Preise für Nahrungsmittel.
Ähnlich wie in Großbritannien ist derzeit auch in anderen führenden Industriestaaten ein deutlicher Anstieg der Inflationsraten zu beobachten. In den USA ist die Inflationsrate im Juni bis auf 5,4 Prozent gestiegen.
Mit dem erneuten Preisschub wird das Inflationsziel der britischen Notenbank von zwei Prozent weiter übertroffen. Viele Experten sehen den Anstieg der Inflation aber nur als eine vorübergehende Erscheinung.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53403505-grossbritannien-inflation-steigt-weiter-ueber-zwei-prozent-016.htm
Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht – dpa-AFX, 15.7.2021
In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit im Mai leicht gestiegen. Gegenüber April stieg die Arbeitslosenquote von 4,7 auf 4,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine stabile Quote erwartet. Im Dreimonatszeitraum von März bis Mai sank sie hingegen zum vorherigen Zeitraum um 0,2 Punkte. Die Beschäftigungsquote erhöhte sich dabei leicht auf 74,8 Prozent.
Der Arbeitsmarkt setze seine Ende 2020 begonnene Erholung fort, kommentierte das ONS. Die Beschäftigung steige weiter, sie liege landesweit aber immer noch deutlich unter ihrem Vorkrisenniveau. In einigen Regionen jedoch sei das Niveau von Februar 2020 erstmals wieder überschritten worden. Mit der Lockerung vieler Corona-Beschränkungen steige auch die Arbeitszeit wieder. Auch sie liege aber immer noch unter ihrem Niveau von vor der Krise.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53415341-grossbritannien-arbeitslosigkeit-steigt-leicht-016.htm
SCHWEIZ
Sylvia Walter: Luxushäuser boomen – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 14.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/luxushaeuser.png
Das Niedrigzinsumfeld hält seit vielen Jahren an und befeuert die Nachfrage nach Immobilien, nicht nur in der Schweiz. Zudem sorgt die Pandemie dafür, dass gerade Luxusimmobilien nicht allzu lange auf dem Markt bleiben. Der Überhang der Nachfrage nach Eigenheimen im obersten Preissegment in der Schweiz ist markant.
«Die Transaktionszahl ist im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liegt damit etwa dreimal so hoch wie ihr fünfjähriger Durchschnitt», schreibt das Chief Investment Office der UBS im heute veröffentlichten Luxury Property Focus 2021. Die Wirkung auf die Preise der Häuser bleibt nicht aus.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2096/
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
EU-Behörde sieht raschen, starken Anstieg der Infektionsfälle – Auch starker Anstieg für Österreich erwartet – ORF, 16.7.2021
Die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde rechnet mit einem erneuten starken Anstieg der Coronavirus-Infektionsfälle in Europa in den nächsten Wochen. Die Zahl der Neuinfektionen könnte sich laut den heute veröffentlichten Prognosen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bis Anfang August fast verfünffachen. Ursache seien die hochansteckende Delta-Variante sowie die Lockerungen von Coronavirus-Beschränkungen in vielen Ländern.
Die Prognosen der EU-Behörde beziehen sich auf das Gebiet der EU, Norwegens und Islands. Das ECDC erwarte für die am 1. August endende Woche eine 7-Tage-Inzidenz von 420 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Vergangene Woche lag die 7-Tage-Inzidenz in dem Gebiet bei 90.
*** Auch starker Anstieg für Österreich erwartet ***
Die ECDC rechnet zudem damit, dass die Zahl der Fälle in der Region in der ersten vollständigen August-Woche auf 622,9 pro 100.000 Einwohner angestiegen sein wird. Für Österreich wird ein Wert von knapp über 200 angegeben.
Die Zahl der Behandlungen im Krankenhaus und der Covid-19-Todesfälle wird laut ECDC aufgrund der laufenden Impfkampagnen langsamer ansteigen. Derzeit verzeichnen zwei Drittel der 30 von der EU-Behörde beobachteten Länder eine steigende Tendenz bei den Neuinfektionen.
In der Woche von 5. bis 11. Juli stieg die Zahl der Neuinfektionen in der EU sprunghaft um 60 Prozent an. „In den am stärksten betroffenen Ländern wurden die größten Zuwächse und höchsten Melderaten bei den 15- bis 24-Jährigen gemeldet“, erklärte das ECDC.
QUELLE: https://orf.at/stories/3221308/
Andreas Plecko: Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent – DJN, 16.7.2021
Die Inflation in der Eurozone hat im Juni etwas nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank von 2,0 auf 1,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit – wie von Volkswirten erwartet – ihre erste Schätzung vom 30 Juni.
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an. Trotz des Rückgangs dürfte der Höhepunkt des Inflationsanstiegs aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei rund 3 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.
Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, gab im Juni ebenfalls etwas nach. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) sank von 1,0 auf 0,9 Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.
Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Juni in der Gesamtrate um 0,3 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,3 Prozent. Die vorläufigen Daten wurden damit – wie von Volkswirten erwartet – bestätigt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53429662-inflation-im-euroraum-sinkt-im-juni-auf-1-9-prozent-015.htm
SIEHE DAZU:
=> TABELLE/EU-Verbraucherpreise Juni nach Ländern – DJN, 16.7.2021
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53429663-tabelle-eu-verbraucherpreise-juni-nach-laendern-015.htm
Andreas Plecko: Industrie in der Eurozone drosselt Produktion im Mai – DJN, 15.7.2021
Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Mai stärker gedrosselt als erwartet. Hinter dem Rückgang stehen vor allem Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten, etwa bei Halbleitern. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Industrieproduktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet.
Die Aussichten für den Industriesektor in der Eurozone sind grundsätzlich positiv, da die Impfprogramme helfen, die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen zu überwinden und die Nachfrage anzukurbeln. Allerdings beeinträchtigen aktuell Lieferengpässe die Produktion in einigen Sektoren, vor allem in der Automobilindustrie, und diese Belastungen werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres nicht vollständig abklingen, sagen Ökonomen.
Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 20,5 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Plus von 22,4 Prozent gerechnet. Der ungewöhnlich hohe Anstieg beruht auf dem Vergleich mit den außergewöhnlich niedrigen Daten im Mai 2020, als die Wirtschaft inmitten der öffentlichen Gesundheitskrise in weiten Teilen zum Stillstand kam.
Wie Eurostat weiter mitteilte, fiel die Industrieproduktion in der EU-27 im Mai um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Binnen Jahresfrist lag sie um 21,2 Prozent höher.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53405804-industrie-in-der-eurozone-drosselt-produktion-im-mai-015.htm
Daniel Michaels: EU verschiebt wegen starken Drucks der USA Digitalsteuer bis Oktober – Janet Yellen lobbiert in Brüssel – DJN, 12.7.2021
Die Europäische Union wird ihre geplante Digitalsteuer verschieben, sagte ein EU-Sprecher. Die EU stand unter starkem Druck der USA, eine Ankündigung zu verschieben, bis eine Einigung unter den G20-Ländern zustande kommt. Die EU habe beschlossen, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalsteuer bis Oktober auf Eis zu legen, sagte der Sprecher. US-Finanzministerin Janet Yellen ist am Montag und Dienstag in Brüssel, um über das Abkommen für eine globale Mindeststeuer zu diskutieren und gegen die vorgeschlagene EU-Abgabe zu lobbyieren, die als im Widerspruch zum G20-Abkommen stehend kritisiert wurde.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53384319-eu-verschiebt-digitalsteuer-bis-oktober-015.htm
EU stellt Pläne für CO2-Grenzsteuer vor – Die EU-Kommission stellt die weltweit ersten Pläne für eine Art CO2-Steuerabgabe bei energie-intensiven Importgütern vor – Finanz & Wirtschaft/Reuters, 14.7.2021
Im Kampf für den Klimaschutz geht die EU-Kommission mit Plänen für eine Art CO2-Grenzsteuer in die Offensive. Die Abgabe auf Emissionskosten von energie-intensiven Importgütern wie Stahl, Zement und Aluminium soll in einer Übergangsphase bis Ende 2025 eingeführt und ab 2026 voll greifen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch zu ihrem «CO2-Grenzausgleichsmechanismus» genannten System mitteilte. Importeure müssen im Rahmen des Mechanismus digitale Verschmutzungs-Zertifikate erwerben.
Damit sollen Firmen in der EU vor Konkurrenz aus dem Ausland geschützt werden, deren Produktion nicht denselben Klimaauflagen unterliegt wie in der Europäischen Union – dabei stehen Staaten wie Russland und China im Fokus. Die Volksrepublik gab wenige Stunden vor Bekanntgabe der Brüsseler Pläne bekannt, dass sie noch in diesem Monat ein Emissionshandelssystem (ETS) starten will. Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist ein wichtiges Instrument zum Klimaschutz.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/eu-stellt-plaene-fuer-co2-grenzsteuer-vor/
ROUNDUP 3/Klimaschutz gibt’s nicht umsonst: EU hat neuen Plan für CO2-Ziel – Gemischte Reaktionen aus Politik und Wirtschaft – EU-Pläne für klimaverbessernde Verkehrs-Infrastruktur – Deutsche Bundesumweltministerin (SPD) fordert rasche Umsetzung einer „neuen industrielle Revolution, angeführt von der Europäischen Union“, Bundesverkehrsminister (CSU) reagiert deutlich verhaltener – dpa-AFX, 14.7.2021
Keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr, eine Steuer auf Flug- und Schiffstreibstoffe und höhere Kosten für das Heizen mit Kohle, Erdgas oder Öl: Die EU-Kommission hat einen umfassenden Plan präsentiert, mit dem das Erreichen der europäischen Klimaschutzziele sicherstellt werden soll. Im Kern sieht der Vorschlag vor, den Verbrauch von fossilen Energieträgern weiter zu verteuern, um den Umstieg auf klimafreundliche Technologien zu beschleunigen. Der Autoindustrie sollen zudem noch einmal strengere Kohlendioxid-Grenzwerte auferlegt werden – spätestens 2035 sollen dann in der EU nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden.
Abgesehen davon müssen Verbraucher mit erhöhten Kosten für die Nutzung herkömmlicher Benzin- und Diesel-Fahrzeuge und das Heizen rechnen. Hintergrund ist, dass die EU-Kommission ein separates Emissionshandelssystem für den Straßenverkehr und den Gebäudesektor schaffen will, das CO2-Emissionen aus diesen Bereichen kostenpflichtig macht. Innereuropäische Flüge und Kreuzfahrten könnten unter anderem durch neue Energiesteuern teurer werden. Um Menschen mit niedrigen Einkommen nicht mit steigenden Energie- und Transportkosten alleine zu lassen, soll es einen Klimasozialfonds geben.
„Die Wirtschaft der fossilen Brennstoffe stößt an ihre Grenzen“, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Vorstellung der Pläne. Der für Klimaschutz zuständige Vizepräsident Frans Timmermans räumte offen ein: „Alles, was wir heute vorgestellt haben, wird nicht einfach – es wird verdammt hart.“
Die Gesamtheit der vorgeschlagenen Maßnahmen soll es den EU-Staaten ermöglichen, die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Deswegen wird das Paket von der Kommission auch „Fit for 55“ genannt. Langfristiges Ziel der EU ist es, dass 2050 netto gar keine klimaschädlichen Gase mehr in die Atmosphäre gelangen. So sollen der menschengemachte Klimawandel und dessen Folgen aufgehalten werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen in der globalen Erwärmung einen Grund für steigende Meeresspiegel und wetterbedingte Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Überschwemmungen oder Waldbrände.
*** Gemischte Reaktionen aus Politik und Wirtschaft ***
Die ersten Reaktionen auf die Kommissionsplanungen fielen gemischt aus. Während Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace von einem unzureichenden Beitrag zum Klimaschutz sprachen, äußerten sich Wirtschaftsvertreter besorgt. So warnte die Luftfahrtbranche vor Wettbewerbsnachteilen durch die Pläne der Kommission. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) gab unter anderem zu bedenken, dass das vorgeschlagene 55-Prozent-Ziel sehr hohe Anteile an E-Autos erfordere. So müssten bis Ende des Jahrzehnts in der ganzen EU knapp zwei Drittel der Neuwagen E-, Hybrid- oder Brennstoffzellen-Antriebe haben.
Der VDA spielte damit darauf an, dass die EU-Kommission konkret vorschreiben will, dass die Treibhausgasemissionen von Neuwagen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 2021 gesenkt werden müssen. Wenn sich Hersteller nicht an die Vorgaben halten, sollen Strafen fällig werden. Ab 2035 sollen in der EU dann nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden. Dabei soll es jedoch eine Überprüfungsklausel geben. Demnach soll alle zwei Jahre analysiert werden, wie weit die Hersteller sind; 2028 soll ein großer Prüfbericht folgen. Theoretisch könne das Datum 2035 noch verschoben werden.
*** EU-Pläne für klimaverbessernde Verkehrs-Infrastruktur ***
Für den Wandel im Verkehrssektor sollen auf großen Hauptverkehrsstraßen in der EU alle 60 Kilometer Ladestellen für Elektroautos eingerichtet werden. Die Investitionskosten für die Ladeinfrastruktur schätzt die Kommission auf insgesamt 15 Milliarden Euro. Alle 150 Kilometer sollen Wasserstofftankstellen entstehen.
Um die europäische Industrie nicht auf dem Weltmarkt zu benachteiligen, sollen europäische Produzenten von Produkten wie Stahl, Aluminium, Dünger und Elektrizität den Planungen zufolge über einen sogenannten Grenzausgleichsmechanismus vor ausländischer Konkurrenz mit weniger strengen Klimaschutzauflagen geschützt werden. Er sieht vor, auf Importe dieser Güter eine CO2-Abgabe einzuführen.
Über die Umsetzung der Vorschläge müssen nun die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament beraten. Aus Sicht der EU-Kommission ist Eile geboten, um Industrie und Verbrauchern möglichst viel Zeit für die Umstellungen und Reduktionen zu geben. „Dieses ist die alles entscheidende Dekade im Kampf gegen die Klima- und die Biodiversitätskrise“, kommentierte Kommissionsvize Timmermans.
*** Deutsche Bundesumweltministerin (SPD) fordert rasche Umsetzung einer „neuen industrielle Revolution, angeführt von der Europäischen Union“, Bundesverkehrsminister (CSU) reagiert deutlich verhaltener ***
Bundesumweltministerin Svenja Schulze kündigte an, dass Deutschland schnell mit der Arbeit beginnen wird. Die Bundesregierung werde die Vorschläge der EU-Kommission nun gründlich, aber auch zügig und konstruktiv prüfen, erklärte die SPD-Politikerin. Es gehe um nichts weniger als eine „neue industrielle Revolution, angeführt von der Europäischen Union“. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer reagierte hingegen deutlich zurückhaltender auf die Vorschläge. „Man muss sich immer vergegenwärtigen, das eine ist fordern und festlegen, aber man muss auch noch erreichen und umsetzen“, sagte der CSU-Politiker.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53410938-roundup-3-klimaschutz-gibt-s-nicht-umsonst-eu-hat-neuen-plan-fuer-co2-ziel-016.htm
Andrea Thomas (WSJ): Wirtschaft und Umweltschützer: EU-Kommisison muss mehr für Klima tun – DJN, 13.7.2021
Wirtschaftsverbände haben vor der Vorstellung der Kommissionsvorschläge zum Erreichen der EU-Klimaziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien und Nutzung von digitalen Technologien aufgefordert. Umweltverbände kritisierten hingegen, dass die geplante Reduktion des klimaschädlichen Kohlendioxidausstoßes um 55 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 nicht ausreiche.
Die Kommission der Europäischen Union (EU) will am Mittwoch ihre „Fit for 55“-Strategie vorstellen, mit der die CO2-Grenzwerte für Autos angepasst, erneuerbare Energien ausgebaut, die Energieeffizienz angehoben, der europäische Emissionshandel überarbeitet und ein CO2-Grenzausgleich vorgestellt werden sollen. Dieser CO2-Grenzausgleich sieht vor, dass Warenimporte in die EU an der Grenze mit einer Abgabe für CO2-Emissionen belastet werden müssen.
*** Kommunale Unternehmen fordern mehr Anstrengungen beim Ökostrom ***
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) betonte vor der Veröffentlichung der EU-Pläne, dass die Klimaziele und Energiewende mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien stehen und fallen. Deshalb brauche Europa einen verlässlichen und tragfähigen Investitionsrahmen, der nicht durch Planungs- und Genehmigungsverfahren ausgebremst werden dürfe.
Zur Erreichung der Klimaneutralität halten die kommunalen Unternehmen es außerdem für zwingend, einen separaten EU-weiten Emissionshandel für den Wärme- und Verkehrssektor einzuführen.
„Hierbei wird die weitere Verknappung von Zertifikaten die notwendige Lenkungswirkung erhöhen, um erfolgreich auf CO2-arme beziehungsweise -freie Technologien umzustellen. Die Kombination aus einmaliger Absenkung der Obergrenze und fortan höherer jährlicher Kürzung (Linearer Reduktionsfaktor) sind wesentliche Schritte, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen“, erklärte VKU-Präsident Michael Ebling.
Die bislang bekannt gewordenen Entwürfe zeigen laut VKU eine von Konsequenz und Machbarkeit geprägte Handschrift. Zu Recht soll auf einen Instrumenten-Mix als Fundament für das Programm gesetzt werden.
Dazu zählten insbesondere die Stärkung des EU-Emissionshandelssystems und die Einführung einer CO2-Bepreisung für den Gebäude- und Verkehrssektor, der massive Ausbau der erneuerbaren Energien, der Vorrang für eine systemisch gedachte Energieeffizienz und die konsequente Förderung klimaneutraler Mobilität für alle Menschen in Europa, so der VKU.
*** Digitale Technologien könnten 150 Megatonnen CO2 einsparen ***
Der Digitalverband Bitkom betonte unterdessen die Wichtigkeit, dass die europäische Klimaschutzpolitik die digitalen Technologien gleichberechtigt neben Einsparmaßnahmen und den Ausbau regenerativer Energiequellen rückt.
„Das wird für mehr Tempo bei der Entwicklung hin zur Klimaneutralität sorgen und kann Europa zudem Wettbewerbsvorteile verschaffen“, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg.
Eine Bitkom-Studie habe gezeigt, dass ein beschleunigter und konsequenter Einsatz digitaler Technologien allein in Deutschland bis 2030 rund 150 Megatonnen CO2 jährlich einsparen könnte. „Die EU-Mitgliedstaaten können ihre Klimaschutzziele mithilfe der Digitalisierung deutlich schneller erreichen“, versprach Bitkom.
*** BUND forderte höheres Klimaziel ***
Für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist das EU-Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 auf mindestens 55 Prozent zu reduzieren, allerdings zu niedrig. Um die Klimaerhitzung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, müsse die EU ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 65 Prozent reduzieren, forderte der Umweltverband.
„Klimaextreme und damit verbundene Katastrophen sind längst tragischer Alltag. Und die Kommission hat die Menschen auf ihrer Seite: Das aktuelle Eurobarometer bekräftigt den Willen der EU-Bevölkerung, die Treibhausgasemissionen auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärte BUND-Vorsitzender Olaf Bandt.
Wenig zielführend seien laut BUND die bislang kursierenden Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, dass ein zweiter EU-Emissionshandel für Bereiche wie Gebäude und Verkehr eine zentrale Maßnahme sein soll. Um wirksam zu werden, bräuchte eine CO2-Bepreisung in diesen Sektoren unter anderem höhere Standards und Ziele. Auch brauche es für das Gelingen einer zukunftsfähigen europäischen Wirtschafts- und Klimapolitik einen sozialverträglichen Klimaschutz, dessen Kosten nicht einseitig zu Lasten Geringverdienender gehe.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53397536-wirtschaft-und-umweltschuetzer-eu-kommisison-muss-mehr-fuer-klima-tun-015.htm
ITALIEN
Inflation legt wie erwartet leicht zu – dpa-AFX, 15.7.2021
In Italien hat sich die Inflation im Juni wie erwartet leicht verstärkt. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 1,2 Prozent gelegen.
Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im Juni um 0,2 Prozent Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt. Besonders deutlich stiegen die Ausgaben für Energie.
Die Preisentwicklung in Italien bleibt hinter der in der Eurozone insgesamt zurück. Wie das europäische Statistikamt Eurostat zuletzt mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Juni 1,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53417148-italien-inflation-legt-wie-erwartet-leicht-zu-016.html
FRANKREICH
Frankreich: Inflation zieht leicht an – dpa-AFX, 13.7.2021
In Frankreich sind die Verbraucherpreise im Juni etwas stärker gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die nach europäischen Standards gemessene Inflation (HVPI) von 1,8 Prozent im Vormonat auf 1,9 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Eine erste Schätzung wurde bestätigt. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,2 Prozent.
Gegenüber dem Vorjahr waren industriell gefertigten Güter wieder teurer, nachdem deren Preise im Vormonat leicht gefallen waren. Die Lebensmittelpreise gaben hingegen weiter nach, allerdings weniger deutlich als im Vormonat. Der Preisauftrieb von Dienstleistungen und Energie nahm ab.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53392061-frankreich-inflation-zieht-leicht-an-016.html
DEUTSCHLAND
Hans Bentzien: Destatis: Deutsche Inflation im zweiten Halbjahr mit kräftigem Schub – DJN, 13.7.2021
Das Statistische Bundesamt (Destatis) rechnet für die nächsten Monate mit beschleunigt steigenden Verbraucherpreisen in Deutschland. „Es ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate im zweiten Halbjahr einen weiteren kräftigen Schub erhält“, heißt es in einer Veröffentlichung von Destatis. Zwar werde sich der positive Basiseffekt bei den Mineralölprodukten in den kommenden Monaten leicht abschwächen, doch komme ab Juli ein weiterer preiserhöhender Basiseffekt hinzu: die temporäre Mehrwertsteuersenkung im Vorjahreszeitraum. „Beide Basiseffekte werden die Inflationsrate bis zum Dezember 2021 beeinflussen“, prognostizieren die Statistiker.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53393404-destatis-deutsche-inflation-im-zweiten-halbjahr-mit-kraeftigem-schub-015.html
Andreas Thomas (WJS): IfW-Präsident: Engpässe und höhere Preise bei Weihnachtsgeschenken – DJN, 16.7.2021
Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, befürchtet wegen dem aktuellen Stau von Containerschiffen im südchinesischen Meer in diesem Jahr einen Engpass bei den Weihnachtsgeschenken und deutlich höhere Preise. „So kurios das jetzt im Sommer klingt: Die Deutschen müssen sich zu Recht Sorgen um ihre Weihnachtsgeschenke machen. Denn das Weihnachtsgeschäft bahnt sich wegen der langen Vorlaufzeiten schon jetzt an“, sagte er zu T-Online.
„China ist für den Gabentisch in deutschen Wohnzimmern der wichtigste Lieferant. Wegen der Lieferengpässe dürften im Dezember die Regale in vielen Geschäften leerer sein als sonst. Und nicht nur das: Wenn es in Asien Lieferprobleme gibt, spüren wir das auch im Preis“, sagte Felbermayr. Wenn Güter knapp seien, regle der Markt das über den Preis. Derjenige mit der höchsten Zahlungsbereitschaft bekomme die Ware. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass viele Produkte aus Fernost in den kommenden Monaten deutlich teurer werden“, erklärte Felbermayr.
Auch auf die deutsche Wirtschaft insgesamt hätten die Lieferengpässe starke Auswirkungen. Nach IfW-Berechnungen gingen 25 Milliarden Euro oder ein knappes Prozent der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung verloren. „In der Industrie ist dieser Anteil noch deutlich höher: Wir erwarten, dass fünf bis sechs Prozent der Industriewertschöpfung wegen der Lieferschwierigkeiten nicht erzielt wird“, so der Ökonom. Allerdings verzögerten sich nur viele Aufträge und Einkäufe, die jetzt in der Pipeline seien.
Mit Blick auf die Corona-Pandemie und die ansteckendere Delta-Variante erwartet der Ökonom eine weniger starke Auswirkung auf die Weltwirtschaft wie während der vergangenen Wellen der Pandemie. Wegen der fortgeschrittenen Impfkampagne könnten die Grenzen auch bei deutlich höheren Inzidenzen offengehalten werden und damit der Warenverkehr weiterlaufen.
„Ich rechne deshalb damit, dass wir im Herbst zwar neuerliche Einschränkungen erleben werden. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir uns wieder durch einen harten Lockdown quälen müssen wie im Winter 2020. Für Gastronomen, Hoteliers und den Einzelhandel wird der Schaden deutlich geringer ausfallen“, erklärte Felbermayr.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53428947-ifw-praesident-engpaesse-und-hoehere-preise-bei-weihnachtsgeschenken-015.htm
Stärkster Anstieg der Großhandelspreise seit 1981 – DJN, 12.7.2021
Die Preise im deutschen Großhandel sind im Juni um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ist das die höchste Steigerungsrate seit Oktober 1981. Damals waren die Großhandelspreise wegen der zweiten Ölkrise kräftig in die Höhe geschossen. Im Mai waren die Großhandelspreise um 9,7 Prozent und im April um 7,2 Prozent gestiegen.
Die hohen Steigerungsraten begründen sich zum Teil durch den Basiseffekt, eine Folge des sehr niedrigen Preisniveaus der Vorjahresmonate im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Im Vormonatsvergleich stiegen die Großhandelsverkaufspreise im Juni um 1,5 Prozent.
Den größten Einfluss auf die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat hatte im Juni der Preisanstieg im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen um 37,7 Prozent.
Besonders kräftige Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr gab es auch im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen mit einem Plus von 77,6 Prozent sowie mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (54,2 Prozent). Erheblich teurer wurden im Vorjahresvergleich auch Roh- und Schnittholz (48,4 Prozent) sowie Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (26,9 Prozent).
Niedriger als im Vorjahr waren die Preise im Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software (minus 3,7 Prozent) sowie mit Fischen und Fischerzeugnissen (minus 1,2 Prozent).
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53380947-staerkster-anstieg-der-grosshandelspreise-seit-1981-015.htm
Deutscher harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) lässt im Juni auf 2,1 Prozent Jahresrate nach – Nationaler Verbraucherpreisindex schwächt sich leicht auf 2,3 Prozent Jahresrate ab – DJN/dpa-AFX, 13.7.2021
Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni nachgelassen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI nur noch mit einer Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,4) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit – wie von Volkswirten erwartet – ihre vorläufige Schätzung vom 29. Juni. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,4 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.
Der HVPI ist die für die Europäische Zentralbank (EZB) relevante Inflationsmessgröße. Die EZB strebt mittelfristig 2 Prozent an. Trotz des Rückgangs dürfte der Höhepunkt des Inflationsanstiegs aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei 3 bis 4 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.
Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4 (Mai: 0,5) Prozent. Die jährliche Inflationsrate betrug 2,3 (2,5) Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten. Der Preisauftrieb schwächte sich nach fünf Monaten mit Tendenz nach oben jedoch erstmals wieder leicht ab.
Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich binnen Jahresfrist überdurchschnittlich um 3,1 Prozent. Die Preise für Energieprodukte lagen dabei mit einer Steigerung um 9,4 Prozent weiterhin deutlich über der Gesamtteuerung. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich unterdurchschnittlich um 1,2 Prozent.
Vor allem Sonderfaktoren heizen die Teuerung an. Seit Monaten steigen die Energiepreise überdurchschnittlich. Ein Grund ist ein sogenannter Basiseffekt: Vor einem Jahr waren die Rohölpreise mit Ausbruch der Corona-Krise wegen geringer Nachfrage auf dem Weltmarkt eingebrochen. Seither haben sie sich erholt. Zudem sind in Deutschland seit Januar 25 Euro je Tonne Kohlendioxid (CO2) fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Ein weiterer Preistreiber: Die 2020 für ein halbes Jahr gesenkte Mehrwertsteuer ist seit Januar wieder auf altem Niveau.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53391679-deutsche-hvpi-inflation-laesst-im-juni-nach-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53391645-deutschland-inflation-schwaecht-sich-leicht-auf-2-3-prozent-ab-016.htm
Hans Bentzien: IWF hebt deutsche BIP-Prognose 2022 auf +4,1% (bisher: +3,4%) an – DJN, 15.7.2021
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft im nächsten Jahr deutlich angehoben. Wie der IWF zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mitteilte, rechnet er für 2022 nun mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 4,1 Prozent. In seinem im April veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick hatte der IWF einen BIP-Zuwachs von nur 3,4 Prozent prognostiziert. Die Wachstumsprognose für 2021 von 3,6 Prozent wurde bestätigt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53420634-iwf-hebt-deutsche-bip-prognose-2022-auf-4-1-bisher-3-4-an-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): IMK: Konjunkturelle Erholung setzt sich fort – DJN, 15.7.2021
Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat eine dynamische Fortsetzung der konjunkturellen Erholung vorausgesagt. „Die Konjunkturampel steht auf Grün und signalisiert für das dritte Quartal eine dynamische Fortsetzung der konjunkturellen Erholung – nach dem coronabedingten Rückschlag im ersten Quartal des Jahres“, erklärte das gewerkschaftsnahe Institut. In seinem aktuellen Drei-Monatsausblick für Juli bis September weise das IMK eine Boomwahrscheinlichkeit von 61,3 Prozent aus.
Damit übertreffe die Wahrscheinlichkeit für ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum nunmehr den vierten Monat in Folge den entscheidenden Schwellenwert von 50 Prozent. Die Wirtschaftsleistung legt den Angaben zufolge zu, weil viele unter Corona-Bedingungen ausgesetzte Dienstleistungen wieder in Gang kommen. Hinzu komme ein Aufholeffekt beim privaten Verbrauch, der sich in den kommenden Monaten noch ausweiten dürfte.
Die Produktion in Industrie und Bauhauptgewerbe dürfte im Jahresverlauf auch weiter zunehmen, wenn Lieferengpässe bei Vorprodukten, insbesondere Halbleitern, und in der Folge hohe Rohstoff- und Materialkosten nicht mehr so stark dämpfend wirkten wie derzeit. Im Jahresverlauf dürfte der Einfluss der Lieferengpässe auf die Produktion abnehmen, sagte IMK-Konjunkturexperte Thomas Theobald. Darauf deute etwa der nach der Suez-Blockade vom März wieder deutlich gestiegene Containerumschlag hin.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland eine Rezession durchlaufe, sei im Vergleich zum Vormonat leicht auf 7,2 Prozent gestiegen. Sie bleibe aber auf historisch niedrigem Niveau. Maßgeblich für den leichten Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit sei neben einem geringfügigen Rückgang der Produktion im Produzierenden Gewerbe ein gemäßigter Anstieg der Finanzierungskosten von Unternehmen. Dagegen trage die Entwicklung der übrigen Stimmungs- und Finanzmarktindikatoren zu einem insgesamt niedrigen Niveau der prognostizierten Rezessionswahrscheinlichkeit bei.
Insgesamt stützen die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators laut IMK dessen Prognose, „dass der Aufschwung in Deutschland mit zunehmender Zahl geimpfter Personen an Breite und Stärke gewinnen wird“. Neben dem schon seit längerem sehr starken Außenhandel lege mit zunehmender Lockerung der Auflagen zum Infektionsschutz auch die Binnennachfrage deutlich zu. Die Düsseldorfer Ökonomen rechnen in ihrer aktuellen Konjunkturprognose für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53417316-imk-konjunkturelle-erholung-setzt-sich-fort-015.htm
Hans Bentzien: Commerzbank: Lockerungen und schwächerer Euro lässt Frühindikator Early Bird steigen – DJN, 12.7.2021
Der Frühindikator der Commerzbank für die deutsche Wirtschaft (Early Bird) ist im Juni um 0,04 Punkte auf 0,56 Punkte gestiegen, den höchsten Stand seit sechs Jahren. „Auftrieb bekam er insbesondere von einem schwächeren Euro, der das geringfügig schwächere weltwirtschaftliche Umfeld mehr als ausgeglichen hat“, schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einer Mitteilung. Damit signalisiere der Early Bird weiterhin, dass der wegen der Lockerung der Corona-Restriktionen in Gang gekommene Aufschwung auch durch die „klassischen“ Rahmenbedingungen kräftig unterstützt werde.
Laut Solveen ist der reale Außenwert einer fiktiven D-Mark derzeit nur noch geringfügig höher als vor einem Jahr. „Der zwischenzeitlich recht spürbare Gegenwind für die Konjunktur vom Devisenmarkt hat sich damit praktisch gelegt“, merkt der Ökonom an. Etwas verschlechtert hat sich demnach aber das weltwirtschaftliche Umfeld: Alle drei bei der Berechnung des Early Bird berücksichtigten Industrie-Einkaufsmanagerindizes – für die USA, für China und für den Euroraum (ohne Deutschland) – sind im Juni leicht gefallen. Keine spürbaren Veränderungen gebe es bei der Geldpolitik, die äußerst expansiv
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53382136-commerzbank-schwaecherer-euro-laesst-early-bird-steigen-015.htm
Andreas Kißler: HDE: Einzelhandelsumsatz wächst dieses Jahr um 1,5 Prozent – DJN, 14.7.2021
Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet ohne weitere Lockdowns und bei niedrigen Infektionszahlen für den gesamten Handel mit einem Umsatzwachstum von 1,5 Prozent. Wachstumstreiber bleibe dabei vor allem der Onlinehandel, der seine Umsätze 2021 demnach um fast 20 Prozent steigern kann. „Die positive Entwicklung in den letzten Wochen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das erste Halbjahr insbesondere für den Innenstadthandel verloren ist“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Extrem gelitten hat der Bekleidungseinzelhandel, dessen Erlöse um rund ein Drittel geschrumpft sein dürften.“
Die Lage im Einzelhandel ist nach Angaben des Verbandes weiterhin von den Geschäftsschließungen im Lockdown der vergangenen Monate geprägt. So zeige eine aktuelle Umfrage des HDE unter 650 Handelsunternehmen aller Standorte, Größenklassen und Branchen, „dass mehr als die Hälfte der Innenstadthändler für das laufende Jahr mit Umsätzen unter Vorjahr rechnet“. Demnach berichteten fast drei Viertel aller Handelsunternehmen von gesunkenen Umsätzen in den ersten sechs Monaten des Jahres.
Etwas weniger schlecht lief es laut der Konjunkturumfrage in Branchen, die im Bereich Freizeit, Heim und Garten aktiv sind. Dort lagen die Umsatzverluste in den ersten vier Monaten etwa im Bereich Heimwerken bei 16 Prozent, im Möbelhandel bei 12 Prozent. Einzelne Sortimente legten im bisherigen Jahresverlauf auch deutlich zu. Dazu zählen der Fahrradhandel und der Lebensmittelhandel. Große Umsatzgewinne erzielt demnach weiterhin der Onlinehandel. Der HDE hob angesichts eines Umsatzsprungs von rund 30 Prozent von Januar bis April seine Prognose für dieses Segment auf ein Umsatzplus von knapp 20 Prozent an, gegenüber bisher erwarteten plus 17 Prozent.
Für die kommenden Monate erwartet laut HDE eine Mehrheit aller Händler eine Fortsetzung des Erholungsprozesses. So rechneten 44 Prozent mit einer Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr, aber nur 17 Prozent mit sinkenden Erlösen. Der stationäre Einzelhandel büßt in dem Szenario des HDE für dieses Jahr 1,1 Prozent seiner Erlöse ein, der stationäre Nonfoodhandel allein landet dabei bei einem Minus von minus 4,2 Prozent, der Lebensmittelhandel wächst um 3,1 Prozent.
„Die Krise ist noch nicht vorbei, für viele Einzelhändler ist die Lage nach wie vor sehr schwierig“, betonte Genth. „Die Branche braucht jetzt die richtigen Rahmenbedingungen von der Politik, um nach der Krise wieder durchstarten zu können.“ Die Händler stellten dabei nach der HDE-Umfrage insbesondere Forderungen gegen neue Steuerlasten, für mehr Wettbewerbsfairness in der Plattformökonomie und Unterstützung für Innenstädte in den Vordergrund.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53405444-hde-einzelhandelsumsatz-waechst-dieses-jahr-um-1-5-prozent-015.htm
Deutscher Einzelhandelsumsatz für Mai nach oben revidiert – DJN, 13.7.2021
Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Mai stärker gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 4,6 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt ein Zuwachs von 4,2 Prozent gemeldet worden.
Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,2 Prozent niedriger.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53394724-deutscher-einzelhandelsumsatz-fuer-mai-nach-oben-revidiert-015.htm
Florian Kolf: Einzelhandel: Niedrige Margen, hoher Wettbewerbsdruck – Händler in der Onlinefalle –
Nicht zuletzt der Onlineboom in Corona-Zeiten zeigt: Investition ins Digitale ist ein Muss – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT
Der Wirtschaft hat die Corona-Pandemie einen deutlichen Schub bei der Digitalisierung gegeben. Dazu gehört auch, dass viele Menschen sich daran gewöhnt haben, online einzukaufen. Das Problem dabei: Der Bestellhandel ist längst nicht so lukrativ wie das traditionelle Geschäft.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/einzelhandel-niedrige-margen-hoher-wettbewerbsdruck-haendler-in-der-onlinefalle/27413680.html
Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand steigt im Mai – DJN, 15.7.2021
Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Mai gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 32.384 Wohnungen genehmigt. Das waren 8,7 Prozent mehr als im Vormonat. Für den Zeitraum Januar bis Mai ergab sich ein Anstieg um 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Mai 28.199 Wohnungen genehmigt. Dies waren 10,2 Prozent mehr als im Vormonat.
Während die Zahl genehmigter Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 11,4 Prozent deutlich stieg, waren es bei den Einfamilienhäusern nur 0,4 Prozent mehr als im April. Die Zahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser ging dagegen um 2,2 Prozent zurück. Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, ist sogar um 6,5 Prozent gesunken.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53415440-zahl-der-baugenehmigungen-in-deutschand-steigt-im-mai-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): VDMA: EU-Kommission darf Weg zu eFuels mit Wasserstoff-Motoren nicht verbauen – DJN, 12.7.2021
Der deutsche Maschinenbau mahnt vor der Veröffentlichung der Pläne der EU-Kommission zur Reduzierung von CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge vor einer zu starken Fokussierung auf die Elektrofahrzeuge. Ein zu enger regulatorischer Fokus würde den anderen CO2-neutralen Antriebsoptionen, wie etwa eFuels, den Weg verbauen. Der Transformationsprozess hin zur klimaneutralen Mobilität sei notwendig. Der Weg geht jedoch „durch ein Tal der Tränen“, auf dem im besten Falle mindestens 160.000 Arbeitsplätze im Antriebsstrang verlorengehen werden, warnte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Daher müsse auch die Wettbewerbsposition des Sektors gestärkt werden.
„Mit der Überarbeitung der CO2-Flottenregulierung für Autos hat die Europäische Kommission jetzt die große Chance, ein Zeichen für Technologieoffenheit im Bereich der Mobilität zu setzen“, erklärte Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA, mit Blick auf die am Mittwoch geplante Vorstellung der überarbeiteten CO2-Flottenregulierung für Autos durch die Kommission der Europäischen Union (EU).
Es stehe außer Frage, dass die Elektromobilität eine herausgehobene Rolle bei der Dekarbonisierung des Verkehrs spielen werde. „Es wäre allerdings ein grober Fehler, wenn die EU-Kommission jetzt mit einem viel zu engen regulatorischen Fokus anderen CO2-neutralen Antriebsoptionen, wie zum Beispiel dem Einsatz von eFuels, den Weg verbauen würde“, so Rauen.
Gerade für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, wie beispielsweise große mobile Maschinen, würde ein CO2-neutral betriebener Verbrennungsmotor noch lange „unersetzlich“ bleiben. Die EU-Kommission sollte daher ein freiwilliges Anrechnungssystem für eFuels in die CO2-Flottenregulierung für PKW und Nutzfahrzeuge integrieren, forderte der Verband.
Der VDAM mahnte zudem, dass Europa seine Wettbewerbsposition in den Wachstumsfeldern einer souveränen europäischen Batteriezellproduktion deutlich stärken müsse, und zwar im Bereich der Produktionstechnologien. „Es ist zu kurz gesprungen, diese Technologien zu importieren“, so der VDMA.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53383737-vdma-eu-kommission-darf-weg-zu-efuels-nicht-verbauen-015.htm
Franz Hubik: Elektromobilität Die Batterie-Lücke: Der Boom der Elektromobilität überfordert die Hersteller – Der Hochlauf der Stromauto-Produktion trifft auf Engpässe bei den Rohstoffen. Ab 2023 fehlen so Millionen Batteriezellen. Die Konzerne reagieren – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 14.7.2021
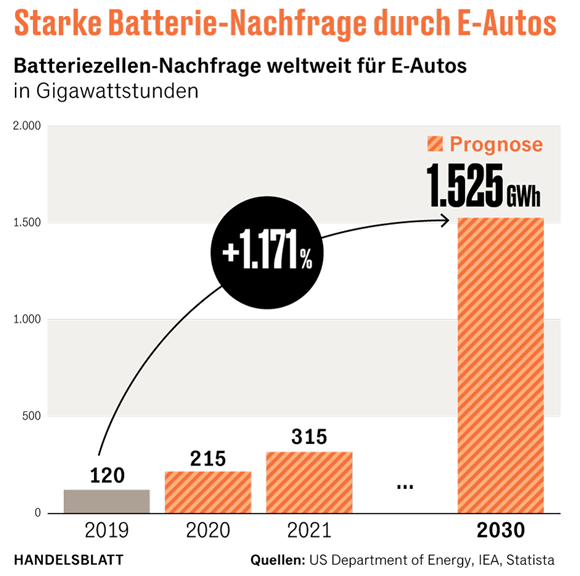
Die Werbefigur des rosa Duracell-Häschens, das immer noch trommelt, wenn andere Batterien längst schlapp gemacht haben, taugt nicht nur als Wappentier der EU-Kommission, sondern auch als Hoffnungsträger des neuen Energiezeitalters. Denn Batterien sind die neue Schlüsselressource der Elektromobilität – und diese Ressource wird absehbar knapp. Sehr knapp sogar: Laut einer Analyse des Center for Automotive Research (CAR) werden in den nächsten sechs Jahren weltweit Batteriezellen für fast 15 Millionen Neuwagen fehlen.
Grund dafür sind vor allem Engpässe bei Batterie-Basismaterialen wie Lithium, Kobalt und Nickel. Zudem kämpfen Zellhersteller mit den Tücken der Massenproduktion. Viele der geplanten „Gigafactories“ für Batteriezellen sind in Verzug. Thomas Schmall, Technikvorstand von Volkswagen hat die Sache mal durchgerechnet:
„Allein für Europa brauchen wir sechs neue Gigafactories bis zum Jahr 2030, für die gesamte Branche sind es ungefähr 30 Fabriken. Von jetzt an müssen also jedes Jahr drei neue Zellfabriken gebaut werden.“
In solchen Momenten sind jene Zeitgenossen im Vorteil, die an freie Märkte, Unternehmertum und technischen Fortschritt glauben – und daran, dass diese drei Faktoren das Batterieproblem schon irgendwie lösen werden. Als Liberaler ist man nicht immer im Recht, aber kann meistens gelassen bleiben.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/elektromobilitaet-die-batterie-luecke-der-boom-der-elektromobilitaet-ueberfordert-die-hersteller/27416038.html
Deutschland: Noch kein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen erkennbar – dpa-AFX, 13.7.2021
In der Corona-Pandemie ist ein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bisher ausgeblieben. „Auch als Effekt staatlicher Unterstützungen und des Aussetzens der Insolvenzantragspflicht setzte sich hingegen der langjährige Trend sinkender Insolvenzzahlen sogar verstärkt fort“, sagte Albert Braakmann, Leiter der Abteilung „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise“ am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung des Bundesamtes. Die Rückkehr der in der Pandemie ausgesetzten Insolvenzantragsplicht könne diesen Trend jedoch beenden.
Im Jahr 2020 war die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen mit 15 841 noch auf den niedrigsten Stand seit 1999 gefallen. Bisher hat sich diese Entwicklung fallender Zahlen im Jahr 2021 laut Destatis fortgesetzt.
Allerdings gilt die Insolvenzantragspflicht erst seit Mai 2021 wieder vollumfänglich. Für die Zeit nach April liegen Destatis nur vorläufige Zahlen der Amtsgerichte vor. Die bisherige Entwicklung spreche noch nicht für einen Anstieg der Insolvenzen, wohl aber für ein Abflachen der bisher nach unten zeigenden Kurve.
So hat die Zahl der Regelinsolvenzen im Juni laut den vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent abgenommen und auch im Vergleich zum Vormonat sei sie nur um gut zwei Prozent gefallen. Im April, also vor dem Auslaufen der Antragspflicht, hatte die Zahl der angemeldeten Unternehmensinsolvenzen noch um 9 Prozent unter dem Vorjahreswert und sogar 21 Prozent unter dem Wert für April 2019 gelegen. Die am stärksten betroffenen Branchen waren damals das Baugewerbe mit 215 und der Handel mit 195 Fällen
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53394797-deutschland-noch-kein-anstieg-der-unternehmensinsolvenzen-erkennbar-016.htm
Ausgesetzte Insolvenzanstragspflicht: Insolvenzen in Deutschland weiter unter Vorjahresniveau – DJN, 13.7.2021
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im April weiter von der teilweise ausgesetzten Insolvenzantragspflicht beeinflusst gewesen. In diesem Monat haben die deutschen Amtsgerichte 1.333 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 9,0 Prozent weniger als im April des Vorjahres.
Ein Grund für die niedrige Zahl beantragter Unternehmensinsolvenzen ist die ausgesetzte Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen bis Ende 2020, wie Destatis erläuterte. Das Wiedereinsetzen der Antragspflicht zeigt sich damit noch nicht in den Ergebnissen für den April 2021.
Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im April im Baugewerbe mit 215 Fällen. Im Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) waren es 195 Verfahren. Im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen wurden 142 Insolvenzen gemeldet.
Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte für April auf rund 2,5 Milliarden Euro.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53391776-insolvenzen-in-deutschland-weiter-unter-vorjahresniveau-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): Ifo-Institut nennt Anpassung des Klimaschutzgesetzes „überhastet“ – DJN, 13.7.2021
Die Bundesregierung sollte nach Einschätzung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in der kommenden Legislaturperiode beim Bundesklimaschutzgesetz nochmals nachbessern. „Morgen wird die EU ihr Fit-for-55 Paket veröffentlichen. Daraufhin könnte eine erneute Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes nötig sein“, erklärte die Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcensagte, Karen Pittel. „Die Reform des Klimaschutzgesetzes war überhastet.“ Deutschland hätte die europäische Klima- und Energiepolitik stärker in den Fokus nehmen müssen, monierte Pittel.
Derzeit werde die Einführung eines zweiten effektiven Emissionshandels für Wärme und Verkehr auf EU-Ebene diskutiert. „Sollte er in Kraft treten, macht die Festlegung auf jahresgenaue Emissionsziele für einzelne Wirtschaftssektoren in Deutschland wenig Sinn, da sich sektorale Emissionsminderungen dann als Ergebnis von Angebot und Nachfrage auf europäischer Ebene ergeben“, heißt es in einem Aufsatz der Ifo-Forscherin. Die Sektorenziele seien zudem nur wenig zielführend für nachhaltigen Klimaschutz. Bei einer Revision solle der Gesetzgeber die Sektorenziele „komplett abschaffen oder wenigstens durch Korridore für sektorale Emissionsminderungen ersetzen“.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53393201-ifo-institut-nennt-anpassung-des-klimaschutzgesetzes-ueberhastet-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): BDI: EU sollte Pläne für Digitalsteuer dauerhaft beerdigen – DJN, 13.7.2021
Die Europäische Union sollte nach Ansicht der deutschen Industrie ihre Pläne für die Einführung einer Digitalsteuer nicht nur bis zum Herbst zurückzustellen, sondern dauerhaft beerdigen. „Die Einigung der G20-Finanzminister im OECD-Projekt zur Besteuerung der Digitalisierung der Wirtschaft macht eine einseitige europäische Sondersteuer obsolet. Auch Frankreich, Italien und Spanien sind gefordert, ihre Digitalsteuern zurückzunehmen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang.
Am Montag hat die EU die Pläne für eine Digitalsteuer vorläufig zurückgestellt, nachdem sich die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im Grundsatz auf die Einführung einer globalen Mindeststeuer von mindestens 15 Prozent verständigt hatten. Insgesamt stehen rund 130 Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hinter der Mindeststeuer. Die Details sollen noch bis zum Herbst ausgearbeitet werden.
Die Einigung auf eine globale Mindeststeuer beabsichtigt, unilaterale Digitalsteuern und damit eine Doppelbelastung von Unternehmen zu vermeiden, erklärte der BDI. „Die Politik darf Zukunftsbranchen und Innovationen durch eine Sondersteuer nicht im Keim ersticken“, warnte Lang. „Eine EU-Digitalsteuer läuft Gefahr, schwerwiegende internationale Handelskonflikte mit Drittstaaten nach sich zu ziehen.“ Die US Regierung sieht eine Digitalsteuer kritisch, da sie hauptsächlich amerikanische Digitalkonzerne treffen würde, wie etwa Amazon, Facebook und Google.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53395590-bdi-eu-sollte-plaene-fuer-digitalsteuer-dauerhaft-beerdigen-015.htm
Andreas Kißler, Andrea Thomas (Mitarbeit): Scholz dringt auf schnelle Verständigung zu Details einer Mindeststeuer – Verschiebung des EK-Vorschlags zur Digital-Abgabe begünstigt Einführung einer globalen Mindeststeuer – Rasche Boosterung der Wirtschaft wahrscheinlich: viele Aufbaupläne von EU-Staaten bereits von der Kommission akzeptiert – DJN, 12.7.2021
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor Beratungen der Euro-Finanzminister eine rasche Verständigung auf die Einzelheiten einer globalen Mindeststeuer angemahnt, auf deren Einführung sich die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) geeinigt hatten. „Wir haben nun in vielen, vielen Gremien Verständigung herbeigeführt“, bei den Finanzministern der G7-Staaten, im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und am Wochenende bei dem G20-Treffen“, sagte er in Brüssel vor dem Treffen der Eurogruppe.
„Das ist eine gute Situation.“ Jetzt geht es darum, in Europa diese Schritte fortzusetzen und dazu beizutragen, dass es schnell eine Verständigung über die letzten Details geben kann, sagte Scholz.
Die Entscheidung der EU-Kommission, anders als geplant zunächst ihren Vorschlag für eine Digitalabgabe ruhen zu lassen, nannte Scholz in diesem Kontext „ein Zeichen, dass wir wirklich den Fortschritt machen, um eine globale Vereinbarung zu bekommen“.
EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärte, er habe US-Finanzministerin Janet Yellen, die an der Tagung teilnimmt, „über unsere Entscheidung informiert, den Vorschlag der Kommission für eine Digitalabgabe auf Eis zu legen“. Ziel sei es, konzentriert Hand in Hand zu arbeiten, „um die letzte Meile dieser historischen Vereinbarung zu erreichen“.
Die Finanzminister der Eurogruppe wollen mit Yellen bei der Tagung über die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie beraten. Außerdem soll es um Banken- und Finanzstabilität gehen. Im Vorfeld war befürchtet worden, dass eine Debatte um die Einführung der Digitalabgabe kontrovers werden könnte, die die USA ablehnen. Die geplante globale Mindeststeuer wiederum sehen innerhalb der EU etwa Staaten wie Irland und Estland noch kritisch.
Scholz erklärte, zur Corona-Krise sei Thema, dass viele Aufbaupläne von EU-Staaten bereits von der Kommission akzeptiert worden seien. „So kann das Geld dann schnell dazu beitragen, dass die Wirtschaft wieder wächst“, sagte er.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53385596-scholz-dringt-auf-schnelle-verstaendigung-zu-details-einer-mindeststeuer-015.htm
Rekordwert : Geldvermögen der Deutschen steigt erstmals über Sieben-Billionen-Schwelle – Fondsbeteiligungen „so viel wie nie zuvor“: Börsenengagement nimmt 2021Q1 weiter zu – Privatverschuldung wächst weniger stark als der Vermögenszuwachs – Frankfurter Allgemeine Zeitung/Reuters, 16.7.2021
Die Deutschen werden trotz Corona-Krise immer reicher. Im ersten Quartal 2021 nahm das Geldvermögen der Privathaushalte um 192 Milliarden Euro auf den neuen Rekordwert von 7,14 Billionen Euro zu, wie die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zum ersten Mal wurde damit die Schwelle von sieben Billionen Euro übertroffen. Hinter dem Zuwachs stehen insbesondere Kursgewinne bei Aktien und Investmentfonds. Wie sich das Geldvermögen in der Bevölkerung verteilt, lässt sich an den Zahlen allerdings nicht ablesen.
Bargeld und Bankeinlagen, die für Privathaushalte schnell verfügbare Mittel sind, nahmen im Auftaktquartal des Jahres um 47 Milliarden Euro zu. Das ist etwas weniger als im vorangegangenen Quartal. Die Ansprüche gegenüber Versicherungen erhöhten sich um 27 Milliarden Euro. „Insgesamt lässt sich bei privaten Haushalten nach wie vor eine ausgeprägte Präferenz für liquide oder als risikoarm wahrgenommene Anlageformen feststellen“, erklärte die Bundesbank.
Allerdings nahm auch das Engagement an der Börse im ersten Quartal weiter zu. Beliebt waren insbesondere Investmentfonds. Die Haushalte erwarben für 25 Milliarden Euro Anteile an solchen Fonds. Das war laut Bundesbank so viel wie nie zuvor. Bei den Aktien wurde vor allem in inländische Unternehmenstitel investiert. Kursgewinne an den Finanzmärkten sorgten für viel Schub – insgesamt 63 Milliarden Euro betrug der Zuwachs des Geldvermögens durch Bewertungsgewinne. Die Verschuldung der Haushalte nahm um 17 Milliarden Euro auf 1,98 Billionen Euro zu.
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/geldvermoegen-der-deutschen-steigt-auf-rekordwert-17440623.html
SIEHE DAZU:
=> Über 7 Billionen Euro Erspartes Die Deutschen werden immer reicher – n-tv, 16.7.2021
QUELLE (mit weiterführenden Links): https://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-Deutschen-werden-immer-reicher-article22686709.html
ÖSTERREICH
- STATISTIK
Regionaler Außenhandel 2020: starke Rückgänge für fast alle Bundesländer
Baukosten im Juni 2021 weiter gestiegen
Inflation bleibt im Juni 2021 bei 2,8%
(*) Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, stieg im Jahresvergleich um 1,5% (Mai: +2,8%).
(*) Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand um 5,8% (Mai: +6,6%).
Rekordwert bei Baubewilligungen im 1. Quartal 2021; hohe Wohnbautätigkeit im Jahr 2020
Pkw-Gebrauchtzulassungen im 1. Halbjahr 2021 um ein Sechstel gestiegen
Anzahl der unter Dreijährigen in Kindertagesheimen stieg binnen zehn Jahre um 77,0%
QUELLE: https://www.statistik.at
- MELDUNGEN
Anti-Geldwäschepläne der EU-Kommission: Österreich gegen EU-Obergrenze für Bargeldzahlungen – Der ÖVP-Politiker bewertet EU-Pläne zur Geldwäschebekämpfung skeptisch. Mit Frankfurt als Sitz der neuen Geldwäschebehörde fremdelt er – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.7.2021
Österreichs Regierung unterstützt die Pläne der EU-Kommission zur Gründung einer Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung, hält aber wenig von einer Obergrenze für Bargeldtransaktionen: „Wir lehnen eine generelle Obergrenze und damit eine De-facto-Kriminalisierung von Bargeld ab“, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag in Wien. Bares gebe den Menschen ein Gefühl von Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit. „Diese Freiheit wollen wir den Menschen bewahren.“
Das Meinungsbild der Österreicher zur Begrenzung von Bargeldzahlungen ist allerdings weniger eindeutig, wie eine vom Ministerium vorgestellte Befragung zeigt. Scheine und Münzen spielen trotz Werbung für Kartenzahlungen eine große Rolle. „Eigentlich hat die Pandemie an der Einstellung und dem Verhalten zum Bargeld relativ wenig verändert“, sagt Meinungsforscher Peter Hajek. Bezüglich Obergrenzen der Bargeldzahlung sind die Leute unsicher: 47 Prozent sind skeptisch, 35 Prozent hielten sie für begrüßenswert, der Rest hat keine Meinung. Allerdings können 44 Prozent der Skeptischen ihre Haltung nicht begründen.
Hajek führte das darauf zurück, dass das Thema derzeit nicht breit debattiert werde. Auf die Frage, ob die „Möglichkeit zur Bargeldhaltung erhalten“ bleiben solle, antworteten die allermeisten zustimmend, nur in der Gruppe der unter 30-Jährigen waren 14 Prozent „weniger“ oder „gar nicht dafür“. Zur politischen Begründung taugt die Frage indes wenig, ist die Abschaffung der Bargeldzahlung auch in Brüssel kein Thema.
*** Kommission plant 10.000 Euro ***
Blümels Auffassung ist indes klar. Er bezweifelt, dass eine generelle Obergrenze für Zahlungen mit Bargeld – die Kommission plant dies ab 10.000 Euro – sinnvoll ist und hilft, illegale Geschäfte besser zu bekämpfen. Jüngste Entwicklungen der Cyber- und Computerkriminalität zeigten, dass Verbrecher mehr auf Digitalwährungen setzten: „Da müsste man den Kryptobereich wesentlich stärker regulieren.“ Außerdem gebe es auch in Österreich in sensiblen Geschäftsbereichen bereits Obergrenzen für die Begleichung von Rechnungen mit Bargeld. Auf dem Bau gelte seit 2016 eine Höchstgrenze von 500 Euro; in anderen als sensibel angesehenen Sektoren, wie beim anonymen Kauf von Gold, beginnt sie bei 10.000 Euro.
Blümel begründete die Beibehaltung des heutigen Regimes so: Bargeld biete finanzielle Sicherheit auch im Falle eines Ausfalls der digitalen Bankinfrastruktur. Das Argument „geprägte Freiheit“ dürfe auch nicht außer Acht gelassen werden. Mit Beginn der Pandemie habe sich dessen Stimmigkeit bewahrheitet, als die Menschen vermehrt Bargeld gehortet hätten. Nicht zuletzt könne das Halten von Bargeld „die letzte Barriere gegen ausufernde Negativzinsen“ sein, um zu verhindern, dass das Gesparte noch schneller an Wert verliere. Jedoch schränkte der Minister dieses Argument insoweit ein, als er ihm voranstellte, es sei ein „eher volkswirtschaftlich-theoretisches“.
In 18 der 27 EU-Staaten bestehen Obergrenzen für das Bezahlen mit Bargeld. Sie reichen von 500 Euro in Griechenland bis 15.000 Euro in Kroatien. In den anderen neun Ländern, auch Deutschland, gibt es kein Limit. In der Frage, wo die Antigeldwäschebehörde angesiedelt werden solle, hatte Blümel sich schon gegen Frankfurt ausgesprochen. Es sei „kein Automatismus“, dass sie in einem großen Finanzzentrum angesiedelt werde. Er warb für einen Standort in der Eurozone, „an dem man sich aber auch gut genug in jenen Ländern auskennt, die noch nicht im Euroraum sind“. Klang ganz nach Wien.
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oesterreich-gegen-eu-obergrenze-fuer-bargeldzahlungen-17439461.html
Öffnung der Hotellerie führt zu raschem Anstieg der Nächtigungen von Inländern im Juni 2021 – Inländische Gäste überwiegen – Im Vergleich zu 2019 Nächtigungseinbußen: Inländer minus 3, Ausländer minus 61, alle minus 41 Prozent – Zahlungskartendienstleister: internationaler Tourismus leidet weiter stark, ausgenommen Deutschland und Schweiz, größeres Minus bei kontinentaleuropäischen Touristen und Überseetouristen (USA!) – Totalausfall der Touristen aus China – OeNB, 13.7.2021
Die auf Basis von Zahlungsdienstleistungsanbietern erhobenen Ausgaben im Reiseverkehr zeigen bereits im Juni eine deutliche Zunahme der Umsätze in der Hotellerie. Diese geht vor allem auf die Ausgaben von inländischen Gästen zurück, aber auch ausländische Gäste frequentierten vermehrt Österreichs Tourismusbetriebe. Umgelegt auf die Übernachtungen im Juni – diese werden von Statistik Austria erst Ende Juli in einer Erstabschätzung veröffentlicht – schätzt die OeNB, dass im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Jahr 2019 die Übernachtungen von Inländern um 27 % gestiegen bzw. 3 % gefallen, jene der Gäste aus dem Ausland um 58 % gestiegen bzw. 61 % gefallen sind. Die gesamten Übernachtungen im Juni verzeichnen den Schätzungen zufolge im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 42 %; im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 kam es jedoch zu einem erheblichen Rückgang von 41 %.
Obwohl die Infektionszahlen in Europa und den USA in den letzten Wochen rückläufig waren, bestätigen die Umsätze der Zahlungskartendienstleister, dass der internationale Tourismus weiterhin stark unter den Folgen der COVID-19-Pandemie leidet. Hierbei zeigen sich große Unterschiede bei den internationalen Tourismusströmen. Während die Ausgaben von Urlaubern aus Deutschland – dem wichtigsten Herkunftsland für den österreichischen Tourismus – im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 in den letzten Wochen im Durchschnitt ein kleines Plus verzeichnen konnten, und die Ausgaben von Schweizer Gästen deutlich zunahmen, liegen die Rückgänge gegenüber den anderen kontinentaleuropäischen Ländern zwischen einem Viertel und der Hälfte. Gegenüber Herkunftsländern aus Übersee steigt der Rückgang auf rund zwei Drittel (USA) bis hin zu einem weiterhin bestehenden Totalausfall (China).
QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20210713.html
MEINUNGEN und KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER
Soziologe Wolfgang Streeck: EU will Regimewechsel in Polen und Ungarn – Aussage reizt: Nationalstaat ist die als einzige Institution, die Komplexität der Weltgesellschaft zerlegen und demokratisch regierbar macht – Plädoyer für einen genossenschaftlich-kooperativen statt imperial-hierarchischen europäischen Staatenverbund – dts Nachrichtenagentur, 16.7.2021
Der Kölner Soziologe Wolfgang Streeck kritisiert das Vorgehen der EU gegen Polen und Ungarn. „Aktuell gibt es die Bestrebungen des Zentrums, in Polen und Ungarn durch Entzug oder Kürzung der EU-Zuschüsse einen Regimewechsel herbeizuführen“, sagt der frühere Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in der aktuellen Ausgabe des „Spiegel“.
„Das Problem ist, dass diese Regierungen demokratisch gewählt sind.“ Es frage sich, ob es die Aufgabe der Staatengemeinschaft sei, die innerstaatlichen Konflikte etwa in Ungarn zu entscheiden. Streeck, der einst die rot-grüne Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder beriet, kann der neuen Allianz rechtspopulistischer Parteien in Europa auch positive Züge abgewinnen. „Grundsätzlich würde es der EU nicht schaden, wenn in ihrem Parlament die strategischen Fragen ihrer weiteren Entwicklung endlich diskutiert würden“, sagt Streeck.
„Ich bin der Auffassung, dass die EU schon jetzt übervereinheitlicht ist und daran scheitern wird.“ Der Soziologe plädiert dafür, das europäische Staatensystem wieder stärker auf Nationalstaaten zu gründen. „Der Nationalstaat ist die einzige Institution, die die Komplexität der Weltgesellschaft zerlegen und sie demokratisch regierbar machen könnte“, sagt er im „Spiegel“. Er verstehe nicht, warum die selbst ernannten Europäer immer in Schnappatmung verfielen, wenn sie das hörten.
„Ich plädiere, freilich ohne viel Hoffnung, für eine genossenschaftlich-kooperative statt imperial-hierarchische Ordnung des europäischen Staatensystems“, sagt Streeck.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53433658-soziologe-eu-will-regimewechsel-in-polen-und-ungarn-003.htm
SIEHE DAZU:
=> Lemma „Wolfgang Streeck (* 27. Oktober 1946 in Lengerich) ist ein deutscher Soziologe und Direktor emeritus am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln“ – WIKIPEDIA, Abruf 17.7.2021
QUELLE: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Streeck
Regine Seipel: Interview mit Tourismusforscher Steinecke: Dark Tourism an Schauplätzen des Schreckens: Gänsehaut inklusive – Schauplätze des Schreckens wie KZ-Gedenkstätten ziehen viele Menschen an. Ist das verwerflich? Tourismusforscher Albrecht Steinecke über die dunkle Seite des Reisens – Franfurter Rundschau, 9.7.2021
Herr Steinecke, immer mehr Menschen besichtigen Orte, die erschauern lassen. Was wollen Reisende an Schauplätzen des Leids?
Die Urlauber werden immer reiseerfahrener, auch international. Sie haben daher ein Bedürfnis nach Erlebnissen und Eindrücken jenseits der ausgetretenen Pfade. Sie suchen nach neuen ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten.
Sind Sensationsgier und morbide Lust das vorherrschende Motiv?
Das ist ein Vorurteil gegen diesen so genannten Dark Tourism. In einer Fülle von Studien ist längst klar geworden, dass Voyeurismus oder auch Schadenfreude eine zu vernachlässigende Rolle spielen. Man will vor allem einmal selbst an Orten stehen, an denen schreckliche Ereignisse passiert sind oder Menschen grausame Schicksale erlitten haben. Darüber hinaus geht es aber um Informationen über die Geschehnisse und um Gedenken an die Opfer, also durchaus seriöse Motive. Und es hat sich gezeigt, dass auch bei Menschen, die aus reiner Neugier kommen, eine Art Katharsis passiert, weil sie vor Ort von dem Leid berührt werden und diese dunklen Orte anders verlassen, als sie sie betreten haben.
Was bedeutet Dark Tourism, also dunkler Tourismus, genau?
Dieser Begriff umfasst alle Formen von dissonanten Sehenswürdigkeiten oder Reisearten, die nicht zum Standardrepertoire von Besichtigungszielen gehören. Im Wesentlichen gehören dazu KZ- und Genozid-Gedenkstätten, Friedhöfe, Gefängnisse, Schlachtfelder oder auch Schauplätze von Naturkatastrophen. Der Dark Tourism ist eigentlich Teil des Kulturtourismus, und da wie dort existiert eine ausgeprägte Hierarchie von Sehenswürdigkeiten. Besuchermagneten sind vor allem das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau mit 2,2 Millionen Besuchern jährlich, das Peace Memorial Museum in Hiroshima mit 1,5 und der Friedhof Père Lachaise in Paris mit 3,5 Millionen Besuchern.
*** Dark Tourism umfasst alle Formen von dissonanten Sehenswürdigkeiten ***
Der Katastrophentourismus zählt auch dazu. Tschernobyl entwickelt sich zum Beispiel zum gefragten Reiseziel. Geht es dabei auch um Abenteuerlust?
Am Anfang schon. Wir sprechen von einem Erinnerungslebenszyklus. Im Fall der Geisterstadt Prypjat kamen zunächst die Urban Explorers, also risikobereite Leute. In der Anfangsphase gibt es an solchen Orten zudem häufig spontane Trauer von Angehörigen, Freunden, dann entstehen Interessengruppen, die sich für eine Institutionalisierung des Gedenkens einsetzen, es werden Informationszentren und Erinnerungsstätten errichtet. Mit zunehmender Dauer verändern die Erinnerungsorte ihre Funktion. Die Schrecken verfliegen, wie man beispielsweise am Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald sehen kann. Es erinnert ja eigentlich an die Varusschlacht im römischen Reich, ist heute aber nur noch ein beliebtes Ausflugsziel.
Und Tschernobyl steht am Beginn dieser Entwicklung?
Ja, aber es werden bereits eine Fülle von Touren zu dem Gelände angeboten, und das wird noch zunehmen. Ich war selbst vor einigen Jahren da, es ist beeindruckend, eine tickende Zeitbombe. Bei vielen dunklen Orten liegen die Ereignisse hingegen schon lange zurück.
Dark Tourism ist kein neuzeitliches Phänomen. Wie sahen die historischen Formen aus?
Zu den Vorläufern gehören die römischen Gladiatorenkämpfe und öffentliche Hinrichtungen vom frühen Mittelalter bis in die Neuzeit, die ja oft Volksfestcharakter hatten. Und natürlich die Leichenschauhallen, allen voran La Morgue in Paris, wo Wasserleichen aus der Seine öffentlich präsentiert wurden, um die Identifikation zu ermöglichen. Sie wurde früh als Ziel in Reiseführern beschrieben und hat sich schon im 19. Jahrhundert zu einer touristischen Attraktion entwickelt.
*** „Wenn Leute zum Beispiel in Auschwitz Selfies machen, sind sicherlich Grenzen erreicht.“ ***
Seit wann beschäftigt sich die Tourismusforschung mit dem Thema?
Das Phänomen gibt es schon sehr lange, aber es hat erst in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, weil immer mehr Urlauber solche Schauplätze besichtigen und sich teilweise auch die Orte selbst so positionieren, um damit Einnahmen zu erzielen, aber auch um politische und moralische Botschaften verkünden zu können.
Bei Stätten des Leids und Schreckens, wie insbesondere KZ-Gedenkstätten, stehen Erinnerung, Trauer und Aufklärung im Vordergrund, bei anderen wie etwa manchen Gefängnismuseen zählt eher der Gruselfaktor. Gibt es eine moralische Wertung der Ziele?
Für mich als Wissenschaftler nicht. Das sind unterschiedliche Kategorien in einem Dunkel-Hell-Spektrum. Interessant ist, dass sich mit zunehmender Dauer die Besucherstruktur ändert. Zu den ehemaligen Konzentrationslagern reisten zunächst überwiegend Überlebende und Angehörige der Opfer. Heute besichtigen Besucher diese Stätten oft ohne persönlichen Bezug, sondern aus historischem Interesse und um der Opfer zu gedenken. Und manchmal entstehen dann Verhaltensweisen, an denen zu Recht Anstoß genommen wird. Wenn Leute zum Beispiel auf den ikonenhaften Schienen in Auschwitz balancieren und Selfies machen, sind sicherlich Grenzen erreicht.
Und wenn Menschen in Flutgebiete oder in von Erdbeben zerstörte Landstriche reisen?
Das erscheint auf den ersten Blick auch moralisch verwerflich, beispielsweise gab es nach den großen Überschwemmungen in New Orleans relativ früh Bustouren durch die zerstörten Stadtteile. Aber die wenigen Studien, die dieses Thema untersucht haben, ergaben, dass diese Gäste durchaus auch Mitleid oder Empathie empfanden und hinterher spendeten. Und nach dem Erdbeben im italienischen L’Aquila waren die Einwohner zwar zunächst entsetzt über die Katastrophentouristen, haben dann aber erkannt, dass diese auch Geld bringen und auf die Not aufmerksam machen. So entstand Druck auf politische Entscheidungsträger, den Wiederaufbau voranzutreiben. Der Katastrophentourismus ist aber ohnehin nur ein Randbereich des Dark Tourism.
*** Für weinende Touristen: Am Ground Zero in New York gibt es Taschentuchspender ***
Der Schwerpunkt sind Gedenk- und Erinnerungsstätten. Manche – wie etwa das 9/11-Memorial in New York – setzen stark auf dramatische Inszenierung. In New York gibt es sogar extra Taschentuchspender, weil man davon ausgeht, dass die Besucher weinen. Ist solche emotionale Ansprache sinnvoll?
Das ist eine ungeklärte Frage. Beispiele aus den USA, Mittel- und Osteuropa und Asien zeigen, dass die Verantwortlichen dort eher auf emotionale Überwältigung setzen. In deutschen Gedenkstätten steht hingegen die sachliche Information im Vordergrund.
Als touristische Ziele stehen die Orte des Schreckens gegenseitig in Konkurrenz. Führt das dazu, dass sich spektakuläre Präsentationen gegenseitig überbieten müssen?
Nein, es geht eher um die Frage, wie neue Kommunikations- und Informationstechniken genutzt werden sollten, um beispielsweise auch die Generation der Digital Natives anzusprechen, die ein Bedürfnis nach anschaulicher, lebendiger und berührender Informationsvermittlung haben. Wie weit man diesem entgegenkommt, ist eine Gratwanderung.
Besteht die Gefahr, dass mit zunehmendem Tourismus das Leid solcher dunklen Orte trivialisiert wird?
Das lässt sich nicht gänzlich verhindern. Die Verantwortlichen der Einrichtungen haben ja nur im Bereich der Erinnerungsstätten die Kontrolle. Auswüchse beispielsweise mit T-Shirt- und Souvenirverkauf und manchen Schrecklichkeiten siedeln sich eher im Umfeld an. Das kann man zum Beispiel in Alcatraz, der berühmten Gefängnisinsel in San Francisco, beobachten, wo an der Fisherman’s Wharf teils bizarre Souvenirs verkauft werden, obwohl am Ort selbst sachlich informiert wird. Unabhängig von Kitsch und Geschmacksdiskussionen muss man aber auch sehen, dass die meisten Menschen ein Bedürfnis haben, sich ein Erinnerungsstück mitzunehmen, wenn sie einen Ort besichtigt haben, deswegen werden diese Produkte ja angeboten.
„Eine Art Katharsis“: Plymouth, Karibikinsel Montserrat, 1997 vom Vulkanausbruch zerstört.
Auschwitz verzeichnet inzwischen mehr Besucher als Neuschwanstein. Und das Gedenken an den Atombombenabwurf hat sich in Hiroshima zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Wo sind die Grenzen der Vermarktung?
Die sind schwer zu ziehen. Wichtig ist, dass immer ein Rückbezug auf den Inhalt und die Opfer passiert. Aber Trivialisierungserscheinungen sind einfach nicht zu vermeiden, weil durch den touristischen Konsum vielerlei Begehrlichkeiten bei anderen Anbietern und Produzenten entstehen. Damit werden Arbeitsplätze geschaffen und Einnahmen erzeugt. Tourismus ist eben eine wichtige Wirtschaftsbranche.
Gilt das auch für den Slumtourismus, der bei Fernreisenden immer beliebter wird?
Er zählt zu den problematischen Formen des Dark Tourism. Der Markt wächst in Asien, Afrika und Südamerika, mit Obdachlosentouren teilweise auch in Europa, und ist sehr umstritten. Die Kernfrage ist, ob die lokale Bevölkerung profitiert oder nur Schauobjekt bleibt und das Geld an externe Unternehmen abfließt. Bisher kommen Studien speziell aus Südafrika zu dem Ergebnis, dass solche Angebote eher nicht den Menschen in den Townships zugute kommen. Sie haben gar nicht das nötige Knowhow und Kapital zur Organisation und Vermarktung der Touren.
Was zieht Touristinnen und Touristen in die Slums?
Einerseits wollen sie sich von Durchschnittstouristen unterscheiden, die nur die gängigen Sehenswürdigkeiten besichtigen, und fühlen sich deswegen gut. Andererseits wollen sie wirklich einen Eindruck der Lebensverhältnisse gewinnen, wobei es ja zur Konzeption der Touren gehört, dass eher positive Seiten wie etwa Sozialprojekte und Kindergärten gezeigt werden. Damit wird die prekäre Situation der Menschen oft nicht angemessen abgebildet.
*** Dark Tourism: Das Geschäft mit der Angstlust als kommerzieller Randbereich ***
Die Armut wird stattdessen in geschmacksverträglicher Dosis vorgeführt.
Ja. Aber die Frage, wer profitiert, ist ja ein Grundproblem des Tourismus.
Einige dunkle Orte entsprechen gar nicht mehr ihrer eigenen Geschichte, sondern werden nach ihrem medialen Bild wahrgenommen, das in Filmen, Serien oder Computerspielen geprägt wird. Wie ist das zu erklären?
Man spricht in diesen Fällen von hyperrealen Orten, an denen sich historisches Geschehen mit medialen Bildern mischt und eine Art neuer Realität entsteht. Da droht der authentische Charakter in den Hintergrund zu rücken. Ein extremes Beispiel ist das ehemalige jüdische Viertel in Krakau, in dem der Film „Schindlers Liste“ gedreht wurde. Der Wunsch, dieses Ghetto zu besuchen, hat einen Tourismus ausgelöst, durch den eine neojüdische Welt mit koscheren Restaurants, Klezmermusik und Museen entstanden ist, obwohl in dem Viertel gar nicht der authentische Standort des Ghettos war.
Manchmal wird der Schrecken auch zum reinen Freizeitspaß. In Gruselerlebniswelten können Gäste den Kopf in die Guillotine stecken oder sich in Folterkammern herumtreiben. Was halten Sie davon?
Dieses Geschäft mit der Angstlust sehe ich als kommerziellen Randbereich. Bei vielen Anbietern gibt es – wenn auch vereinfacht – Bezüge zur Stadtgeschichte, manche Besucher sagen, dass sie trotz der rudimentären Informationen etwas gelernt haben. Man kann diese Angebote daher nicht nur als banale Attraktionen abtun. Aber ob sie überhaupt zum Dark Tourismus gehören, wird von einigen Kolleginnen und Kollegen bestritten.
Touristen tragen mit Dark Tourism zur Finanzierung historischer Einrichtungen bei
Vorstellbar sind noch schlimmere Szenarien. In Dystopien in Literatur und Film werden perverse Auswüchse des Dark Tourism bis hin zur Menschenjagd beschrieben. Beschäftigen Sie sich damit?
Solche Warnungen vor politischen, gesellschaftlichen oder ökologischen Fehlentwicklungen sind immer Mahnungen, es nicht so weit kommen zu lassen. Für die Tourismuswissenschaft ist das noch kein Thema. Dark Tourism steht derzeit vor anderen Herausforderungen.
Welche sind das?
Mancherorts tut sich die Tourismusbranche schwer, die tatsächlich existierenden dunklen Orte in ihr Produktspektrum zu integrieren. Dieses dissonante kulturelle Erbe scheint nicht zum angestrebten Image einer „heilen“ Urlaubswelt zu passen. Das ist ein zwiespältiges Thema, denn auch viele Verantwortliche von dunklen Orten stehen der touristischen Erschließung skeptisch gegenüber, weil sie eine Trivialisierung befürchten. Zahlreiche dieser Besuchermagneten entwickelten sich, obwohl weder die Destinationen noch die Verantwortlichen in den Gedenkstätten dafür geworben haben. Touristen haben halt immer ein schlechtes Image. Trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass sie auch zur Finanzierung der Einrichtungen beitragen.
Dark Tourism: Wichtig, unterschiedliche Sichtweisen von Interessengruppen darzustellen
Wie wird sich dieser Konflikt künftig lösen lassen?
Bei der Konzeption von Erinnerungsorten ist es wichtig, unterschiedliche Sichtweisen von Interessengruppen darzustellen und die Opfer und die Bevölkerung angemessen zu beteiligen. Wenn Orte ein Millionenpublikum anziehen, müssen außerdem immer auch die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Konsequenzen mitberücksichtigt werden, also die Frage der Nachhaltigkeit, die für alle Bereiche der Tourismusbranche immer wichtiger wird.
Gehen Sie davon aus, dass Dark Tourism weiter zunehmen wird?
Es ist ja leider so, dass auf der Welt immer mehr Orte des Leids, des Schreckens und des Todes produziert werden: durch kriegerische Auseinandersetzungen, durch von Menschen verursachte Katastrophen und zerstörerische Naturereignisse. Und das sind alles neue potenzielle Ziele.
ALBRECHT STEINECKE ist einer der bekanntesten deutschen Tourismusforscher. Er war langjähriger Geschäftsführer des Europäischen Tourismus Instituts GmbH (Trier) und später Hochschullehrer an der Universität Paderborn und hat mehrere Bücher zu Fragen der Tourismusforschung veröffentlicht. Anfang des Jahres erschien „Tourism NOW: Dark Tourism – Reisen zu Orten des Leids, des Schreckens und des Todes“ im UVK Verlag München.
QUELLE: https://www.fr.de/panorama/dark-tourism-schauplaetze-des-schreckens-gaensehaut-kz-tschernobyl-schlachtfelder-90853204.html
András Szigetvari: Nach der Pandemie: Kanzler Kurz jubelt über wirtschaftliche Erholung. Zu Recht? – Der Standard, 11.7.2021
Sebastian Kurz lobt das Krisenmanagement der Regierung, Wirtschaftsleistung und Beschäftigung hätten das Vorkrisenniveau erreicht. Die Aussagen des Kanzlers auf dem Prüfstand
Nach vielen Monaten, in denen Geschichten über steigende Arbeitslosenzahlen sowie geschlossene Restaurants und Geschäfte die Medien dominiert haben, kann die Bundesregierung nun endlich gute Nachrichten verkünden. Seit der Öffnung im Mai geht es wieder aufwärts. Seit einigen Tagen erweckt die Koalition von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abwärts sogar den Eindruck, die Krise wäre im Grunde bereits überwunden. Kurz sagte am Sonntag, dass sich die Beschäftigung im Land wieder auf dem Vorkrisenniveau befinde, ebenso wie das Bruttoinlandsprodukt. Österreich erhole sich damit im Vergleich zu anderen EU-Ländern schneller und besser.
Aber ist das ein realistisches Bild der Lage, oder betreibt der Kanzler hier entschlossen PR-Arbeit?
Zunächst ist unbestritten, dass die Erholung in Österreich kräftig ausfällt. Das Forschungsinstitut Wifo rechnet mit einem Plus bei der Wirtschaftsleistung von vier Prozent 2021 und fünf Prozent 2022. Die Arbeitslosigkeit geht zurück. Allerdings erweckt die Aussage, die Wirtschaftsleistung befinde sich wieder auf Vorkrisenniveau, einen falschen Eindruck.
*** Viele schlechte Monate ***
Das Wifo überwacht Woche für Woche die konjunkturelle Entwicklung im Land. Dazu werten die Ökonomen verschiedene Daten aus, etwa zu Umsätzen von Kreditkartenunternehmen, zu Einnahmen der Gastronomen oder zum Stromverbrauch. Der Output der heimischen Wirtschaft lag demnach von Mitte März 2020 bis Mai 2021, also 13 Monate lang, konstant unter dem Niveau von vor der Pandemie.
Es wurden in diesem Zeitraum also weniger Kühlschränke und Schnitzel verkauft, weniger Motoren produziert, Friseure hatten weniger Kundschaft. Diese kumulierten Verluste sind nun nicht weg, bloß weil seit dem Monat Mai der Output wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat.
Selbst im Gesamtjahr 2021 wird die Wirtschaftsleistung noch nicht das Niveau von 2019 erreicht haben, das soll erst irgendwann Anfang des kommenden Jahres der Fall sein.
Und kommt Österreich besser durch die Krise als andere? Auch dafür gibt es keinen Beleg. Der Aufschwung fällt natürlich kräftig aus, weil der Absturz 2020 sehr tief war. Aber die EU-Kommission hat diese Woche ihre Juli-Prognose vorgestellt, und demnach wird das Wachstum in Österreich heuer schwächer ausfallen als im Rest der EU und der Eurozone. Dafür gibt es Gründe. Österreich hängt stärker vom Tourismus ab als andere Staaten. Wegzaubern lässt sich die negative Differenz beim Wachstum jedoch nicht.
*** Im europäischen Vergleich ***
Die Kommission hat auch eine Prognose dazu vorgestellt, wo die Wirtschaftsleistung in den einzelnen EU-Ländern im Schlussquartal 2021 und 2022 im Vergleich zur selben Periode vor Beginn der Pandemie liegen wird. Hier gehört Österreich zu den Nachzüglern. In Polen, Irland oder Schweden ist die Wirtschaftsleistung Ende 2021 und 2022 viel deutlicher über dem Vor-Corona-Level (siehe Grafik).
Wie sieht es nun mit der Beschäftigung aus? Fakt ist auch hier, dass Experten überrascht davon sind, wie stark die Erholung ist. Und auf dem Papier liegt die Zahl der Beschäftigten tatsächlich wieder über dem Vorkrisenniveau, wie das Wifo vor kurzem gezeigt hat. Bloß hat diese Darstellung einen Schönheitsfehler: Personen in Kurzarbeit zählen auch als Beschäftigte. Das ist formal korrekt.
Doch im Mai waren 177.000 Menschen effektiv in Kurzarbeit, für 320.000 wurde sie beantragt. Damit waren zuletzt zwischen fünf und acht Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit. Werden viele in den kommenden Monaten gekündigt, hätte das auch für die Beschäftigtenzahlen negative Folgen.
FAZIT: Ob nun Beschäftigung oder Wirtschaftskraft, die Jubelmeldungen sind jedenfalls verfrüht und beim internationalen Vergleich verzerrt.
*** Wohlstandsverlust ***
Wie groß ist aber der Wohlstandsverlust durch die Pandemie wirklich? Um sich dieser Frage zu nähern, muss man nicht nur den tatsächlichen Konjunktureinbruch berücksichtigen, sondern auch der Frage nachgehen, was ohne Corona gewesen wäre.
Der Wifo-Ökonom Josef Baumgartner hat das getan. Er und seine Kollegen haben sich angesehen, wie sich die Wirtschaftsleistung Österreichs ohne Pandemie entwickelt hätte. Basis dafür waren die letzten Prognosen des Wifo vor Corona. Diese Zahlen wurden dann mit der realen Entwicklung abgeglichen.
ERGEBNIS: Zwischen 2020 und 2024 ergibt sich ein kumulierter Wohlstandsverlust in Höhe von 67 Milliarden Euro. Um so viel liegt die Wirtschaftsleistung oder liegen die Löhne der Beschäftigten und Gewinne der Unternehmen unter dem ansonsten erwarteten Wert.
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000128101594/kanzler-kurz-jubelt-ueber-wirtschaftliche-erholung-zu-recht