Views: 94
Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie letzte Woche ebenso – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball “supertoll” geht – noch: neben kurzfristigen – oder vielleicht: mittelfristigen – Inflationsgefahren dämmert seit wenigen Wochen eine andere, in ihrem Ausmaß nicht ganz klar zu umreißende Gefahr namens Delta-Virus herauf: Unruhe herrscht deshalb nicht nur bei Gesundheitsexperten, sondern auch bei Finanzanlegern und Unternehmen, auch in der Politik, meldete doch DJN am Wochende: US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich „sehr besorgt“ über das Risiko durch neue Corona-Varianten für die wirtschaftliche Erholung geäußert. „Wir sind eine verknüpfte globale Wirtschaft: Was in irgendeinem Teil der Welt passiert, betrifft alle anderen Länder.“
Dazu kommt, dass die chinesische Wirtschaft holpriger läuft, worauf die Peoples Bank of China mit Zinssenkungen reagiert.
Dem Niedrigzins weiter die Türe geöffnet hat auch die Europäische Zentralbank mit der Änderung des geldpolitischen Ziels. Damit hat sie sich Freiraum geschaffen für die Beibehaltung einer forcierten Niedrigzinspolitik. Am Rande erwähnt wird der Plan der Europäischen Kommission, das Limit für Bargeldkäufe einzuschränken.
Wie schon so oft in der Vergangenheit geraten die Zentralbanken, speziell die europäische, in die Kritik von Kommentatoren: ist die Niedrigzinspolitik eher ein Segen oder ein Fluch für Volkswirtschaft und Gesellschaft?
Cyberattacken rücken auf irritierende Weise die Risiken der enormen IT-Abhängigkeit von öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen in den Blick. Sie könnten Vorboten künftig weit größerer böser Überraschungen sein, wie Überlegungen eines Experten zur Cybersicherheit der englischen Nahrungsmittelversorgung zeigen.
IN DEN VORDERGRUND rücken in der KW 27 die Europäische Zentralbank gleich zwei Mal: zum einen wird im öffentlichen Diskurs die Frage nach den negativen Folgen der Negativzinspolitik abermals und kontrovers erörtert, zum anderen gibt die Neuorientierung der Geldpolitik Anlaß zu Lob und Tadel. In den „Kommentaren aus fremder Feder“ wird auf beide Aspekte Bezug genommen. Neben poinitiert negativen Einschätzungen der Niedrigzinspolitik von Thomas Fuster (NZZ) gibt es differenziertere von Michael Heise (Finanz & Wirtschaft), Thomas Fricke (Der Spiegel) und – mit beachtlichen Argumenten – von Wirtschaftsprofessor Jens Südekum (n-tv, Interview).
Alterationen ruft die Besetzung mit „neoliberalen“ Chefs von IHS und WIFO hervor, wie der Kommentar von Oliver Picek (Der Standard) zeigt.
In den Fokus der Berichterstattung gelangten cyberkriminelle Aktivitäten mit beträchtlichen Folgen in Australien, dem Iran und Deutschland. Statistisch gesehen gewinnen Cyberattacken und ihre verheerenden Auswirkungen zunehmend an Bedeutung – und das nicht erst seit gestern.
…oooOOOooo…
ÜBERSICHT
- UMWELT
- Hohes CO2-Einsparpotenzial durch veränderten Lebensstil – CO2-Fußabdruck wird erheblich kleiner: Lebensmittelabfälle reduzieren, weniger Fleisch essen, weniger neue Kleidung kaufen, Umsteigen vom Fliegen auf Bahnfahren – CO2-Produktion je Kopf sinkt von 11 Tonnen auf ein halbe Tonne
- Klimawandel: Die Tiefkühltruhe taut ab – Sich erwärmende Permafrostböden in arktischen Regionen und im Hochgebirge werden zur Gefahr für Mensch und Natur – Starke Beschleunigung des Klimawandels und seiner Folgen – Auftauender Permafrostboden: Entweichen von Kohlenstoff, Abfluss von Seewasser
- Forscher sehen Zukunftstrend: Hitzerekorde fallen von Russland bis Kanada – Prognose: Hitzewellen häufiger, intensiver und länger
INTERNATIONAL - Kiel Trade Indicator: Klarer Aufwärtstrend unterbrochen – China-Exporte im Juni mit negativem Vorzeichen
- Baseler Ausschuss: Bankensystem in Covid-Krise dank Reformen stabil
- Ölförderländer vertagen Gespräche über Ausweitung der Produktion erneut
- G20-Einigung – Janett Yellen dämpft Erwartung bei globaler Steuerreform – Auf den Jubel über die beschlossene globale Steuerreform mit Mindeststeuern für Großunternehmen folgen die Tücken der Umsetzung. Bis Oktober sollen die Pläne stehen – 132 Befürworter und 7 Gegner, darunter Irland, Ungarn und Estland – Milderung der finanziellen Pandemie-Folgen – Unterstützung ärmerer Staaten dank IMF
- Die globale Mindeststeuer hat noch einen gewaltigen Haken – Die Zustimmung Irlands, Ungarns und Estland könnte zum Stolperstein auf dem Weg zur Umsetzung eines weltweiten Abkommens in der EU werden
BÖRSEN - SENTIX-Sentimente: Nicht allzu starke, kurzfristig saisonal gestützte Kaufsignale im Time-Differential-Index – Bremsend wirkt die Eintrübung der strategischen Lage in China
- Private Equity ist keine Wunderinvestition – Der Chart des Tages
- 3 Gründe, warum Millionäre immer reicher werden
- Großteil der Einkünfte bleibt auf dem Gehaltskonto liegen: Wohin mit dem Ersparten? „Negativzinsen tun den Menschen weh“ – Nettosparquote lag bei 23 Prozent – Risikotragfähigkeit wegen langen Anlagehorizonts: Aktieninvestments sinnvoll für Jüngere – Für Menschen mit 55+ kurzfristige verfügbare Liquität bedeutsamer
ZENTRALBANKEN
– CHINA / PBoC - Chinas Notenbank senkt Reserveanforderung um 0,5 Prozentpunkte
– EUROPÄISCHE UNION / EZB - Lagarde: Das sind die fünf wichtigsten EZB-Strategieänderungen
- Strategieüberprüfung der EZB
- Neue geldpolitische Strategie: EZB strebt glatt 2% Prozent Inflation an – Überschreitungen erlaubt
- EZB gewährt sich mehr Flexibilität bei Inflation
- Lagarde: EZB will bei Inflation „Symmetrie wiederherstellen“
- Hintergründe der geldpolitischen EZB-Entscheidung: EZB-Rat waren Finanzierungsbedingungen zu fragil für PEPP-Reduzierung – Analysten wittern Fortführung der Politik des leichten Geldes
- Weidmann: Neue EZB-Strategie hilft bei Sicherung der Preisstabilität
- EZB erwartet keine starke Inflation
- EZB-Negativzins ist laut Rechtsgutachten verfassungswidrig
- Kirchoff: „Enteignung der Sparer“ Negativzins laut Gutachten verfassungswidrig
- Interview: Ökonom erklärt Negativzinsen „In der Verfassung steht nichts von Sparern“
- Videobeitrag – Südekum zu Kritik an EZB-Politik „Negativzinsen können gar nicht verfassungswidrig sein“
- Sparda-Banken: EZB muss Negativzinspolitik beenden – Bezug zum Kirchhoff-Gutachten
- CDU-Wirtschaftsrat wirft EZB schleichende Enteignung vor
- EZB/Schnabel: Hoffnung auf Ende der Niedriginflationsphase
- COMMENT: die doppelt abgeweideten Staatsbürger*innen: erst Niedrigzins auf dem Sparbuch, dann Inflation beim Einkauf. Was, wenn die Lohnforderungen fruchten und zu verständlichen Lohnsteigerungen führen?
- EZB will Klimaschutz in der Geldpolitik größeres Gewicht geben
- EZB will Klima-Transparenz von Emittenten von Unternehmensanleihen
- EZB/Enria: Es gibt Banken ohne tragfähiges Geschäftsmodell
- Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität wenig verändert
USA - US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken
- API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände
- USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet
- Online-Geschäfte in den USA: Trendwende beim Lebensmittelkauf – Der Chart des Tages
- Markit: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im Juni nach Rekordhoch im Mai
- Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten leicht gestiegen
CHINA - Eintrübung in China – Der Chart des Tages
- VDMA: China löst Deutschland als Exportweltmeister für Maschinen ab
- Als Exportweltmeister abgelöst: China überholt Deutschland im Maschinenbau
AUSTRALIEN - NSW Department of Education struck by cyber attack – The state department has taken its systems offline as a precaution as it readies for the start of Term 3 next week
IRAN - System down: Iran berichtet von Hackerangriff auf Transportministerium – Unklare Berichtslage: Ministerium spricht von „technischen Störungen“, Minister von „Anzeichen für Cyberangriffe“
TÜRKEI - Erdogan hat ein Problem: Inflationsrate in der Türkei schießt nach oben
GROSSBRITANNIEN - UK food supply chain vulnerable to cyber-attack, expert warns – ‘Complacent reliance’ on overseas produce and computer ordering has put supply at risk
- Großbritannien: Wachstum schwächt sich ab
- Großbritannien: Dienstleisterstimmung geht leicht zurück
SCHWEIZ - Erholung stärker und früher als erwartet: Schweizer Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf 2,8% – Kurzarbeit nimmt ebenfalls ab – Langzeitarbeitslosigkeit stabilisiert
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Limitierte Brgeldeinkäufe
- Ifo, KOF und Istat stellen Eurozone Economic Outlook ein
- Umbau der Wirtschaft: Die Industrie warnt vor erheblichen Risiken der EU-Klimastrategie
- EU-Kommission hebt Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 an
- Markit: Stärkstes Wachstum im Euroraum seit 15 Jahren
- EU-Kommission schlägt freiwilligen Green-Bond-Standard vor
- EU: Höhere Steuersätze in elf EU-Staaten wegen globaler Mindeststeuer
- EU genehmigt Kauf von Willis Towers durch Aon unter Auflagen
ITALIEN - Italien: Industrieproduktion fällt überraschend
DEUTSCHLAND - BDI: Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen so hoch wie nie zuvor
- Ransomware Auf „Großwildjagd“: Hacker attackieren jetzt Software-Firmen mit Tausenden Kunden –
Die Attacke auf die Software von Kaseya zeigt die Schwächen in der globalen Netzarchitektur. Auch in Deutschland sind mehrere IT-Dienstleister betroffen - Erster Cyber-Katastrophenfall in Deutschland – Landkreis Anhalt-Bitterfeld lahmgelegt: Auszahlung von Sozialleistungen blockiert – Trotz großer Datenmengen zu Bürgern: Kommunen besonders schlecht gegen Angriffe geschützt
- Der Cyber-Krimi und seine Kosten
- Holzpreise klettern kräftig Wohnungsbau ist noch teurer geworden
- Kurzvideo: Auch an Zapfsäule wird’s teurer Opec-Streit treibt Heizöl-Preise in die Höhe
- Kurzvideo – Staus in den Containerhäfen: Drohen Deutschland leere Regale und höhere Preise?
- Container-Chaos: Gelähmte Schifffahrt vorübergehend inflationstreibend auf erwartete 4 Prozent Jahresteuerung – Chefs von Kik und Rossmann schlagen Alarm: Händler bereiten Kunden auf höhere Preise und Lücken in Regalen vor – Die Frachtraten haben sich vervielfacht, Container sind kaum zu bekommen, die Läger laufen leer. Für viele Händler ist die Lage „dramatisch“ – Rürup: nächstes Jahr Rückkehr zu 2 Prozent Inflation
- Ifo: Materialmangel in der Baubranche verschärft sich
- SENTIX: Deutsche Wirtschaft in der Hochkonjunktur
- Trotz Rückgang Normalisierung der Wirtschaftslage: ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland überraschend schwächer als erwartet – Optimistische Expert*innen: Gute Aussichten auf Sicht von sechs Monaten
- Auftragseingang der deutschen Industrie im Mai viel schwächer als erwartet
- Ifo: Produktionserwartungen nur leicht gestiegen
- Deutsche Produktion sinkt im Mai um 0,3 Prozent
- Deutscher Industrieumsatz sinkt im Mai um 0,5 Prozent
- Deutsche Exporte steigen im Mai leicht
- Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juni um 0,7 Prozent
- Commerzbank: Konsum wird wichtigste deutsche Wachstumsstütze
- Hohes Wachstumstempo mit Dämpfer: ISM-Index für Dienstleistungen wächst langsamer – Schwächere Nachfrage und Personalmangel dämpfen – Boom bei Gastgewerbe, Freizeit und Reisen kann Nachfrageexplosion nicht völlig befrieden – Hemmschuhe bilden „schwere Lieferkettenunterbrechungen und Preissteigerungen“
- Markit: Deutsche Dienstleister kommen im Juni besser in Schwung – Stark anziehende Kosten bedingen explosionsartige Preissteigerung
- Starke Nachfrage nach E-Mobilen: Deutscher Automarkt mit kräftigem Zuwachs im Juni – Neuzulassngen noch unter Niveau der Vor-Pandemie-Zeit
- VDA reduziert Auto-Absatzprognose für Deutschland 2021
- Videobeitrag: Tourismus – „Als nackte Kulisse missbraucht“ Insta-Touristen am Königssee drohen 25.000 Euro Strafe
- IMK: Reform der Schuldenbremse würde Regierung viel Geld bringen
- Scholz erwartet Mehreinnahmen in Milliardenhöhe durch globale Mindeststeuer
- Umfrage: Viele junge Leute verzichten ganz auf ein Festnetztelefon
ÖSTERREICH
– STATISTIK AUSTRIA
Großhandelspreisindex im Juni 2021 um 11,2% über Vorjahresniveau
Produktionsindex stieg im Mai 2021 um 23,4%
Ein Fünftel mehr Pkw-Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2021, aber noch rd. ein Viertel unter dem Niveau 2019
Außenhandel im April 2021: markante Zuwächse im Vergleich zum schwachen Vorjahresmonat; Einfuhren +44,9%, Ausfuhren +37,7%
– MELDUNGEN - EU erwartet in Österreich 2021 Wachstum um 3,8 Prozent
- Arbeitslosigkeit: AMS soll wieder schärfer sanktionieren
- Zweidrittel-Mehrheit für Erneuerbaren Ausbau Gesetz steht
- Ökostrom: Zulasten der Netze – Bis 2030 soll der gesamte heimische Strom grün sein. Ob bis dahin auch die Leitungen stark genug sind, ist jedoch unklar
KOMMENTAR AUS FREMDER FEDER - Thomas Fuster: Die Europäische Zentralbank will künftig auch Inflationsraten über 2 Prozent tolerieren. Das ist gefährlich und verheisst nichts Gutes für die Schweiz – Weitreichede Folgen – Bedrohte Stabilitätskultur
- Michael Heise: EZB zwischen Konjunkturstimulierung und Finanzmarktstabilität
- Thomas Fricke: Überforderte Zentralbank Wenn Notenbanker die Welt retten müssen
- Interview: Ökonom erklärt Negativzinsen „In der Verfassung steht nichts von Sparern“
- Jan Gänger: Kirchhof wittert Enteignung – Es gibt kein Recht auf Zinsen
- Oliver Picek: Neue Chefs von IHS und Wifo: Wirtschaftsliberale an den Schaltstellen – Die einseitige Besetzungspolitik birgt die Gefahr, dass ihre wirtschaftspolitischen Ratschläge zu einhellig, ja gar undurchdacht werden. Eine Einladung zum produktiven Disput
…oooOOOooo…
UMWELT
Hohes CO2-Einsparpotenzial durch veränderten Lebensstil – CO2-Fußabdruck wird erheblich kleiner: Lebensmittelabfälle reduzieren, weniger Fleisch essen, weniger neue Kleidung kaufen, Umsteigen vom Fliegen auf Bahnfahren – CO2-Produktion je Kopf sinkt von 11 Tonnen auf ein halbe Tonne – Deutsches Ärzteblatt, 9.7.2021
Mit moderaten Umstellungen ihrer individuellen Gewohnheiten können die Bürger nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Kampf gegen den Klimawandel mehrere Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Würden die deutschen Haushalte demnach ihre jährlichen Lebensmittelabfälle um die Hälfte reduzieren, so würden gut sechs Millionen Tonnen CO2 weniger anfallen, wie aus einer heute veröffentlichten Berechnung des IW hervorgeht.
Die Logik dahinter: Der Bedarf an Lebensmitteln würde sinken, es müsste weniger angebaut, transportiert oder gekühlt werden, und es entstünden dabei weniger Treibhausgase. Zum Vergleich: Der innerdeutsche Flugverkehr verursachte im Jahr 2019 den Angaben zufolge etwa zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid.
Die Fachleute listen noch andere Maßnahmen auf: Würden die Bürger ein Fünftel weniger Fleisch und stattdessen Fleischersatz essen, lägen die Einsparungen bei fast zehn Millionen Tonnen CO2.
Auch in anderen Bereichen des Alltags sehen die Experten Potenzial für den Klimaschutz: Würden alle Bürger ein Fünftel weniger neue Kleidung kaufen als bisher, lägen die CO2-Einsparungen laut IW bei rund zwölf Millionen Tonnen pro Jahr.
Im Schnitt kauft jeder Bürger in Deutschland pro Jahr den Angaben zufolge 56 Kleidungsstücke – wären es elf weniger, könnte die genannte Menge an Treibhausgasen eingespart werden. Auch der Umstieg vom Flugzeug auf die Bahn würde helfen, um den Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.
Die vier Maßnahmen zusammengenommen würden demnach den CO2-Fußbadruck je Einwohner von derzeit etwa elf Tonnen pro Jahr um 0,6 Tonnen verringern. Sollte die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden, wäre nach IW-Angaben aber eine Reduzierung auf weniger als eine Tonne nötig. Der größte Brocken käme aus der klimaschonenden Umstellung der Energieerzeugung, aus der Industrie und dem Verkehr.
Nach Ansicht des IW-Experten Roland Kube zeigen die Zahlen, dass jeder Bürger mit Umstellungen seines Alltags etwas tun könne. „Eine nachhaltige Lebensweise ist ein ergänzender, aber wichtiger Faktor, um die Emissionen im Sinne des Klimaschutzes stark zu senken“, sagt Kube. Es geht bei den Zahlen um CO2-Äquivalente – somit ist nicht nur die Treibhausgaswirkung von Kohlendioxid einberechnet, sondern etwa auch die des in der Landwirtschaft freiwerdenden Methans.
QUELLE: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125448/Hohes-CO2-Einsparpotenzial-durch-veraenderten-Lebensstil
Klimawandel: Die Tiefkühltruhe taut ab – Sich erwärmende Permafrostböden in arktischen Regionen und im Hochgebirge werden zur Gefahr für Mensch und Natur – Starke Beschleunigung des Klimawandels und seiner Folgen – Auftauender Permafrostboden: Entweichen von Kohlenstoff, Abfluss von Seewasser – Wiener Zeitung, 9.7.2021
Alleine das Wort Permafrost ist aussagekräftig genug, um permanent gefrorene Böden vor Augen zu haben. Doch so aussagekräftig der Begriff selbst auch sein mag, die Dauerhaftigkeit lässt mittlerweile stark zu wünschen übrig. Vielerorts tauen die Böden auf, Seen versickern und unaufhaltsam weichen vom Boden freigelassene Treibhausgase in die Atmosphäre. Diese Entwicklung beobachten Forscher schon seit vielen Jahren. Guido Grosse vom Alfred-Wegener-Institut in Deutschland ist einer von ihnen. Mit dem Erkundungsflugzeug Polar 6 kreist er derzeit über Westalaska, um die Auswirkungen auf Land und Leben zu erkunden. „Die Tiefkühltruhe beginnt, sich zu öffnen“, skizziert er im Gespräch mit der „Wiener Zeitung“ die Lage.
Befindet sich ein Boden über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren unter null Grad Celsius, bezeichnet man ihn als Permafrost. Der Untergrund kann dabei aus Gestein, Sedimenten oder Erde bestehen und unterschiedlich große Eismengen enthalten. Wie in einer riesigen Tiefkühltruhe sind im Permafrost große Mengen abgestorbener Pflanzenreste und Tiere konserviert. Im gefrorenen Boden können Mikroben dieses organische Material nicht abbauen, da Bakterien erst aktiv werden, wenn es taut. Das geschieht allerdings unaufhaltsam – in Alaska, Kanada und in Sibirien sowie im Hochgebirge.
*** Starke Beschleunigung ***
Unterschiedlichste Faktoren sind für das Tauen der Böden ausschlaggebend. Dem zugrunde liegt die Klimaerwärmung. So verändert nicht nur die Lufttemperatur die Bodentemperatur, sondern wirken auch Wald- und Tundrabrände, wie sie zuletzt immer wieder aus Sibirien gemeldet wurden, als massive Einflussfaktoren. Die Ursache für die Erwärmung sei allerdings nicht die Hitze des Feuers, sondern die durch die Brände stattfindende Veränderung der Vegetation, erklärt Grosse. Die Flammen zerstören nicht nur die Vegetation, sondern auch die Torfschichten im Boden. Torf fungiert dort als Isolierschicht, um den Permafrost vor der sommerlichen Hitze zu schützen. Die Arktis ist heute trockener und wärmer, auch wird sie immer wieder von Gewittern heimgesucht. Blitzschläge führen auch dort zu den gefürchteten Bränden.
Luftbilddaten, Laserscannerdaten und Satellitenaufnahmen zeugen von den Veränderungen. An Bord von Polar 6 werden sie den Forschern noch deutlicher vor Augen geführt. Grosse kennt die Landschaft von Westalaska schon seit Langem. „In den letzten drei bis vier Jahren hat sich immer klarer und deutlicher gezeigt, dass sich manche der Veränderungen stark beschleunigen“, schildert der Permafrost-Forscher. Wiewohl die Beobachtungen „superspannend und erkenntnisreich sind, fängt es jetzt an, ein bisschen erschreckend zu sein.“
Die Veränderungen sind ein natürlicher Prozess und damit auch wieder umkehrbar – allerdings nicht auf menschlichen Zeitskalen, betont Grosse. Eine Trendwende alleine würde schon über Jahrtausende in Anspruch nehmen.
*** Stöpsel aus der Badewanne ***
In der Permafrostregion lagern 1.100 bis 1.600 Gigatonnen Kohlenstoff. In der Atmosphäre befinden sich derzeit rund 850 Milliarden. Die kalten Böden dort speichern also fast doppelt so viel wie die Atmosphäre. Ein guter Teil davon ist ganzjährig oder zumindest saisonal gefroren. Wird allerdings durch den Vorgang des Auftauens und der Bodenerwärmung Kohlenstoff aus den Böden freigesetzt, ist das von immenser Bedeutung für das globale Klimasystem.
In den letzten Jahrzehnten hat sich nicht nur die Atmosphäre erwärmt. Auch die Temperatur der oberen Schichten des Permafrosts ist in einigen Gebieten um zwei Grad Celsius gestiegen. Die Grenze des kontinuierlichen Permafrosts läuft so weiter nördlich.
Die Tauvorgänge verändern auch die Seenlandschaft der Permafrostregionen. Millionen an solcher Gewässer erstrecken sich dort. Sie existieren gerade wegen des Permafrost. Er bildet den Untergrund für die Wasserreservoirs – ähnlich einer Badewanne. Taut der Boden jedoch auf – wird also der Stöpsel gezogen -, läuft das Wasser entweder nach unten ins Grundwasser oder seitlich aus. Das bringt starke Veränderungen für die Regionen mit sich. Die Landschaften werden trockener, Habitate sind einem Wandel unterzogen. Das hat Auswirkungen auf bestimmte Tierarten und die Zusammensetzung des Ökosystems, erklärt der Forscher – aber auch für die Menschen vor Ort, die mit Problemen der Infrastruktur und einsinkendem Untergrund konfrontiert sind.
Es sei „mehr und mehr nicht von der Hand zu weisen, dass große Veränderungen stattfinden, und dass diese auch uns in den mittleren Breiten treffen“. Grosse fordert die Politik dazu auf, die Problematik nicht nur wahr, sondern auch ernst zu nehmen.
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2111917-Die-Tiefkuehltruhe-taut-ab.html
Forscher sehen Zukunftstrend Hitzerekorde fallen von Russland bis Kanada – Prognose: Hitzewellen häufiger, intensiver und länger – n-tv, 7.7.2021
In der kanadischen Kleinstadt Lytton wird ein 83 Jahre alter Temperaturrekord kürzlich um fast fünf Grad Celsius übertroffen, weltweit fallen vor allem auf der Nordhalbkugel Temperaturrekorde. Die Folgen für Mensch und Natur sind verheerend und ein Ende der Entwicklung scheint kaum in Sicht.
Der vergangene Monat war nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der heißeste Juni aller Zeiten in Nordamerika. Dort finden Temperaturaufzeichnungen seit 1979 statt. Teile der USA und Kanadas waren in den vergangenen Wochen von einer massiven Hitzewelle betroffen, die zu zahlreichen Waldbränden, aber auch zu einer hohen Zahl an Hitzetoten führte. „Diese Hitzewellen finden nicht in einem Vakuum statt. Sie finden in einem weltweiten, sich erwärmenden Klima-Umfeld statt, das ihr Auftreten wahrscheinlicher macht“, sagte Klimaforscher Julien Nicolas von Copernicus.
In der kanadischen Provinz British Columbia wurde im Juni an drei Tagen in Folge ein neuer Tagestemperaturrekord gemessen. Insgesamt lang die Temperatur in der Region im Juni laut Copernicus 1,2 Grad über dem Durchschnittswert der Jahre 1991 bis 2020. Für Europa war es der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen, weltweit gemeinsam mit dem Juni 2018 der viertwärmste. Nur in den Jahren 2016, 2019 und 2020 wurden höhere Durchschnittstemperaturen gemessen. Kälter als im Durchschnitt von 1991 bis 2020 war es hingegen in der Antarktis.
Ungewöhnlich warm war es demnach vor allem im Westen der USA und in Kanada sowie in Finnland, Norwegen und dem Westen Russlands. In der finnischen Hauptstadt Helsinki, wo die Aufzeichnungen bis ins Jahr 1844 zurückgehen, war die Juni-Durchschnittstemperatur in den vergangenen fast 180 Jahren noch nie so hoch wie in diesem Jahr. Im nordfinnischen Lappland wurden nach Angaben des Meteorologischen Instituts Finnlands zuletzt 33,5 Grad Celsius registriert, was der höchsten gemessenen Temperatur in dieser Region seit mehr als 100 Jahren entsprach. Russlands Hauptstadt Moskau verzeichnete den wärmsten bislang gemessenen Junitag.
*** Hitzewellen häufiger, intensiver und länger ***
Wie das Meteorologische Institut von Norwegen am gestrigen Dienstag auf Twitter mitteilte, wurden in der Gemeinde Porsanger in der nördlichsten norwegischen Provinz Troms und Finnmark am Montagnachmittag 34,3 Grad Celsius gemessen – das sei ein Rekord für die Provinz. In neun der elf norwegischen Provinzen sei zudem bislang in diesem Jahr eine Hitzewelle registriert worden. Als diese wird in Norwegen definiert, wenn die Maximaltemperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Durchschnitt bei mindestens 28 Grad liegt.
„Die Hitzewellen, die wir im vergangenen Monat in Nordamerika, Westrussland und Nordsibirien gesehen haben, sind nur die jüngsten Beispiele für einen Trend, der sich voraussichtlich in der Zukunft fortsetzen wird und mit der Erwärmung unseres globalen Klimas zusammenhängt“, sagte Nicolas. Die Hitzewellen träten häufiger auf, seien intensiver und dauerten länger an als in der Vergangenheit.
Der Klimawandeldienst der EU erstellt monatlich Berichte über die Lufttemperatur, das Meereis und den Wasserkreislauf. Er stützt sich auf Daten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Erdball sowie Modellrechnungen. (ntv.de, als/AFP/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Hitzerekorde-fallen-von-Russland-bis-Kanada-article22667171.html
INTERNATIONAL
Kiel Trade Indicator: Klarer Aufwärtstrend unterbrochen – China-Exporte im Juni mit negativem Vorzeichen – Institut für Weltwirtschaft Kiel (IFWK, 5.7.2021)
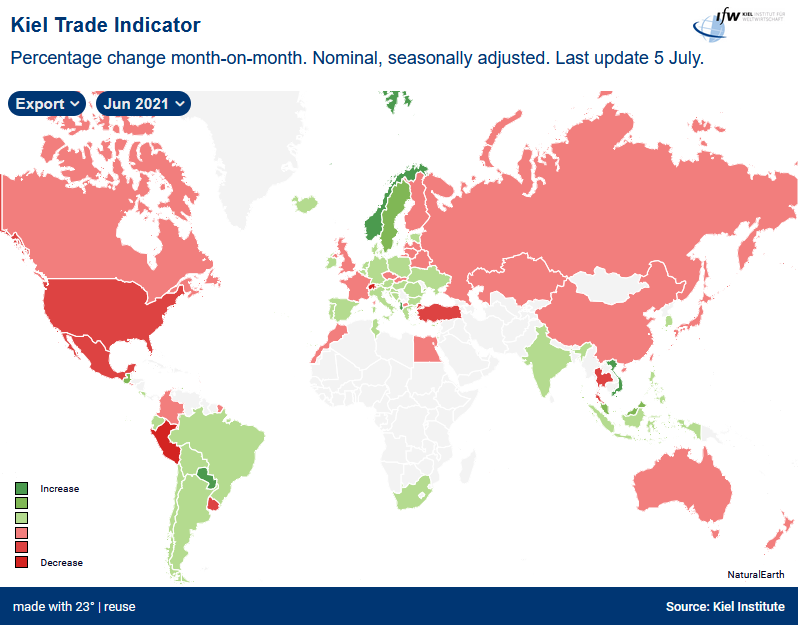
Die Anzahl wartender Containerschiffe im chinesischen Perlflussdelta ist ungewöhnlich hoch. Einzelne Häfen wie Yantian haben weniger als die Hälfte ihrer üblichen Containermenge verschifft. Gegenwärtig sind bereits knapp fünf Prozent aller Containerschiff-Kapazitäten durch Staus an den chinesischen Häfen gebunden . Das ist mehr als in der ersten Corona-Welle. Im Roten Meer sind aktuell zehn Prozent weniger Containerschiffe unterwegs sind, als zu erwarten wäre. Das Frachtaufkommen auf dem Roten Meer ist ein Indikator für den Handel zwischen Asien und Europa.
Entsprechend weisen die chinesischen Handelsdaten im Juni negative Vorzeichen auf. Chinas offizielle Export-Statistiken können von den Indikatorwerten abweichen, denn Chinas Zoll misst Güter, wenn diese das Hafengelände erreichen. Der Kiel Tradeindicator misst Schiffe, die die Häfen verlassen. Für Importe besteht dieser Unterschied nicht. Auch der Welthandel insgesamt zeigt sich rückläufig. Für Deutschland und die EU zeigt sich kein einheitliches Bild, der klare Aufwärtstrend der vergangenen Monate ist aber unterbrochen.
QUELLE: https://www.ifw-kiel.de/de/themendossiers/internationaler-handel/kiel-trade-indicator/
Baseler Ausschuss: Bankensystem in Covid-Krise dank Reformen stabil – DJN, 6.7.2021
Hans Bentzien
Das internationale Bankensystem ist nach Einschätzung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht trotz der Belastungen der Corona-Krise stabil geblieben. Der Ausschuss führt das auch auf die nach der Finanzkrise beschlossenen Reformen zurück, deren vollständige Umsetzung das Gremium in seinem Bericht fordert. Europäische Banken setzen sich derzeit intensiv für eine milde Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 in europäischen Recht um, wovor die europäischen Aufsichtsbehörden warnen.
„Die Analyse zeigt, dass das Bankensystem durch die Pandemie hindurch widerstandsfähig geblieben ist, gestärkt durch erhebliche Erhöhungen des Kapitals und der Liquidität, die die Banken seit der Verabschiedung der Baseler Reformen halten“, heißt es in dem Bericht. Seit dem Ausbruch der Pandemie sei keine international tätige Bank ausgefallen oder habe vom Staat in erheblichem Umfang Geld erhalten müssen. „Die Banken haben es im Allgemeinen geschafft, vorübergehende Erhöhungen der Liquiditätskosten und des Kreditrisikos zu absorbieren.“
Laut den Analysen des Baseler Ausschusses mussten während der Pandemie Banken mit einer höheren CET1-Eigenkapitalquote weniger für Kreditversicherungen zahlen. Zudem hätten stärker kapitalisierte Banken mehr Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben.
Laut Basler Ausschuss war die Eigenkapitalausstattung der Institute deutlich höher als von den Mindestanforderungen vorgesehen, was auch an staatlichen Ausschüttungsverboten gelegen habe. „Das macht es schwierig, die Bereitschaft der Banken einzuschätzen, ihre Kapitalpuffer zu benutzen“, konstatiert der Ausschuss. Es gebe aber Anlass zu der Annahme, dass die Banken dabei zögerlich gewesen wären.
Einige Banken hatten laut dem Bericht zu Beginn der Krise leichte Liquiditätsprobleme, am ehesten die mit einer Mengenfinanzierung über den unbesicherten Geldmarkt. Die während der Krise noch nicht bindend eingeführte ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) hätte demnach kein Hindernis für die Kreditvergabe dargestellt. Allerdings hätten einige Zentralbanken vorgebeugt, indem sie Zentralbankreserven von der Berechnung der Leverage Ratio ausnahmen.
Die Frage, ob das neue Baseler Regelwerk – der Ausschuss spricht von Basel 2.5 – in der Krise prozyklisch gewirkt habe, beantwortet der Bericht nicht. Wegen regulatorischer Lockerungen beim Zwang zur Anerkennung notleidender Kredite und oben genannter Erleichterungen sei eine Einschätzung nicht möglich. Die im Januar 2019 beschlossenen Änderungen an dem Rahmen hätten solche Prozyklizitäten aber vermutlich beseitigt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53339663-baseler-ausschuss-bankensystem-in-covid-krise-dank-reformen-stabil-015.htm
Ölförderländer vertagen Gespräche über Ausweitung der Produktion erneut – WOCHENEND-ÜBERBLICK / DJN, 5.7.2021
Die wichtigsten ölproduzierenden Länder haben sich am Freitag erneut nicht auf eine Erhöhung der Öl-Fördermenge einigen können. Die Beratungen seien auf Montag vertagt worden, teilten die Opec-Staaten und ihre Partnerländer mit. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Öl und wachsender Inflationssorgen beraten die Staaten seit Donnerstag über eine mögliche Ausweitung der Fördermenge.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53323543-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-03-und-04-juli-2021-015.htm
G20-Einigung – Janett Yellen dämpft Erwartung bei globaler Steuerreform – Auf den Jubel über die beschlossene globale Steuerreform mit Mindeststeuern für Großunternehmen folgen die Tücken der Umsetzung. Bis Oktober sollen die Pläne stehen – 132 Befürworter und 7 Gegner, darunter Irland, Ungarn und Estland – Milderung der finanziellen Pandemie-Folgen – Unterstützung ärmerer Staaten dank IMF – Der Standard/Reuters, 11.7.2021
Kaum sind die Beschlüsse gefasst, werden die Erwartungen auch schon wieder gedämpft. So lässt sich der G20-Gipfel zusammenfassen, der am Sonntag in Venedig zu Ende gegangen ist.
Geeinigt haben sich die Länder auf eine globale Steuerreform, ein Teil davon ist die weltweite Mindeststeuer von mindestens 15 Prozent. Doch US-Finanzministerin Janett Yellen zeigt sich pessimistisch, was die Umsetzung betrifft. Die erste Säule der Reform werde womöglich nicht vor Frühjahr 2022 fertig. Dabei geht es darum, dass die 100 größten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in Staaten mit großen Märkten abgeben sollen, wovon vor allem Schwellenländer profitieren würden. Die technische Umsetzung sei hier schwieriger als bei der zweiten Säule, der Mindeststeuer für große Unternehmen. Yellen sagte, die zweite Säule sei auf einer etwas schnelleren Fahrbahn.
*** 132 Befürworter und 7 Gegner, darunter Irland, Ungarn und Estland ***
132 Länder haben sich unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD auf diese Steuerreform verständigt, die die internationalen Regeln ans Digitalzeitalter anpassen soll. Sieben Länder – darunter aus Europa Irland, Ungarn und Estland – verweigerten zuletzt aber ihre Unterschrift. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) hatten die Pläne am Samstag gebilligt. Die OECD soll nun bis Oktober die letzten Details klären und einen Plan zur Umsetzung vorlegen.
Die neuen Regeln, von denen sich Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz milliardenschwere Zusatzeinnahmen für die wegen der Corona-Pandemie leeren Staatskassen erhofft, sollen 2022 in Gesetzesform gegossen werden und dann ab 2023 greifen. Scholz ist einer der stärksten Befürworter des Projekts. Der SPD-Kanzlerkandidat hatte am Wochenende gesagt, er rechne fest mit einer finalen Einigung im Oktober.
*** Zweifel an Umsetzung des Vorhabens ***
Es bleiben aber Zweifel, ob die Umsetzung gelingt – vor allem die Frage, ob Yellen die Reform durch den US-Kongress bekommt, in dem die Republikaner jede Form von Steuererhöhung bekämpfen. Außerdem gehen die Vorstellungen weiterhin auseinander. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire brachte beim G20-Treffen beispielsweise eine Mindeststeuer von 25 Prozent ins Spiel, was unter Experten aber als unrealistisch gilt.
*** Abtausch: Steuer gegen Digitalabgabe ***
Die USA hoffen, mit einer globalen Einigung einen Fleckerlteppich nationaler Digitalsteuern und ähnlicher Abgaben verhindern zu können. Die USA stören sich an einer von der EU-Kommission geplanten Digitalabgabe, die Ende Juli vorgestellt werden soll. Insidern zufolge gab es hier beim G20-Treffen massiven Druck der USA, aber auch europäischer Länder, die Pläne mindestens zu verschieben, um die wesentlich weitergehende globale Einigung nicht zu gefährden.
EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte nach den Beratungen in Venedig, eine globale Lösung habe Priorität. Yellen trifft heute, Montag, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch hier dürfte sie drängen, die Abgabe zurückzuziehen.
*** Folgen der Pandemie: globale Steuer brächte dringend benötigte Einnahmen ***
Yellen sagte zudem, die globale Steuerreform werde Staaten dringend benötigte Einnahmen für mehr Investitionen bescheren. Sie äußerte Sorgen wegen der Delta-Variante des Coronavirus.
*** Aufruf zur gegenseitigen Unterstützung der G20-Staaten noch ohne Gehör ***
Die G20-Staaten müssten sich bei der Impfstoffverteilung stärker als bisher unterstützen. Allerdings wurden bei dem Treffen keine neuen Zusagen gemacht, auch nicht für ärmere Länder. Yellen ergänzte, es müsse zudem schon jetzt Vorbereitungen auf weitere Pandemien geben. Hierzu sollte es im Oktober dann auch Beschlüsse geben.
*** Stärkere Unterstützung armer Staaten im Kampf gegen Corona mit Hilfe des IMF ***
Die USA hoffen bis Oktober, wenn die G20-Staaten das nächste Mal zusammenkommen, auch auf eine stärkere finanzielle Unterstützung besonders armer Staaten. Sie sollen aus den zusätzlichen Mitteln des Internationalen Währungsfonds (IWF) 100 Milliarden Dollar (84,6 Mrd. Euro) zugeordnet bekommen. Um besser gegen die Pandemie und ihre Folgen ankämpfen zu können, sollen die Reserven des IWF bis Ende August um 650 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Das wäre die stärkste Erhöhung der sogenannten Sonderziehungsrechte – einer künstlichen Währung des IWF – in der Geschichte des Fonds. Mindestens 100 Milliarden Dollar der neuen Mittel sollen auf freiwilliger Basis an die ärmsten Länder der Welt fließen. Wie das genau geschieht und wer dabei von den IWF-Mitgliedern mitzieht, ist aber noch völlig offen.
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000128113627/janett-yellen-daempft-erwartung-bei-globaler-steuerreform
Die globale Mindeststeuer hat noch einen gewaltigen Haken – Die Zustimmung Irlands, Ungarns und Estland könnte zum Stolperstein auf dem Weg zur Umsetzung eines weltweiten Abkommens in der EU werden – Wiener Zeitung, 10.7.2021
Niemand zahlt gern Steuern. Es wundert daher nicht, dass große, multinationale Unternehmen Gewinne gerne in Länder mit niedrigen Steuersätzen verschieben, und das völlig legal. Viele dieser sogenannten Steuerparadiese sind keine Inseln unter Palmen wie die berühmten Cayman Islands. Irland zum Beispiel lockt Unternehmen mit einem nominellen Steuersatz von 12,5 Prozent an. In den USA wären 35 Prozent fällig. So ist es denn auch kein Zufall, dass zahlreiche multinationale Konzerne wie Facebook, Google und Apple ihre Europazentralen in Irland haben.
Nun sollen sie künftig mindestens 15 Prozent Körperschaftsteuer zahlen. 131 Länder haben sich unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD unlängst darauf geeinigt. Unter den acht Staaten, die nicht mitziehen wollen, sind aus Europa neben Irland auch die Niedrigsteuerländer Ungarn und Estland. Ihr Widerstand könnte innerhalb der Europäischen Union zum Problem werden, da für die Einführung einer globalen Mindeststeuer in der EU Einstimmigkeit nötig ist.
*** Die Iren pochen auf ihre Souveränität ***
Aus der Sicht Irlands ist es das vornehmste Recht eines Staates, seine Steuersätze selbst festzulegen. „Für die irische Regierung geht es ums Prinzip“, sagte Brian Keegan vom Verband der Wirtschaftsprüfer, Chartered Accountants Ireland, dem „Handelsblatt“. Eine globale Mindeststeuer würde Irland die Souveränität nehmen, den eigenen Steuersatz selbst zu bestimmen.
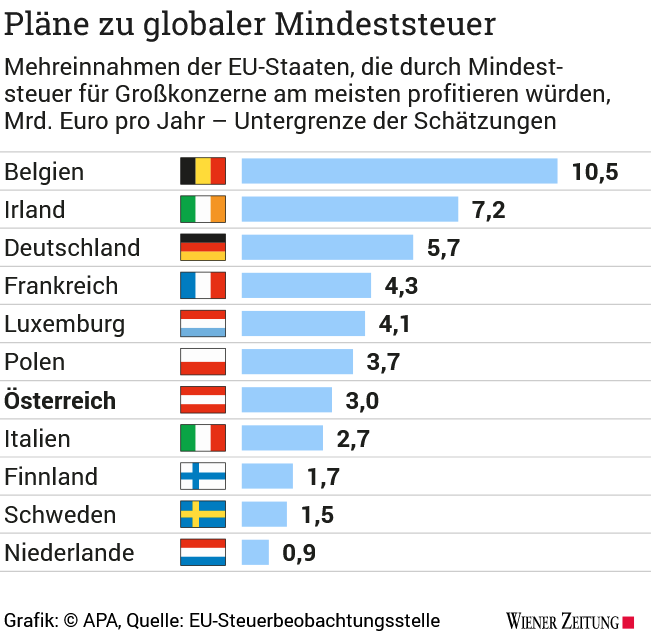
Den Weg für ein Abkommen sollen diese Woche die Finanzminister der G20, der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer der Welt, bei ihrem Treffen in Venedig ebnen. Auch die G20 – die EU zählt als Vollmitglied neben ihren drei Mitgliedstaaten Frankreich, Deutschland und Italien- haben sich für das Vorhaben einer globalen Mindeststeuer ausgesprochen und sollen es nun offiziell bestätigen.
Das Projekt gilt als revolutionär, denn es soll für mehr Gerechtigkeit in der Welt sorgen. Die OECD spricht von weltweit 8.000 internationalen Konzernen, die künftig in jedem Land, in dem sie tätig sind, mindestens 15 Prozent Steuern abzuführen haben. Liegt der Steuersatz unter dem neuen Mindestwert von 15 Prozent, muss der Konzern die Differenz im Heimatland nachversteuern. Oft sind das die USA, die mit den Mehreinnahmen ihre Steuerlöcher stopfen wollen. „Der irische Finanzminister Paschal Donohoe müsste sich also überlegen, ob er von Apple weiterhin nur die sagenhaften 12,5 Prozent verlangt und den Rest der Steuererlöse der Kollegin Janet Yellen in Washington überlässt“, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“.
Die OECD rechnet bei einer Mindeststeuer von 15 Prozent mit Mehreinnahmen von rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr. Die neuen Regeln sollen ab 2023 gelten, was als ambitioniert gilt. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz zeigte sich bei seiner Ankunft in Venedig optimistisch. „Bei der globalen Mindeststeuer gibt es keine Knackpunkte mehr“, sagte er. Das Projekt sei nicht mehr in Gefahr.
Außerhalb der Politik gibt es heftige Kritik an den Plänen. Die Entwicklungsorganisation Oxfam bezeichnete die Steuer als „unfair“ und „zu niedrig“. Sie kritisiert, dass die G7-Staaten davon profitieren würden, da viele der großen Konzerne dort angesiedelt seien – und zwar auf Kosten ärmerer Länder.
Die globalisierungskritische Bewegung Attac stößt ins gleiche Horn. Attac sieht keine gerechte und effektive Lösung im Kampf gegen Konzern-Steuertricks. „Die globale Mindeststeuer von 15 Prozent wird den globalen Steuerwettlauf nach unten nicht stoppen, sondern anheizen“, heißt es. Die Aufteilung der zusätzlichen Einnahmen beider Säulen der Reform würden ärmere Staaten benachteiligen, die schon jetzt am meisten unter den Gewinnverschiebungen leiden, massiv. Attac fordert eine globale Mindeststeuer von 25 Prozent.
*** Zweifel über erwartete Mehreinnahmen ***
Es herrschen auch Zweifel über die Mehreinnahmen für die Staaten. Nach Ansicht des Siemens-Konzerns entstünde ein massiver Aufwand für Firmen und Finanzämter. „Der Berechnungsaufwand für die Unternehmen und der Prüfaufwand für die Finanzverwaltungen weltweit sowie die Risiken von Doppelbesteuerung dürften mit den voraussichtlich moderaten fiskalischen Effekten in keinem vernünftigen Verhältnis stehen“, so der Konzern.
Siemens gehört zu den größten deutschen Unternehmen, die der Mindeststeuer unterlägen. Zudem könnte der Konzern künftig davon betroffen sein, dass die 100 größten und profitabelsten Unternehmen weltweit ihre Steuern mehr als bisher dort zahlen sollen, wo sie am Markt aktiv sind, und weniger am Ort ihres Firmensitzes. (ede/apa)
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111982-Die-globale-Mindeststeuer-hat-noch-einen-gewaltigen-Haken.html
BÖRSEN
SENTIX-Sentimente: Nicht allzu starke, kurzfristig saisonal gestützte Kaufsignale im Time-Differential-Index – Bremsend wirkt die Eintrübung der strategischen Lage in China – SENTIX, 11.7.2021
Die moderate Korrektur im Wochenverlauf hat einen erstaunlich großen Einfluss auf die Stimmungslage bei Aktien. Bei einem gleichzeitig stabilen Grundvertrauen entstehen Kaufsignale im Time-Differential-Index (TD-Index). Statistisch sind diese sehr interessant, doch dürften zwei Gründe die Bullen-Träume begrenzen: zum einen das nahende Ende der saisonalen Unterstützung und zum anderen die weitere Eintrübung der strategischen Lage in China.
Weitere Ergebnisse. * Edelmetalle: Positive Bias-Entwicklung * Rohöl: Strategischer Bias kippt ab
QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-28-2021.html
Alexander Trentin: Private Equity ist keine Wunderinvestition – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 7.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/cdt-07-juli-2.jpg
Im Vergleich zu Aktien sind Private-Equity-Anlagen riskanter, aber dennoch nicht rentabler. Die obige Grafik illustriert das: Sie zeigt den Vergleich in der Performance und der Bandbreite von Fonds für traditionelle Anlageklassen – Anleihen und Aktien – sowie von Private Equity, also nicht kotierten Unternehmensbeteiligungen. Eine grössere Version der Grafik ist hier verfügbar.
Bei einer Investition von 2000 bis 2017 hat ein Investment in US-Anleihen am wenigsten durchschnittliche Rendite gebracht. Bei den Aktienfonds wurden globale Aktien von amerikanischen Large Caps und Small Caps mit einem kleinen Abstand geschlagen. Unter den Private-Equity-Fonds können nur die Kategorien Buyout und notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) in puncto durchschnittlicher Performance mit den US-Aktien mithalten. Die mittlere Rendite der Anlagevehikel in den Bereichen Risikokapital (Venture Capital), Wachstumskapital (Growth Capital), Immobilien (Real Estate) und natürlichen Ressourcen (Natural Resources) fällt dagegen geringer aus.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2092/
Christof Welzel: 3 Gründe, warum Millionäre immer reicher werden – The Motley Fool, 4.7.2021
Im letzten Jahr (2020) ist die Zahl der in Deutschland lebenden Millionäre (in US-Dollar gerechnet) um 4,7 % auf 1.535.100 gestiegen. Weltweit ist sie um 6,3 % auf 20,8 Mio. Menschen gestiegen. Dabei ist das Vermögen dieser Menschen allerdings nicht außergewöhnlich stark um 7,6 % auf 80 Billionen US-Dollar gestiegen.
Viele Berichte suggerieren, dass die Millionäre nur ihren Luxus genießen. Meist ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. So stecken die Vermögen häufig in den selbst aufgebauten Firmen und mit einer 40-Stunden-Woche wäre der Aufbau der Vermögen ebenfalls nicht machbar gewesen.
Hier sind drei Gründe, warum einige Menschen immer mehr Vermögen aufbauen.
- Millionäre setzen sich Ziele
Unabhängig davon, wie viel Vermögen wir gerade besitzen, ist der Entschluss, mehr Vermögen aufzubauen, entscheidend. Nur wenn wir unser Ziel aufschreiben und es uns immer vor Augen halten, unternehmen wir im Alltag die richtigen Schritte. Entscheidend ist also nicht die aktuelle finanzielle Situation, sondern für welchen Weg wir uns entscheiden. - Schritt für Schritt zu mehr Vermögen
Menschen werden nicht durch Zufall immer reicher, sondern weil sie jeden Tag entsprechend handeln. Für sie zählt meist jeder Cent, obwohl sie kleine Beträge vernachlässigen könnten. So wird beispielsweise keiner der Millionäre mehr ausgeben, als er einnimmt. Im Gegenteil: Meist treiben sie die Sparsamkeit sogar auf die Spitze. Wer nur diese eine Regel befolgt, wird stetig mehr Vermögen aufbauen. - Millionäre investieren
Unsere Gruppe der reichen Menschen wird aber nicht nur durch ihren Fleiß und die Sparsamkeit reicher, sondern hauptsächlich, weil sie das Geld dauerhaft klug investiert. So geht aus Studien hervor, dass Millionäre im letzten Jahr vor allem über Aktien und Immobilien mehr Vermögen aufgebaut haben. Langfristig ist so eine Durchschnittsrendite von 7 % keine Seltenheit.
Die meisten Menschen besitzen hingegen keine Investments und halten das Geld auf dem Konto. Hier verliert es jedoch permanent an Kaufkraft. Nehmen wir nun den Zeitraum von nur 30 Jahren und wir erkennen, warum einige Menschen ihr Vermögen mehr als versiebenfachen, während es bei der Masse mehr als die Hälfte an Kaufkraft verliert.
*** Ein interessantes Experiment ***
In diesem Zusammenhang ist ein Experiment interessant, bei dem einer Gruppe von Menschen 10.000 Euro zur Verfügung gestellt wurde. Nach einem Jahr wurden sie befragt, wie sich der Betrag entwickelt hat. 80 % der Menschen hatten ihn komplett ausgegeben. 16 % konnten den Betrag erhalten und nur 4 % schafften es, ihn zu vermehren. Das Experiment zeigt eindrucksvoll, dass nur das dauerhaft richtige Verhalten zu mehr Vermögen führt.
QUELLE: https://www.fool.de/2021/07/04/3-gruende-warum-millionaere-immer-reicher-werden/
Großteil der Einkünfte bleibt auf dem Gehaltskonto liegen: Wohin mit dem Ersparten? „Negativzinsen tun den Menschen weh“ – Nettosparquote lag bei 23 Prozent – Risikotragfähigkeit wegen langen Anlagehorizonts: Aktieninvestments sinnvoll für Jüngere – Für Menschen mit 55+ kurzfristige verfügbare Liquität bedeutsamer – n-tv, 9.7.2021
Zinsen sind niedrig, wenn es überhaupt welche gibt. Internetplattformen wie WeltSparen bieten deshalb einen Überblick über die Angebote auf dem Markt. Geschäftsführer Tamaz Georgadze erzählt im Podcast „Die Stunde Null“ über die historischen Ersparnisse der Deutschen in den letzten Monaten.
Beschränkte Reisemöglichkeiten, geschlossene Restaurants, keine Konzerte: Während der Pandemie haben die Deutschen sehr viel gespart. „Die Nettosparquote lag bei 23 Prozent im ersten Quartal“, sagt Raisin-Chef Tamaz Georgadze im Podcast „Die Stunde Null“. „Das ist tatsächlich der absolute Rekord. Normalerweise liegt es bei 12 bis 14 Prozent.“ Allerdings bleibe ein Großteil der Ersparnis auf dem Gehaltskonto liegen: „Das tut den Kunden natürlich weh, weil das ein automatischer Wertverlust ist.“
Raisin hat mit seiner Internetplattform WeltSparen vor diesem Hintergrund viele neue Kunden gewonnen: Auf der Plattform lassen sich Angebote von mehr als 100 europäischen Bänken vergleichen, um am Ende die bestmöglichen Zinsen zu bekommen. „Wir hatten das beste Quartal unserer Geschichte, trotz aller widrigen Marktumstände“, sagt Georgadze. Zwar investieren immer mehr Deutsche inzwischen auch an der Börse. Allerdings handelt es sich dabei nach Einschätzung des Raisin-CEOs vor allem um „die jüngeren Bevölkerungsschichten“. Der Grund: „Die Risikotragfähigkeit im jungen Alter ist sehr hoch, weil die Anlagezeiträume sehr lang sind“. Der Durchschnittskunde von Raisin sei hingegen in einem Alter von 55 Jahren. Für den sei „eine kurzfristig verfügbare Liquidität“ wichtig und Festgeld für ein bis drei Jahre daher ein sehr wichtiges Anlageprodukt.
Unlängst hat Raisin eine Fusion mit dem Hamburger Konkurrenten Deposit Solutions verkündet, der die Plattform Zinspilot betreibt. Das Gemeinschaftsunternehmen namens Raisin DS wird laut Einschätzung von Branchendiensten mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet und 170 Partnerbanken haben. Ziel ist es, ein großes europäisches Unternehmen aufzubauen, das auch in den USA wettbewerbsfähig sein kann. Eine solche Größe allein zu erreichen hätte „deutlich länger gedauert und sehr viel mehr Energie in Anspruch genommen“, sagt Georgadze, der die Führung des Gemeinschaftsunternehmens übernehmen soll.
QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/audio/Podcast/Negativzinsen-tun-den-Menschen-weh-article22673372.html
ZENTRALBANKEN
- CHINA / PBoC
Chinas Notenbank senkt Reserveanforderung um 0,5 Prozentpunkte – DJN, 9.7.2021
Die People’s Bank of China (PBoC) senkt die Reserveanforderung für Banken um 0,5 Prozentpunkte. Die Änderung tritt am 15. Juli in Kraft, wie die Notenbank mitteilte. Mit dem Schritt wird die Liquidität im Bankensystem um 1 Billion Yuan (rund 130 Milliarden Euro) erhöht.
Die Mindestreseve sind Guthaben, die die Banken bei der Zentralbank unterhalten müssen. Die Mindestreservepolitik ist eines der Instrumente einer Notenbank zur Beeinflussung der Geldmenge.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53370096-chinas-notenbank-senkt-reserveanforderung-um-0-5-prozentpunkte-015.htm
- EUROPÄISCHE UNION / EZB
Hans Bentzien: Lagarde: Das sind die fünf wichtigsten EZB-Strategieänderungen – DJN, 8.7.2021
EZB-Präsidentin Christine Lagarde betrachtet die folgenden fünf Punkte als die wichtigsten der neuen geldpolitischen Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB):
- Inflationsziel
Die EZB strebt nicht mehr eine Inflation von unter, aber nahe 2 Prozent an, sondern glatt 2 Prozent. Damit macht sie laut Lagarde klar, dass 2 Prozent keine Obergrenze sind. Es gebe nun eine bessere Balance zwischen zwei Zielen: Einerseits genug geldpolitischen Spielraum zu haben, um Disinflation zu widerstehen und sie zu bekämpfen und andererseits, die hohen Wohlfahrtskosten einer zu hohen Inflation zu vermeiden. - Symmetrie
Das Bekenntnis zu einem symmetrischen Inflationsziel – Abweichungen in beide Richtungen sind unerwünscht – gibt es schon seit Juli 2019. Es wurde aber, wie Lagarde sagte, nicht richtig wahrgenommen. „Wir haben es nun ins Zentrum unseres Statements gestellt“, sagte Lagarde. Es gebe da keine Mehrdeutigkeit mehr. Die Nähe zur effektiven Zinsuntergrenze erfordert laut der neuen Strategie „kraftvolle oder anhaltende“ geldpolitische Maßnahmen. Andernfalls besteht das Risiko, dass sich die Inflationserwartungen auf einem zu niedrigen Niveau verfestigen. „Das ist sehr schlecht für Preisstabilität und für unseren Handlungsspielraum“, sagte Lagarde. - Kosten selbst genutzten Wohneigentum
Diese sollen nach dem Willen der EZB bei der Inflationsmessung besser berücksichtigt werden. Bis sie in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex integriert sind, will die EZB andere Indizes verwenden, die diese Kosten widerspiegeln. - Klimamaßnahmen Teil der geldpolitischen Strategie
Sie sind laut Lagarde „zentral“ für den geldpolitischen Handlungsrahmen und die geldpolitischen Operationen. Lagarde stellte in dieser Hinsicht „sehr innovative Modelle“ der EZB in Aussicht. - Geldpolitische Analysesäulen
Anstand zweier geldpolitischer Analysesäulen – der ökonomischen und der monetären – gibt es nun eine ökonomische sowie eine monetäre und finanzielle Säule. Die EZB will diese beiden Säulen integrieren, weil es zwischen beiden viele Verbindungen und Wechselwirkungen gebe. Die monetäre Säule konzentriert sich Lagarde zufolge schon länger auf das Erkennen finanzieller Ungleichgewichte und die Übertragung des geldpolitischen Signals. Dagegen habe sich der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation, auf den die monetäre ursprünglich gerichtet habe, gelockert.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53362436-lagarde-das-sind-die-fuenf-wichtigsten-ezb-strategieaenderungen-015.htm
Strategieüberprüfung der EZB – EZB, 8.7.2021
Mit unserer Strategieüberprüfung wollten wir sicherstellen, dass die geldpolitische Strategie der EZB heute und in Zukunft ihren Zweck erfüllt.
Bei der Überprüfung wurden alle Aspekte unserer Geldpolitik im Rahmen unseres Mandats, also der Gewährleistung stabiler Preise, behandelt.
Wir haben uns die Standpunkte von Menschen aus ganz Europa angehört: von Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Mitgliedern des Europäischen Parlaments und zivilgesellschaftlichen Organisationen.
„Unsere neue Strategie ist ein solides Fundament. Sie wird uns künftig bei der Durchführung unserer Geldpolitik leiten.“
Es folgen einzelne Kastentext samt Links zu ausgewählten Themen.
QUELLE: https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/index.de.html
Hans Bentzien: Neue geldpolitische Strategie: EZB strebt glatt 2% Prozent Inflation an – Überschreitungen erlaubt – DJN, 8.7.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich auf die wichtigsten Elemente einer neuen geldpolitischen Strategie geeinigt, deren wichtigstes ein Inflationsziel von glatt 2 Prozent ist. Ein Über- oder Unterschreiten ist laut EZB gleichermaßen unwillkommen. Sie will jedoch in Zeiten, in denen sie an der Zinsuntergrenze operiert, besonders kraftvoll oder ausdauernd agieren und dabei auch eine zeitweise und moderate Überschreitung des Inflationsziels tolerieren.
Bisher steuert die EZB mittelfristig eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2 Prozent an. Mit ihrer neuen Strategie reagiert die EZB auf den stetigen Rückgang des realen Gleichgewichtzinses, unter den sie ihren Leitzins senken muss, wenn sie die Wirtschaft stimulieren will.
„Der EZB-Rat ist der Ansicht, dass Preisstabilität am besten gewährleistet ist, wenn mittelfristig ein Inflationsziel von 2 Prozent angestrebt wird“, heißt es in der Mitteilung. Dieses Ziel sei symmetrisch, negative und positive Abweichungen der Inflation von diesem Ziel seien gleichermaßen unerwünscht. „Wenn sich die Wirtschaft in der Nähe der unteren Grenze der Nominalzinsen bewegt, sind besonders energische oder anhaltende geldpolitische Maßnahmen erforderlich, um zu verhindern, dass sich negative Abweichungen vom Inflationsziel verfestigen. Dies kann auch eine vorübergehende Phase implizieren, in der die Inflation moderat über dem Zielwert liegt.“
*** Leitzinsen bleiben Hauptinstrument der Geldpolitik ***
Der EZB-Rat bekräftigte außerdem, dass die Leitzinsen das wichtigste geldpolitische Instrument der EZB bleiben. Andere Instrumente wie Forward Guidance, Ankäufe von Wertpapieren und längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (LTROs), die in den vergangenen zehn Jahren dazu beigetragen hätten, die durch die Zinsuntergrenze verursachten Beschränkungen abzumildern, sollten weiterhin fester Bestandteil des Instrumentariums der EZB sein und bei Bedarf eingesetzt werden.
„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der EZB-Rat gestern die neue geldpolitische Strategie der EZB genehmigt hat“, schrieb EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Mitteilung. Die Überprüfung habe es der EZB ermöglicht, ihr Denken zu hinterfragen, sich mit zahlreichen Interessengruppen auszutauschen, zu reflektieren, zu diskutieren und zu einer gemeinsamen Basis für die Anpassung ihrer Strategie zu gelangen, wobei die Zentralbank ihr Hauptmandat, die Preisstabilität, als gegeben ansehe. „Die neue Strategie ist ein starkes Fundament, das uns bei der Durchführung der Geldpolitik in den kommenden Jahren leiten wird“, so Lagarde.
*** HVPI soll langfristig durch Kosten selbst genutzten Wohneigentums ergänzt werden ***
Der EZB-Rat bestätigte, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nach wie vor das geeignete Maß für die Beurteilung der Preisstabilität sei. Er erkennt jedoch an, dass die Einbeziehung der Kosten für selbst genutztes Wohneigentum in den HVPI die für die Haushalte relevante Inflation besser darstellen würde; dies sei aber ein mehrjähriges Projekt sei. „In der Zwischenzeit wird der EZB-Rat daher bei seinen geldpolitischen Beurteilungen Inflationsmaße berücksichtigen, die erste Schätzungen der Kosten für selbst genutztes Wohneigentum enthalten, um seinen Satz an allgemeineren Inflationsmaßen zu ergänzen“, hieß es weiter.
Der EZB-Rat habe erkannt, dass der Klimawandel tiefgreifende Auswirkungen auf die Preisstabilität hat, und habe sich dementsprechend zu einem ehrgeizigen klimabezogenen Aktionsplan verpflichtet.
Die neue geldpolitische Strategie, soll erstmals bei der Ratssitzung am 22. Juli angewendet werden. Die nächste Überprüfung dürfte 2025 stattfinden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360327-ezb-strebt-glatt-2-prozent-inflation-an-ueberschreitungen-erlaubt-015.htm
SIEHE DAZU
=> DOKUMENTATION/Das EZB-Statement zur geldpolitischen Strategie – DJN, 8.7.2021
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360964-dokumentation-das-ezb-statement-zur-geldpolitischen-strategie-015.htm
EZB gewährt sich mehr Flexibilität bei Inflation – dpa-AFX, 8.7.2021
Europas Währungshüter verschaffen sich beim Thema Inflation mehr Spielraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt künftig für den Euroraum eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Das ist zwar etwas höher als die bisher veranschlagten „unter, aber nahe zwei Prozent“.
Zugleich jedoch wird die EZB bei ihrem Bestreben, mittelfristig Preisstabilität im Währungsraum der 19 Staaten sicherzustellen, künftig zumindest zeitweise „moderat über dem Zielwert“ liegende Inflationsraten akzeptieren. Mit einem solchen „symmetrischen“ Inflationsziel ist die Notenbank nicht mehr unmittelbar zum Reagieren gezwungen, sollten die Inflationsraten zeitweilig nach oben oder nach unten von dem prozentualen Ziel abweichen.
Die Euro-Währungshüter empfehlen zudem, künftig auch die Preise für selbstgenutzte Wohnimmobilien mit in Berechnung der Inflationsrate aufzunehmen, die für sie ein zentraler Gradmesser für ihre Geldpolitik ist. Dies sieht die EZB jedoch als längeren Prozess.
Das veränderte Inflationsziel ist ein Kernergebnis der Überprüfung der geldpolitischen Strategie, welche die seit 1. November 2019 amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde angestoßen hatte. In den vergangenen 18 Monaten ging es dabei um die Formulierung von Preisstabilität, das geldpolitische Instrumentarium und die Kommunikation der Notenbank.
Hauptziel der Notenbank ist ein ausgewogenes Preisniveau – im Jargon der Währungshüter: Preisstabilität. Dies sieht die EZB am ehesten gewährleistet, wenn die Preise im Euroraum moderat steigen. Daher wurde schon bei Gründung der EZB im Juni 1998 ein Inflationsziel mit Abstand zur Nullmarke gewählt.
Allerdings lag die Teuerungsrate im Euroraum seit 2013 oft deutlich unter der Zwei-Prozent-Marke. Und das, obwohl die EZB seit Jahren gewaltige Summen billiges Geld in die Märkte pumpt und die Zinsen auf Rekordtief hält. Kritiker werfen der EZB daher schon lange vor, sich mit ihrem starren Inflationsziel in eine Sackgasse manövriert zu haben und fordern mehr Spielraum.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360211-ezb-gewaehrt-sich-mehr-flexibilitaet-bei-inflation-016.htm
Hans Bentzien: Lagarde: EZB will bei Inflation „Symmetrie wiederherstellen“ – DJN, 8.7.2021
EZB-Direktorin Christine Lagarde hat angedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen ihrer neuen Strategie eine zeitweise erhöhte Inflation durchaus bewusst ins Kalkül zieht. Das Ziel einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2 Prozent wie die US-Notenbank verfolge die EZB jedoch nicht.
Lagarde sagte in der Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen geldpolitischen Strategie, dass das symmetrische Inflationsziel von 2 Prozent bedeute, dass Abweichungen nach beiden Seiten unerwünscht seien. Lagarde fuhr fort: „Aber wir erkennen auch an, dass wir wegen der effektiven Zinsuntergrenze, die für uns eine Einschränkung darstellt, spezielle Maßnahmen ergreifen müssen, um, wenn sie so wollen, die Symmetrie wiederherzustellen.“
Deshalb könnten bei einem starken negativen Schock „besonders kraftvolle oder persistente Aktionen“ notwendig werden. „Das könnte zu vorübergehenden Phasen führen, in denen die Inflation moderat über dem Zielwert liegt“, erläuterte Lagarde. Dies müsse sie tun, um dem Risiko zu begegnen, dass sich die Inflationserwartungen auf einem zu niedrigen Niveau verfestigten. „Wir verfolgen aber kein durchschnittliches Inflationsziel“, stellte Lagarde klar.
Ein solches Konzept verfolgt die US-Notenbank. Es sieht vor, dass die Fed nach Perioden mit Inflationsraten unterhalb des Zielwerts Perioden mit höherer Inflation zulassen wird.
Lagarde zufolge wurde die Strategie im EZB-Rat einstimmig beschlossen. Nach dem Ende der Pressekonferenz werde die EZB ausführlichere Erläuterungen zur Strategie veröffentlichen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53361945-lagarde-ezb-will-bei-inflation-symmetrie-wiederherstellen-015.htm
Hans Bentzien: Hintergründe der geldpolitischen EZB-Entscheidung: EZB-Rat waren Finanzierungsbedingungen zu fragil für PEPP-Reduzierung – Analysten wittern Fortführung der Politik des leichten Geldes – DJN, 9.7.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich bei seinen Beratungen am 9. und 10. Juni für eine Fortsetzung des erhöhten Kauftempos unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP entschieden, weil ihm das Finanzierungsbedingungen und der Inflationsausblick insgesamt zu fragil erschienen, um eine Reduzierung des Kauftempos zu riskieren. Im Hinblick auf die Inflationsaussichten gab es durchaus Warnungen davor, dass höhere Erzeugerpreise im aktuellen Umfeld rascher als sonst üblich auf die Verbraucherpreise durchschlagen könnten, wie aus dem Protokoll der Beratungen hervor geht.
„Eine spürbare Verlangsamung des Tempos der Käufe im nächsten Quartal wurde zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unangemessen angesehen. Es wurde die Sorge geäußert, dass jede Änderung der Nettokäufe, die nicht auf einer deutlichen Verbesserung der mittelfristigen Inflationsaussichten beruht, zu einer ungerechtfertigten Verschärfung der Finanzierungs- und Finanzbedingungen führen und Zweifel an der Entschlossenheit des EZB-Rats aufkommen lassen würde, die Inflation wieder auf ihr Ziel zurückzuführen“, heißt es in dem Dokument.
Die meisten Mitglieder hätten daher ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, sich einem breiten Konsens hinter dem Vorschlag von Chefvolkswirt Philip Lane anzuschließen, das Kauftempo unverändert zu lassen.
Der Rat hatte beschlossen, dass das monatliche PEPP-Kaufvolumen im dritten Quartal erneut deutlich höher als in den ersten Monaten des Jahres sein sollte. Allerdings gab er dem Direktorium die Möglichkeit, die Käufe während der Ferienzeit zu reduzieren.
„Die allgemeinen Parameter für die PEPP-Käufe werden weiterhin vom EZB-Rat auf der Grundlage einer vierteljährlichen gemeinsamen Bewertung der Finanzierungsbedingungen und der Inflationsaussichten beschlossen“, heißt es. Sie würden dann vom Direktorium entsprechend den Marktbedingungen, einschließlich der Saisonalität, flexibel umgesetzt.
In der Diskussion wurde einerseits darauf hingewiesen, dass der Preisdruck in der „Pipeline“, der auf der Vorleistungsstufe entstehe, typischerweise nur begrenzt und langsam auf die Erzeugerpreise für Endverbraucherprodukte und von dort auf die Einzelhandelspreise durchschlage. Gleichzeitig wurde aber gewarnt, dass die Entwicklung dieses Mal anders verlaufen könnte.
Die Unternehmen hätten nach einer langen Phase schwacher Gewinne weniger Spielraum als sonst, um den Preisdruck über ihre Margen zu absorbieren, während die deutliche Nachfragebelebung eine Gelegenheit zur Preisanpassung bieten könnte.
„Auch könnte es zu einer größeren Weitergabe höherer Preise auf die Endverbraucherstufen kommen, wenn die Haushalte bereit wären, wegen der unfreiwillig hohen Ersparnisse höhere Preise zu zahlen“, heißt es weiter. Vor diesem Hintergrund wurde demnach argumentiert, dass nicht nur auf kürzere Sicht, sondern auch mittelfristig Aufwärtsrisiken bestehen könnten.
Bei der nächsten Ratssitzung am 22. Juni folgt die EZB bereits ihrer neuen geldpolitischen Strategie, die von Analysten allgemein als etwas „dovisher“ [in etwa: gemäßigter] als zuvor empfunden wird. Das könnte Erwartungen stützen, dass die EZB ihre sehr lockere Geldpolitik länger als bisher gedacht fortführt. Eine Entscheidung über das Pandemiekaufprogramm PEPP wird allgemein für September erwartet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53372312-ezb-rat-waren-finanzierungsbedingungen-zu-fragil-fuer-pepp-reduzierung-015.htm
Hans Bentzien: Weidmann: Neue EZB-Strategie hilft bei Sicherung der Preisstabilität – DJN, 9.7.2021
EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat die neue geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) verteidigt. „Die neue Strategie hilft der Geldpolitik, Preisstabilität für die Menschen im Euroraum zu sichern“, heißt es in einer Erklärung Weidmanns. Eine Inflationsrate von 2 Prozent in der mittleren Frist sei als Ziel klar und leicht zu verstehen. „Wir streben weder niedrigere noch höhere Raten an, das war mir wichtig“, so Weidmann. Bisher hatte die EZB Preisstabilität als eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2 Prozent definiert.
Laut der neuen Strategie kann die Inflation vorübergehend in die eine oder andere Richtung vom Ziel abweichen. „Aber wir machen unsere Geldpolitik nicht von Zielverfehlungen in der Vergangenheit abhängig: Unsere Strategie bleibt nach vorne gerichtet und berücksichtigt die neue Herausforderung der effektiven Zinsuntergrenze“, stellte Weidmann klar.
Das ist der wesentliche Unterschied zwischen der EZB-Strategie und der von der US-Notenbank verfolgten Strategie eines durchschnittlichen Inflationsziels. Letzteres bedeutet, dass die US-Notenbank nach Phasen zu niedriger Inflation auch Phasen erhöhter Inflation tolerieren will.
Klimawandel und Klimaschutz werden laut Weidmann künftig eine bedeutende Rolle dabei spielen, wie die EZB ihr Mandat erfüllt. „Wir bauen nicht nur unsere Analysekapazitäten aus. Es ist richtig, dass wir insbesondere bei den finanziellen Risiken aus Klimawandel und Klimapolitik ansetzen, die Offenlegung notwendiger Informationen fordern und unser Risikomanagement verbessern“, erläuterte der Bundesbank-Präsident.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53368782-weidmann-neue-ezb-strategie-hilft-bei-sicherung-der-preisstabilitaet-015.htm
EZB erwartet keine starke Inflation – dts, 10.7.2021
Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), hat Sorgen vor einem zu starken Anstieg der Inflation zurückgewiesen. „Ich bin mir sicher, dass wir keine übermäßig hohe Inflation erleben werden“, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS).
Zwar gebe es in Deutschland derzeit aufgrund der Pandemie eine relativ hohe Inflation, aber diese Entwicklung sei vorübergehend. Schnabel verteidigte das neue, höhere Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. „Zum einen ist der Anstieg des Inflationsziels minimal. Zum anderen hat ein Ziel von zwei Prozent eine wichtige Funktion: Es schafft zusätzliche Spielräume, damit unsere Geldpolitik ihre stabilisierende Wirkung entfalten kann.“
Die EZB-Direktorin richtete auch einen Appell an die Euro-Mitgliedstaaten: „Jeder Mitgliedstaat muss sich darüber im Klaren sein, dass die Zinsen nicht immer niedrig bleiben werden. Das bedeutet vor allem eines: Die Staaten müssen das viele Geld, das in der Pandemie aus guten Gründen geflossen ist, durch gezielte Maßnahmen so einsetzen, dass sie auf einen nachhaltigen Wachstumspfad kommen.“ Die vor allem in Deutschland noch immer umstrittenen Anleihekäufe der Notenbank bezeichnete Schnabel als Instrumente, die in der Nähe der Nullzinsgrenze wirksam und unverzichtbar seien. Sie zählten zum „normalen Instrumentarium“ der Notenbank.
Schnabel sagte der FAS, dass die EZB in Zukunft Fragen des Klimawandels stärker berücksichtigen werde. „Der Klimawandel ist das größte Risiko, dem sich die Volkswirtschaften in den nächsten Jahrzehnten gegenübersehen, und er hat massive Auswirkungen auf die Preisstabilität und damit auf die Geldpolitik.“ Es sei nicht akzeptabel, dass emissionsintensive Unternehmensaktivitäten durch die Geldpolitik begünstigt würden. Die EZB kauft im Rahmen ihrer Anleihekaufprogramme auch Anleihen von Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53375922-ezb-erwartet-keine-starke-inflation-003.htm
EZB-Negativzins ist laut Rechtsgutachten verfassungswidrig – WOCHENEND-ÜBERBLICK / DJN, 5.7.2021
Die anhaltende Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird in einem Gutachten als verfassungswidrig gewertet. Diese Geldpolitik bedeute eine Enteignung der Sparer und verletze das im deutschen Grundgesetz und im Europarecht garantierte Recht auf Privateigentum, schlussfolgert der frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof in einem Rechtsgutachten für die Sparda Banken.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53323543-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-03-und-04-juli-2021-015.htm
Kirchoff: „Enteignung der Sparer“ Negativzins laut Gutachten verfassungswidrig – n-tv, 3.7.2021
Immer häufiger verlangen Banken von Sparern Negativzinsen. Grund ist die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Diese widerspricht jedoch dem deutschen Grundgesetz und Europarecht, heißt es nun in einem Rechtsgutachten. Erstellt hat es ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter.
Die anhaltende Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird in einem Gutachten als verfassungswidrig gewertet. Diese Geldpolitik bedeute eine Enteignung der Sparer und verletze das im deutschen Grundgesetz und im Europarecht garantierte Recht auf Privateigentum, schlussfolgert der frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof in einem Rechtsgutachten für die Sparda Banken, über das die „Welt“ berichtete.
„Das Sparen darf nicht als Anlageform für die Bevölkerung mit kleinem Vermögen gegenüber der Aktie und der Immobilie als Anlageform für Personen mit höherem Geldeigentum benachteiligt werden“, heißt es demnach in dem Gutachten. Die EZB hatte 2014 erstmals ihren Einlagesatz in den negativen Bereich gesenkt. Aktuell liegt dieser Leitzins, zu dem sich die Banken bei der Zentralbank refinanzieren, bei minus 0,5 Prozent. Trotz steigender Inflation hat die EZB angekündigt, die Niedrigzinspolitik beibehalten zu wollen.
„Mit dem Negativzins wird der Sparer enteignet, obwohl der Staat prinzipiell nicht auf Privateigentum zugreifen darf. Das ist verfassungswidrig und widerspricht auch dem Europarecht“, sagte Kirchhof der Zeitung. Das Grundrecht, Nutzen aus seinem Eigentum ziehen zu können, sei Teil der im Grundgesetz garantierten Eigentümerfreiheit. „Und dieses Grundrecht wird dem Sparer durch die Zinspolitik der EZB genommen“, betonte der Jurist. Sein Gutachten soll am Montag in Berlin veröffentlicht werden.
Laut dem Vergleichsportal Verivox verlangen aktuell 349 Banken Negativzinsen von Privatkunden, fast doppelt so viele wie noch Ende 2020. In dieser Woche hatte auch die drittgrößte deutsche Bank ING angekündigt, ab einem Freibetrag von 50.000 Euro einen Negativzins zu verlangen. (ntv.de, chf/AFP)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Negativzins-laut-Gutachten-verfassungswidrig-article22660310.html
Interview: Ökonom erklärt Negativzinsen „In der Verfassung steht nichts von Sparern“ – n-tv, 5.7.2021
Verfassungsrechtler Paul Kirchhof behauptet, die negativen Einlagezinsen der Europäischen Zentralbank verstießen gegen die Verfassung, da sie Sparer „enteigneten“. Wirtschaftsprofessor Jens Südekum erklärt im ntv.de-Interview, warum er diese Argumentation für ein „Desaster“ hält und was es mit den Minuszinsen der Banken wirklich auf sich hat. …
=> KOMMENTAR AUS FREMDER FEDER
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/In-der-Verfassung-steht-nichts-von-Sparern-article22663302.html
Videobeitrag – Südekum zu Kritik an EZB-Politik „Negativzinsen können gar nicht verfassungswidrig sein“ – n-tv, 5.7.2021
Der frühere Verfassungsrichter Kirchhof hält die Negativ-Zinspolitik der EZB für verfassungswidrig, Sparer würden damit „enteignet“, heißt es in einem Gutachten. Wirtschaftsprofessor Jens Südekum widerspricht aufs Schärfste und erklärt im ntv-Interview, warum das Gegenteil der Fall ist.
QUELLE (inkl. 3:29-min-Video): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Negativzinsen-koennen-gar-nicht-verfassungswidrig-sein-article22663062.html
Hans Bentzien: Sparda-Banken: EZB muss Negativzinspolitik beenden – Bezug zum Kirchhoff-Gutachten – DJN, 5.7.2021
Der Verband der Sparda-Banken hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, ihre Negativzinspolitik zu beenden. „Die seit Jahren andauernde Null- und Negativzinspolitik der EZB trifft unsere Kunden als Sparer und unsere Banken hart“, schreibt Florian Rentsch, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken, in einer Mitteilung. Rentsch beruft sich auf ein von seinem Verband in Auftrag gegebenes wissenschaftliches Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof, demzufolge die Erhebung von Negativzinsen durch die EZB gegen deutsches Verfassungsrecht und gegen europäische Grundfreiheiten verstoße.
In Kirchhoffs Gutachten heißt es, die EZB habe die zentrale Aufgabe, die Stabilität des Geldwertes zu sichern. In diesem Auftrag sei sie in den vergangenen Jahren auch erfolgreich gewesen. „Doch jetzt überschreitet sie mit dem Nullzins und dem Negativzins ihren Auftrag zur Währungspolitik und betreibt Wirtschaftspolitik, um den überschuldeten Staaten billige Kredite und sogar finanzielle Anreize zur weiteren Verschuldung zu bieten.“ Ein solcher Akt jenseits der zugebilligten Kompetenz der EZB überschreite die europarechtlichen Grenzen der Staatsverschuldung und widerspreche dem Verschuldungsverbot des Grundgesetzes.
EZB-Vertreter, unter ihnen auch deutsche, haben die Praxis der Zinserhebung auf Guthaben wiederholt als ein wirksames geldpolitisches Instrument verteidigt. Die Banken selbst geben in der EZB-Quartalsumfrage zur Kreditvergabe seit geraumer Zeit an, dass die negativen Zinsen ihre Nettozinseinnahmen verringern, aber das Volumen der an die Wirtschaft ausgereichten Kredite erhöhen. Ökonomen weisen zudem darauf hin, dass die EZB mit ihren Zinssenkungen lediglich die Entwicklung des realen Gleichgewichtszinses nachvollziehe, unter dem ihre Zinsen liege müssten, wenn sie Wachstum und Inflation stützen wolle.
Die deutschen Banken leiden besonders stark darunter, dass sie auf ihre Überschusseinlagen bei der EZB Zinsen zahlen müssen. Das liegt daran, dass sie im Durchschnitt stärker vom Zinsgeschäft und weniger von Gebühren leben und diese Belastung wegen des starken Wettbewerbs in Deutschland nicht einfach an ihre Kunden weitergeben können.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53329010-sparda-banken-ezb-muss-negativzinspolitik-beenden-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): CDU-Wirtschaftsrat wirft EZB schleichende Enteignung vor – DJN, 5.7.2021
Der Wirtschaftsrat der CDU wirft der Europäischen Zentralbank (EZB) schleichender Enteignung vor. In der Debatte um die Niedrigzinspolitik der EZB unterstützt der Wirtschaftsrat die Kritik des ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof, der die Geldpolitik der EZB in einem Gutachten als verfassungswidrig einstuft.
„Die EZB-Geldpolitik kommt einer schleichenden Enteignung der Bürger in den solideren Staaten gleich. Durch die Niedrigzinspolitik schmelzen Sparguthaben dahin und entwerten Altersvorsorgerücklagen schleichend“, kritisierte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates.
Gleichzeitig heize die EZB eine Ausgabenpolitik der Mitgliedsstaaten mit immer astronomischer anmutenden Summen an, der jeder Vorwand von Corona bis zu Klimarettung nur recht zu sein scheine. „Wer in der EZB, den Euro-Ländern oder auch der EU-Kommission bedenkt noch das Ende? Niederländer und Österreicher, die früher immer hinter und neben Deutschland standen, wirken hier – durch Berlin im Stich gelassen – wie einsame Rufer“, monierte Steiger.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53327111-cdu-wirtschaftsrat-wirft-ezb-schleichende-enteignung-vor-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Schnabel: Hoffnung auf Ende der Niedriginflationsphase – DJN, 4.7.2021
EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die Hoffnung, dass der Euroraum in den nächsten Jahren dem Umfeld niedriger Wachstums- und Inflationsraten entkommen kann – wenn die Europäische Zentralbank (EZB) vorübergehend erhöhte Inflationsraten zulässt. „Eine stärkere und schnellere Überwälzung der erhöhten Erzeugerpreisinflation, eine länger andauernde Wachstumsphase über dem Potenzial der Wirtschaft und eine positive Preis-Lohn-Spirale könnten die Wirtschaft des Euroraums aus dem Umfeld mit niedrigem Wachstum und niedriger Inflation vor der Pandemie herauszuführen“, sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext beim Petersberger Sommerdialog.
Im günstigsten Szenario würde die Inflation laut Schnabel in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich deutlich unter den Niveaus bleiben, die in den 70er und 80er Jahren die Preisstabilität und damit den Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt bedrohten – vor allem dank der stabilitätsorientierten Politik der unabhängigen Zentralbanken.
„Stattdessen bietet die derzeitige Aufbruchstimmung und Zuversicht nach einer langen Periode sehr niedriger Inflation in Verbindung mit erheblichen öffentlichen und privaten Investitionen in digitale und grüne Technologien eine willkommene Gelegenheit, die langfristigen Inflationserwartungen wieder stärker an der Definition des EZB-Rats von Preisstabilität auszurichten“, sagte Schnabel.
Sie selbst sieht zunehmend Anzeichen dafür, dass diese Neuausrichtung allmählich stattfindet. Damit sie nachhaltig werde, müsse die Geldpolitik expansiv bleiben, um die einsetzende Erholung nicht abzuwürgen. „Eine solche Geduld kann dazu führen, dass die Inflationsergebnisse für eine vorübergehende Zeit moderat über unserem Ziel liegen. Dies wird eine notwendige und verhältnismäßige Voraussetzung sein, um die Bedingungen zu schaffen, um einer niedrigen Inflation zu entkommen“, sagte Schnabel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53321122-ezb-schnabel-hoffnung-auf-ende-der-niedriginflationsphase-015.htm
COMMENT: die doppelt abgeweideten Staatsbürger*innen: erst Niedrigzins auf dem Sparbuch, dann Inflation beim Einkauf. Was, wenn die Lohnforderungen fruchten und zu verständlichen Lohnsteigerungen führen?
EZB will Klimaschutz in der Geldpolitik größeres Gewicht geben – dpa-AFX, 8.7.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) will dem Klimaschutz in ihrer Geldpolitik größeres Gewicht geben. Der EZB-Rat habe „einen umfassenden Aktionsplan mit einem ehrgeizigen Fahrplan zur weiteren Einbeziehung von Klimaschutzüberlegungen in seinen geldpolitischen Handlungsrahmen beschlossen“, teilte die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mit.
Mit diesem Beschluss unterstreiche das Führungsgremium der Zentralbank für die 19 Eurostaaten seine Verpflichtung, „ökologische Nachhaltigkeitsüberlegungen systematischer in seiner Geldpolitik zu berücksichtigen“. Das sei eines der Ergebnisse der Strategieüberprüfung, die die EZB in den vergangenen 18 Monaten vorgenommen habe.
Beim Kauf von Unternehmensanleihen habe die EZB bereits damit begonnen, „relevante Risiken des Klimawandels“ in ihren Prüfverfahren für den Ankauf von Vermögenswerten zu berücksichtigen, erklärte die Notenbank.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte sich wiederholt für mehr Engagement für Klima- und Umweltschutz ausgesprochen. Die Französin hatte immer wieder bekräftigt, die EZB werde im Rahmen ihres Mandats zu den Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel beitragen.
Ob Notenbanken umweltpolitische Ziele mit ihrer Geldpolitik unterstützen sollten, ist unter Notenbankern und Ökonomen umstritten. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob eine Zentralbank bei Anleihenkäufen „grüne“ Wertpapiere anderen Papieren vorziehen sollte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360208-ezb-will-klimaschutz-in-der-geldpolitik-groesseres-gewicht-geben-016.htm
Hans Bentzien: EZB will Klima-Transparenz von Emittenten von Unternehmensanleihen – DJN, 8.7.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat zusammen mit einer neuen geldpolitischen Strategie beschlossen, künftig Aspekte des Klimawandels stärker in seiner Geldpolitik zu berücksichtigen. Ein Punkt des Aktionsplans der EZB sieht vor, dass Emittenten von Unternehmensanleihen, die sie als Repo-Sicherheit akzeptiert oder kauft, Informationen zur Verfügung stellen, anhand deren die EZB die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells beurteilen kann. Außerdem will die EZB ihre analytischen Kapazitäten verbessern. Folgende Punkte enthält der Aktionsplan:
- Makroökonomische Modellierung und Auswirkungen auf die geldpolitische Transmission
Die EZB wird die Entwicklung neuer Modelle beschleunigen und theoretische und empirische Analysen durchführen, um die Auswirkungen des Klimawandels und damit verbundener Maßnahmen für die Wirtschaft, das Finanzsystem und die Übertragung der Geldpolitik auf Finanzmärkte, Bankensystem, Haushalte und Unternehmen zu überwachen. - Statistische Daten für Risikoanalysen zum Klimawandel
Die EZB wird experimentelle Indikatoren entwickeln, die relevante grüne Finanzinstrumente und den CO2-Fußabdruck von Finanzinstituten sowie deren Exponierung gegenüber klimabedingten physischen Risiken erfassen. Danach werden solche Indikatoren ab 2022 schrittweise verbessert, auch im Einklang mit den Fortschritten der EU-Politik und -Initiativen im Bereich der Offenlegung und Berichterstattung zur ökologischen Nachhaltigkeit. - Offenlegung der Voraussetzung für Akzeptanz als Repo-Sicherheiten und für Käufe
Die EZB wird Offenlegungsanforderungen für Vermögenswerte des privaten Sektors als neues Zulassungskriterium oder als Grundlage für eine differenzierte Behandlung bei Sicherheiten und Ankäufen von Vermögenswerten einführen. Diese Anforderungen werden die EU-Politik und -Initiativen im Bereich der Offenlegung und Berichterstattung zur ökologischen Nachhaltigkeit berücksichtigen und eine einheitlichere Offenlegungspraxis im Markt fördern, wobei die Verhältnismäßigkeit durch angepasste Anforderungen für kleine und mittlere Unternehmen gewahrt bleibt. Ein detaillierter Plan hierzu soll 2022 veröffentlicht werden. - Verbesserung der Fähigkeiten zur Risikobewertung
Die EZB wird 2022 mit der Durchführung von Klima-Stresstests für die Bilanz des Eurosystems beginnen, um dessen Exponierung gegenüber dem Klimawandel zu bewerten. Dabei wird sie sich auf die Methodik des wirtschaftsweiten Klima-Stresstests der EZB stützen. Darüber hinaus wird die EZB prüfen, ob die vom Rahmenwerk für Bonitätsbeurteilungen im Eurosystem zugelassenen Ratingagenturen die erforderlichen Informationen offengelegt haben, um zu verstehen, wie sie die Risiken des Klimawandels in ihre Ratings einbeziehen. Die EZB wird außerdem prüfen, Mindeststandards für die Einbeziehung von Klimawandelrisiken in ihre internen Ratings zu entwickeln. - Repo-Sicherheitenrahmen
Die EZB wird bei der Überprüfung des Bewertungs- und Risikokontrollrahmens für Repo-Sicherheiten die relevanten Risiken des Klimawandels berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie alle relevanten Risiken widerspiegeln, auch die, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Darüber hinaus wird die EZB weiterhin die strukturellen Marktentwicklungen bei Nachhaltigkeitsprodukten beobachten und ist bereit, Innovationen im Bereich der nachhaltigen Finanzierung im Rahmen ihres Mandats zu unterstützen. - Ankäufe von Vermögenswerten des Unternehmenssektors
Die EZB hat bereits damit begonnen, relevante Risiken des Klimawandels in ihren Due-Diligence-Verfahren für ihre Ankäufe von Vermögenswerten des Unternehmenssektors in ihren geldpolitischen Portfolios zu berücksichtigen. Künftig wird die EZB den Rahmen für die Allokation der Käufe von Unternehmensanleihen anpassen, um im Einklang mit ihrem Mandat Klimaschutzkriterien einzubeziehen. Dazu gehört, dass sich die Emittenten zumindest an der EU-Gesetzgebung zur Umsetzung des Pariser Abkommens orientieren, indem sie klimawandelbedingte Messgrößen oder Verpflichtungen der Emittenten zu solchen Zielen berücksichtigen. Die EZB wird ab dem ersten Quartal 2023 außerdem damit beginnen, klimabezogene Informationen des Programms zum Ankauf von Unternehmensanleihen (CSPP) offenzulegen. - Die Umsetzung des Aktionsplans wird im Einklang mit den Fortschritten bei den EU-Richtlinien und -Initiativen im Bereich der Offenlegung und Berichterstattung zur ökologischen Nachhaltigkeit stehen, einschließlich der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Finanzdienstleistungssektor.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360719-ezb-will-klima-transparenz-von-emittenten-von-unternehmensanleihen-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Enria: Es gibt Banken ohne tragfähiges Geschäftsmodell – DJN, 5.7.2021
Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat ein düsteres Bild des Euroraum-Bankensektors gezeichnet. „Die Kapitalkosten sind höher als die Gewinne auf das eingesetzte Kapital, und das schon seit ziemlich langer Zeit – das bedeutet, dass der Bankensektor als Ganzes Kapital verbrennt“, sagte Enria beim Banking Sector Industry Meeting der IESE Business School. So eine Situation lasse sich für eine bestimmte Zeit aushalten, aber das könne nicht wenig so weitergehen. „Es kommt der Moment, wo man gar keine Investoren mehr findet“, sagte Enria.
Enria zufolge achtet die EZB sehr darauf, dass Institute frisches Kapital aufnehmen können, wenn das nötig ist, was in der aktuellen Lage allerdings sehr schwierig sei. „Ich denke, es muss etwas getan werden. Es gibt Banken, die offen gesagt mittelfristig kein tragfähiges Geschäftsmodell zu haben scheinen“, sagte er. Diese Institute müssten unbedingt einen Partner finden oder sich selbst „radikal restrukturieren“, um ihre Geschäft neu auszurichten und wieder Rentabilität herzustellen.
„Wir glauben, dass es unsere Pflicht ist, Druck auf die Banken zu machen, damit sie mittelfristig wieder auf einen nachhaltigen Kurs kommen“, sagte Enria. Andernfalls gehe es bergab mit ihnen, und am Ende müsse die Aufsicht den Marktaustritt auf eine „wenig vorteilhafte Art“ organisieren.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53330725-ezb-enria-es-gibt-banken-ohne-tragfaehiges-geschaeftsmodell-015.htm
Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität wenig verändert – DJN, 6.7.2021
Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft wenig geändert. Wie die EZB mitteilte, wurden 72 Millionen Euro nach 85 Millionen in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 5 (Vorwoche: 3) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 13 Millionen Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 7. Juli valutiert und ist am 14. Juli fällig.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53336216-nachfrage-der-banken-nach-ezb-liquiditaet-wenig-veraendert-015.htm
USA
US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken – DJN, 8.7.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 2. Juli verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,866 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,718 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 8 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 6,075 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,522 Millionen gestiegen waren. Die API-Daten hatten einen Rückgang von 2,7 Millionen Barrel angezeigt.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 11,3 Millionen Barrel pro Tag um 0,2 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53362996-us-rohoellagerbestaende-staerker-als-erwartet-gesunken-015.htm
SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände – DJN, 7.7.2021
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 8,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,7 Millionen Barrel nach plus 2,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von 2,1 Millionen Barrel. Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53353743-api-daten-zeigen-rueckgang-der-us-rohoellagerbestaende-015.htm
USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet – dpa-AFX, 8.7.2021
In den USA sind die Verbraucherkredite im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat habe die Kreditvergabe um 35,3 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Mittel einen Anstieg um 18,0 Milliarden Dollar erwartet. Im April hatte die Kreditvergabe um revidierte 20,0 Milliarden Dollar (zuvor: 18,6) zugelegt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53364474-usa-kreditvergabe-an-verbraucher-steigt-staerker-als-erwartet-016.htm
Martin Löscher: Online-Geschäfte in den USA: Trendwende beim Lebensmittelkauf – Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 8.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/20210707-spending.jpg
Die Pandemie ist vorbei. Zumindest wenn es nach dem Kaufverhalten der US-Konsumenten geht. Machte der Anteil des Onlineeinkaufs bei Kleidern und Haushaltsgegenständen während der Pandemie bis zu 90% und mehr aus, hat er sich in den vergangenen Quartalen wieder dem Vorpandemieniveau von 30 bis 40% angeglichen.
Anders sieht es hingegen bei Lebensmitteln aus. Nach Beginn der Coronakrise verdoppelte sich der Anteil des Onlinekaufs von 5 auf über 10%. Dort verharrt er seither und hat sich nicht dem Vorkrisenniveau genähert. Im Lebensmitteleinkauf hat die Pandemie nachhaltige Spuren hinterlassen.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2091/
Markit: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im Juni nach Rekordhoch im Mai – DJN, 6.7.2021
Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juni gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 64,6 von 70,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 65,2 vorhergesagt. Vorläufig war für Juni ein Wert von 64,8 ermittelt worden.
Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juni verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel auf 63,7 von 68,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.
„Das Wachstumstempo hat sich im Vergleich zum Rekordhoch im Mai abgeschwächt“, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Teilweise sei dies auf das außergewöhnlich starke Wachstum in den vergangenen Monaten zurückzuführen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53339488-markit-us-dienstleister-mit-nachlassendem-geschaeft-im-juni-015.htm
Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten leicht gestiegen – DJN, 8.7.2021
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 3. Juli wider Erwarten leicht zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 373.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 350.000 vorhergesagt.
Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 371.000 von ursprünglich 364.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 250 auf 394.500.
Trotz des leichten Anstiegs sind die Erstanträge in den vergangenen Monaten deutlich gefallen. Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich vor allem wegen enormer Staatshilfen, Lockerungen von Corona-Beschränkungen und einer zügigen Impfkampagne verbessert.
Im längeren Vergleich liegen die Hilfsanträge jedoch auf erhöhtem Niveau. Kurz vor der Pandemie wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Allerdings herrschte zu diesem Zeitpunkt nahezu Vollbeschäftigung, wovon der US-Arbeitsmarkt aktuell weit entfernt ist.
In der Woche zum 26. Juni erhielten 3,339 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 145.000.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53361217-antraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-wider-erwarten-leicht-gestiegen-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53361382-usa-erstantraege-auf-arbeitslosenhilfe-steigen-leicht-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
CHINA
Frank Heiniger: Eintrübung in China – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 6.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/screenshot-2021-07-05-164750-640×436.jpg
Im Nachgang zum ersten Coronaschock fand China vergleichsweise rasch aus der konjunkturellen Talsohle und trug damit massgeblich zur überraschend schnellen globalen Wirtschaftserholung bei.
Inzwischen mehren sich allerdings die Zeichen, dass die Wachstumslokomotive an Schwung verliert – unter anderem wegen eines neuen Coronaausbruchs in der wichtigen Exportprovinz Guangdong. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe ist jüngst auf 51,3 gefallen. Damit notiert er zwar immer noch im Expansionsterrain, hat aber die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor bewegt sich mit 50,3 auf dem niedrigsten Stand seit April 2020.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2090/
Andrea Thomas(WSJ): VDMA: China löst Deutschland als Exportweltmeister für Maschinen ab – DJN, 7.7.2021
China hat im Corona-Jahr 2020 Deutschland als Exportweltmeister im Maschinenbau abgelöst. Nach Schätzungen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) lag im vergangenen Jahr Chinas Anteil an den weltweiten Maschinenausfuhren mit 165 Milliarden Euro bei 15,8 Prozent des Gesamtexportvolumens. Deutschland exportierte im selben Jahr Maschinen und Anlagen im Wert von 162 Milliarden Euro und erreichte einen Anteil von 15,5 Prozent. Im Jahr 2019 betrug der Vorsprung Deutschlands auf China noch 1,4 Prozentpunkte, so der VDMA.
„Gerade die Corona-Pandemie hat Chinas Aufstieg einen kräftigen Schub verliehen, weil das Land sehr früh und nur sehr kurz betroffen war, während der europäische Absatzmarkt durch die Pandemie einen kräftigen Dämpfer erlitt“, erklärte Ulrich Ackermann, Leiter VDMA Außenwirtschaft.
Allerdings könnte eine starke wirtschaftliche Erholung in der Europäischen Union dafür sorgen, dass die Maschinenexporte aus Deutschland und anderen europäischen Ländern 2021 wieder stärker wachsen. „Aber der langfristige Trend spricht klar für China“, sagte Ackermann.
*** Höhere Wettbewerbsfähigkeit statt Protektionismus ***
Deutschland und die EU sollten nun aber nicht nach Protektionismus rufen, sondern dieser Herausforderung mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen begegnen, forderte der VDMA. Dazu müsse man die eigene Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Gleichzeitig sollte die EU aber „die handelspolitischen Instrumente neu ausrichten und etwa den Binnenmarkt vor subventionieren Wettbewerbern aus China schützen“ sowie Maßnahmen zur Öffnung der chinesischen Märkte für öffentliche Beschaffungen ergreifen, forderte Ackermann.
Die gemeinsame Studie des VDMA mit dem Schweizer Maschinenbauverband Swissmem und dem China-Beratungsunternehmen Sinolytics ergab zudem, dass China in vielen Sektoren im Vergleich zu den internationalen Wettbewerbern noch immer zurückliegt.
So kommen in der Volksrepublik laut VDMA im Durchschnitt nur 187 Industrieroboter je 10.000 Beschäftigte zum Einsatz. In den USA sind es 228 Industrieroboter, in Deutschland 346 und die Spitzenreiter Südkorea (868) und Singapur (918) liegen auf diesem Gebiet noch deutlicher vorn. „Hier gibt es spürbaren Nachholbedarf, der gute Exportchancen verspricht“, erklärte der VDMA.
*** China strebt technologische Autarkie an ***
Laut einer der Studie zugrundeliegenden Umfrage unter 222 Mitgliedsfirmen schätzen rund 36 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer aus Deutschland und der Schweiz die Strategie der chinesischen Regierung „Made in China 2025“ positiv für das eigene Geschäft ein. Dementgegen stünde allerdings, dass die Regierung in Peking eine technologische Autarkie im Maschinenbau anstrebe. „Erhebliche Marktverzerrungen als Folge politischen Handelns sind ein strukturelles Element dieses Ansatzes“, so der VDMA.
China nehme in seinem Streben nach technologischer Autarkie immer stärker Einfluss auf Rahmenbedingungen, technologische Entwicklungen und sogar einzelne Marktsegmente, die deutschen mittelständischen Firmen jetzt und in der Zukunft vor zusätzliche Herausforderungen stellten, erklärte Ackermann.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53347251-vdma-china-loest-deutschland-als-exportweltmeister-fuer-maschinen-ab-015.htm
Als Exportweltmeister abgelöst: China überholt Deutschland im Maschinenbau – n-tv, 7.7.2021
Deutschland ist nicht mehr der weltweit wichtigste Maschinenbau-Exporteur. Der Titel für die meisten gelieferten Maschinen und Anlagen im Jahr 2020 geht an China. Eine große Rolle am Aufstieg spielt auch die Corona-Pandemie.
Deutschlands Maschinenbauer haben nach eigener Berechnung ihren Titel als Exportweltmeister an China verloren. Einer ersten Schätzung des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für das vergangene Jahr zufolge kam China mit 165 Milliarden Euro auf einen Anteil von 15,8 Prozent am gesamten Exportvolumen mit Maschinen und Anlagen.
Deutschland verkaufte demnach Maschinen und Anlagen im Wert von 162 Milliarden Euro ins Ausland und kam damit 2020 auf einen Anteil von 15,5 Prozent an dem auf rund 1048 Milliarden Euro geschätzten globalen Außenhandelsvolumen in diesem Bereich. Im Jahr 2019 hatten die deutschen Anbieter in der Außenhandelsstatistik des Maschinenbaus noch einen Vorsprung von 1,4 Prozentpunkten auf China. Über die Studie hatte zuvor die „Welt“ berichtet.
„Gerade die Corona-Pandemie hat Chinas Aufstieg einen kräftigen Schub verliehen, weil das Land sehr früh und nur sehr kurz betroffen war, während der europäische Absatzmarkt durch die Pandemie einen kräftigen Dämpfer erlitt“, erklärt der Leiter VDMA Außenwirtschaft, Ulrich Ackermann, in einer Mitteilung des Verbandes. „Eine starke wirtschaftliche Erholung in der EU könnte dafür sorgen, dass die Maschinenexporte aus Deutschland und anderen europäischen Ländern 2021 wieder stärker wachsen. Aber der langfristige Trend spricht klar für China.“
Chancen für deutsche Hersteller
Der Aufstieg Chinas eröffnet nach Einschätzung des VDMA zugleich Chancen für deutsche Hersteller. Zum Beispiel gebe es auf dem Gebiet von Industrierobotern „spürbaren Nachholbedarf“ in China, was gute Exportchancen verspreche. Einer der Studie zugrunde liegenden Umfrage unter 222 Mitgliedsfirmen zufolge schätzen rund 36 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer aus Deutschland und der Schweiz die chinesische Strategie „Made in China 2025“ als positiv für das eigene Geschäft ein.
Mit dieser Strategie und dem aktuellen Fünf-Jahres-Plan strebt die Volksrepublik eine technologische Vorherrschaft auf verschiedenen industriellen Feldern an, etwa bei intelligenter Fertigung und Robotik oder in der Landtechnik. (ntv.de, sbl/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/China-ueberholt-Deutschland-im-Maschinenbau-article22667491.html
AUSTRALIEN
NSW Department of Education struck by cyber attack – The state department has taken its systems offline as a precaution as it readies for the start of Term 3 next week – ZDnet, 8.7.2021
The New South Wales Department of Education has on Thursday revealed it fell victim to a cybersecurity attack.
In a statement, the department said a number of its internal systems were deactivated on Wednesday as a precaution.
„The timing of this creates considerable challenges for staff as we prepare for the start of Term 3,“ NSW Education Secretary Georgina Harrisson said. „Thankfully, our teams have been able to isolate the issues and we are working to reactivate services as soon as possible.“
Harrisson said the department’s priority would be the safety and security of its student and staff data, which she explained was why the precautionary decision was made to take some systems offline as it investigates further.
Department of Education and Cyber Security NSW teams are working to ensure normal access is restored in time for the start of Term 3, the statement continued.
Most of NSW is currently in week two of a three-week lockdown in response to the COVID-19 outbreak affecting the state.
„I am confident we will have the issue resolved soon and want to reassure teachers and parents that there will be no impact on students learning from home next week,“ Harrisson said.
„Whilst we are confident all systems will be back online before day 1, Term 3, we are making information to support home learning available on our public website so that preparations for the start of term can continue.“
Education said it has been working closely with Cyber Security NSW to resolve the issue, and that the matter has been referred to the NSW Police and federal agencies.
The department said it was inappropriate to make any further comment as the matter is under investigation.
QUELLE: https://www.zdnet.com/article/nsw-department-of-education-struck-by-cyber-attack/
IRAN
System down: Iran berichtet von Hackerangriff auf Transportministerium – Unklare Berichtslage: Ministerium spricht von „technischen Störungen“, Minister von „Anzeichen für Cyberangriffe“ – Der Standard, 10.7.2021
Teheran – Irans Transport- und Verkehrsministerium soll iranischen Medien zufolge Opfer eines Hackerangriffs geworden sein. Das Ministerium selbst gab am Samstag „technische Störungen“ seines Computersystems bekannt, wodurch seine Mitarbeiter keinen Zugang mehr zum System hätten. Die Ursache werde derzeit untersucht. Staatliche Medien vermuteten, dass es sich um einen Hackerangriff handle.
Kommunikationsminister Mohamed Jawad Azari Jahromi bestätigte das indirekt, in dem er laut Nachrichtenagentur IRNA auf „Anzeichen für Cyberangriffe“ gegen iranische Organisationen hinwies. Schon am Freitag war das Computersystem des nationalen Bahnnetzwerks plötzlich durcheinandergekommen. Es gab diverse Falschinformationen etwa über An- und Abfahrtszeiten der Züge. Auch da war die Rede von einem Hackerangriff, zu dem sich jedoch noch bisher keine Gruppe bekannt hat.
Wiederholte Angriffe
Die Computersysteme mehrerer iranischer Organisationen, insbesondere der Atomorganisation, wurden in den vergangenen Jahren mehrmals gehackt und waren stunden- bis tagelang außer Betrieb. Bisher wurde im Iran stets Erzfeind Israel verdächtigt, hinter den Cyberangriffen zu stehen.
QUELLE: https://www.derstandard.de/story/2000128110635/iran-berichtet-von-hackerangriff-auf-transportministerium
TÜRKEI
Erdogan hat ein Problem Inflationsrate in der Türkei schießt nach oben – n-tv, 5.7.2021
Der Alltag in der Türkei wird immer teurer, vor allem für die Preise von Lebensmitteln geht es kräftig nach oben. Daran wird sich zunächst wohl nichts ändern, denn von Zinserhöhungen will Staatschef Erdogan nichts wissen.
Die Inflation in der Türkei steigt. Im Juni lagen die Verbraucherpreise 17,5 Prozent über dem Niveau des vergangenen Jahres, teilte das türkische Statistikamt mit. Im Mai hatte die Jahresinflationsrate bei 16,6 Prozent gelegen.
Der Preisanstieg ist vor allem bei Lebensmitteln zu spüren. Sie waren im Vergleich zum Vorjahresmonat im Schnitt 20 Prozent teurer. Und es sieht nicht danach aus, dass der Inflationsdruck abnehmen wird. Denn ein wichtiger Indikator für die künftige Preisentwicklung ist nach oben geschossen: Die Erzeugerpreise der Unternehmen stiegen im Juni sogar um 42,9 Prozent. Diese Entwicklung dürfte zeitverzögert auch auf die Konsumenten durchschlagen. Denn steigen die Preise schon ab Fabriktor, werden früher oder später auch die Verbraucher im Handel stärker zur Kasse gebeten.
Hinzu kommt: Die türkische Lira verliert an Wert und macht damit die Einfuhren teurer. Außerdem werden weltweit Rohstoffe teuer – und die muss das rohstoffarme Land in Dollar bezahlen. Auch die schwache Landeswährung trägt also zum Inflationsdruck bei.
Seit Ende 2019 hat die Inflationsrate in der Türkei tendenziell zugelegt. In diesem Zeitraum hat sich die Rate ausgehend von etwa 8 Prozent mehr als verdoppelt. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von fünf Prozent an. Doch von diesem Ziel ist sie weit entfernt.
Ein weiteres Problem: Türkische Unternehmen sind im Ausland stark verschuldet und haben Kredite in Fremdwährungen aufgenommen. Sie bekommen deshalb ein massives Problem: Sie erwirtschaften ihre Gewinne in immer schwächerer Lira und müssen damit Kredite in harten Devisen tilgen.
Das ebenso klassische wie wirksame Mittel, um Inflation und Währungsverfall zu bekämpfen, sind Zinserhöhungen. Denn höhere Zinsen wirken tendenziell preisdämpfend, weil sie Kredite verteuern. Zudem wird Sparen attraktiver. Das heißt: Unternehmen investieren weniger, Verbraucher konsumieren weniger. Dadurch sinkt die Nachfrage nach Produkten – und das macht Preiserhöhungen schwieriger. Zudem machen höhere Zinsen es für Investoren attraktiver, Geld in der Türkei anzulegen. Das führt dazu, dass – wegen der höheren Nachfrage – der Kurs der Lira steigt. Und eine stärkere Währung wirkt wiederum inflationshemmend. Denn im Ausland gekaufte und in die Türkei eingeführte Güter werden damit billiger.
Der Nachteil: Dadurch wird die Konjunktur gebremst – und das möchte Präsident Recep Tayyip Erdogan um jeden Preis verhindern. Denn mit einem kreditfinanzierten Wirtschaftsaufschwung sichert er sich seit vielen Jahren seine Popularität in weiten Teilen der Bevölkerung.
Erdogan bezeichnet Zinsen zudem als „Mutter allen Übels“ und behauptet entgegen der ökonomischen Lehre, dass hohe Zinsen für hohe Inflation sorgen – und niedrige Zinsen für niedrige Inflation. Zwei Notenbank-Präsidenten hat er in jüngerer Zeit ausgetauscht, weil er mit ihrem Kurs unzufrieden war. Derzeit liegt der Leitzins bei 19 Prozent – und ist damit aus Sicht Erdogans zu hoch.
Denn die Türkei steckt in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, die sich auch in hoher Arbeitslosigkeit niederschlägt – auch wenn die Regierung zuletzt die Corona-Beschränkungen angesichts sinkender Neuinfektionen gelockert hat. (ntv.de, jga/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Inflationsrate-in-der-Tuerkei-schiesst-nach-oben-article22663220.html
SIEHE DAZU: Videobeitrag – Chefvolkswirt der Dekabank zu Inflations-Beben: Warum Erdogan Lira und Aktien abstürzen lässt – n-tv, 5.7.2021
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt seinen Notenbankchef überraschend ab und löst damit ein Erdbeben am lokalen Finanzmarkt aus. Die türkische Lira erlebt zu Wochenbeginn den größten Kurssturz seit rund 20 Jahren. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, analysiert die Lage am Bosporus.
QUELLE (inkl. 3:05-min-Video): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Warum-Erdogan-Lira-und-Aktien-abstuerzen-laesst-article22472885.html
GROSSBRITANNIEN
UK food supply chain vulnerable to cyber-attack, expert warns – ‘Complacent reliance’ on overseas produce and computer ordering has put supply at risk – The Guardian, 11.7.2021
Britain’s food supply is highly vulnerable to cyber-attacks, a leading food expert has warned, saying greater emphasis on domestic production would boost the UK’s food security.
“If anyone wanted to really damage the British food system, they could just take out the satellites,” said Tim Lang, professor of food policy at City, University of London. “Our ‘just-in-time’ system is entirely dependent on computerised logistics. When you pay for your food at the checkout, the computer isn’t just adding up the bill, it’s reordering the stock.”
Lang’s warning comes before the publication this month of the second part of a national food strategy commissioned by the government. Henry Dimbleby, co-founder of the Leon restaurant chain, was appointed in 2019 to oversee a review of the UK’s food system. The first part, published last year, said Brexit was a “once-in- a-lifetime opportunity” to reshape policy.
Leaks of the forthcoming report suggest it will recommend a 6% tax on foods with a high salt content, which could increase the price of a Big Mac by 20p and put an extra 5p on a bag of crisps. Dimbleby’s recommendations will be followed by a white paper next year that will lead to a new food act, making the next 12 months critical.
An alternative report, co-authored by Lang, Erik Millstone, emeritus professor of science policy at Sussex University, and Terry Marsden, professor of environmental policy and planning at Cardiff University, says the government has been complacent about food security and “places excessive reliance on others” to feed its population. “Ministers have so far set no clear goals for the UK food system post-Brexit, or even for levels of home production,” the academics say in Testing Times for UK Food Policy, published this week. “The government’s default position is to leave food matters to corporate interests.”
Brexit “has huge implications for food, not least since the UK’s food suppliers are still closely enmeshed with the EU’s. Half a century’s food links are not easily replicated by a new trade deal here or there”.
About a third of food bought in the UK comes from the EU. The exodus of EU workers from Britain over the past 18 months has had a significant impact on food production and distribution.
According to Lang, the UK should be aiming to be 80% self-sufficient in food production, compared with about 50% now. “We currently produce only 52% of the vegetables [we eat], and 10% or 11% of fruit. We import apples and pears. This is ludicrous.”
Four words sum up what is needed in a new food policy, he said. “Food security – is there enough affordable, accessible, sustainable, decent food coming out of sustainable supply systems? And food defence – the need to protect supply lines.”
The national food strategy is overseen by Henry Dimbleby, co-founder of the Leon restaurant chain
There are enormous costs in not adopting an integrated, coherent food policy, added Lang. “Britain has turned food from being a source of life into a source of death – obesity, diabetes, strokes, lowering of life expectancy. There are also social, financial, emotional and environmental costs.
“We’ve lengthened food chains. The distance between the primary producer and the food getting into our mouths involves more and more people. There are delivery services urging us not to even go to the local coffee shop or supermarket – they will bring it to you. The result is that in the UK we spend £225bn a year on food and drink, and the primary producers – farmers and fisherfolk – get about 7% of that.”
Lang and his fellow academics have produced nine principles and tests for a comprehensive food policy that include security, resilience, food poverty and reducing the concentration of food supply in the hands of a few giant companies. Pressure must be brought to bear on the government to prevent it “pandering to incumbent interests”, the report says.
Lang said he hoped Dimbleby’s proposals would sketch out a robust policy based on sustainability. “But the issue is whether it will be taken up, or shelved, eviscerated, cherrypicked by the government.”
QUELLE https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jul/11/uk-food-supply-chain-vulnerable-to-cyber-attack-expert-warns
SIEHE DAZU:
=> Leon restaurants co-founder to lead review of UK food system – Brief for Henry Dimbleby is exploration of sustainable ‘farm to fork’ strategy – The Guardian, 27.6.2021
QUELLE: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/27/leon-restaurants-co-founder-henry-dimbleby-uk-food-system-review
Großbritannien: Wachstum schwächt sich ab – dpa-AFX, 9.7.2021
Die britische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im Mai verringert. Gegenüber dem Vormonat sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Im April hatte das Wachstum mit 2,0 Prozent noch deutlich höher gelegen. Analysten hatten mit einer Verlangsamung auf 1,5 Prozent gerechnet. Noch immer liegt das BIP 3,1 Prozent tiefer als vor Beginn der Corona-Krise.
Der Dienstleistungssektor wuchs den Angaben zufolge um 0,9 Prozent. Das Gastgewerbe expandierte kräftig um rund 37 Prozent. Es profitiert von den Lockerungen zahlreicher Corona-Beschränkungen, unter denen es lange gelitten hat. Das produzierende Gewerbe steigerte seine Leistung um 0,8 Prozent, während der Bausektor schrumpfte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53367500-grossbritannien-wachstum-schwaecht-sich-ab-016.htm
Großbritannien: Dienstleisterstimmung geht leicht zurück – dpa-AFX, 5.7.2021
Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Juni etwas eingetrübt, allerdings von hohem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex der Marktforscher von Markit fiel gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 62,4 Zähler, wie Markit am Montag in London mitteilte. Das sei der zweithöchste Stand seit Oktober 2013. Eine erste Schätzung wurde leicht nach oben korrigiert. Mit mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator klar Wachstum an.
Laut Markit berichteten viele befragte Unternehmen von Kapazitätsengpässen und Personalmangel. Offenbar bereitet es den Firmen Schwierigkeiten, nach den monatelangen Corona-Beschränkungen wieder richtig in Fahrt zu kommen. Die Unternehmen hätten Probleme, mit der anziehenden Nachfrage Schritt zu halten, erklärte Markit.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53326154-grossbritannien-dienstleisterstimmung-geht-leicht-zurueck-016.htm
SCHWEIZ
Erholung stärker und früher als erwartet: Schweizer Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf 2,8% – Kurzarbeit nimmt ebenfalls ab – Langzeitarbeitslosigkeit stabilisiert- Finanz & Wirtschaft/AWP, 8.7.2021
Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fällt etwas stärker aus als erwartet. Insgesamt waren Ende Juni 131’821 Personen als arbeitslos gemeldet.
Die Lage am Arbeitsmarkt hellt sich weiter auf. Erstmals seit März 2020, also seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, ist die Arbeitslosenquote in der Schweiz wieder unter 3% gefallen. Und die Aussichten präsentieren sich weiterhin vielversprechend.
Zumindest gemäss den Aussagen von Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Seco: «Wir sehen ein insgesamt positives Bild. Wir erwarten einen anhaltenden Rückgang der Arbeitslosenquote auf breiter Front in allen Branchen und Regionen», sagte er am Donnerstag anlässlich der neuesten Arbeitslosenstatistik des Seco.
Diese weist für den Juni 131’821 Personen als arbeitslos bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet aus. Das waren 11’145 weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank damit im Vergleich zum Vormonat auf 2,8 von 3,1%.
*** Erholung stärker und früher als erwartet ***
Seit Januar, als die Quote mit 3,7% ihren höchsten Stand seit Frühjahr 2010 erreicht hatte, sei die Quote deutlich gefallen, so Zürcher. Dies sei ein Indiz für eine rasche Erholung des Arbeitsmarktes. «Die Erholung ist damit stärker ausgefallen und früher eingetreten, als wir erwartet hatten.» Den Rückgang im Juni führt er je rund zur Hälfte auf die gute Konjunktur und auf saisonale Gründe zurück.
Insbesondere auf dem Bau und im Gastgewerbe ist die Situation besser als auch schon. Das Gastgewerbe profitiert einerseits vom Beginn der Sommersaison und andererseits von den Lockerungen hinsichtlich der wegen der Pandemie verhängten Restriktionen. Dass man sich in den Gartenbeizen wieder in unbeschränkter Zahl und ohne Masken um einen Tisch scharen kann, hilft sehr, nicht zuletzt etwa beim gemeinsamen Genuss von Fussballabenden.
Ein Zeichen für die Erholung am Arbeitsmarkt ist auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen. Dies lag Ende Juni mit knapp 61’000 um beinahe 10% über dem Stand von Ende Mai und war beinahe doppelt so hoch wie im Juni vor einem Jahr. «Wir verzeichnen die höchste je gemeldete Zahl an offenen Stellen. Dies zeigt eine hohe Dynamik am Arbeitsmarkt an», erklärte Zürcher.
*** Kurzarbeit nimmt ebenfalls ab ***
Die Kurzarbeit, mit der die negativen Corona-Effekte während der Krise abgefedert wurden, zog zu Beginn des Jahres wegen den vom Bund im zweiten Corona-Lockdown ergriffenen Massnahmen bekanntlich im Januar und Februar wieder an. Nach dem Rückgang im März ging die Kurzarbeit im April, zu dem nun aktuelle Zahlen vorliegen, erneut zurück. In diesem Monat waren 304’284 Personen von Kurzarbeit betroffen, das waren knapp 11% weniger als im Monat davor.
Laut Zürcher reduzierte sich sowohl die Nutzung der Kurzarbeit als auch der insgesamt entschädigte Arbeitsausfall. Im Durchschnitt lag der Anteil an ausgefallenen Arbeitsstunden im Juni bei 40%, im April waren es noch 60%.
*** Langzeitarbeitslosigkeit stabilisiert ***
Wenig verändert zeigt sich derweil die Situation der Langzeitarbeitslosen. Rund ein Viertel der gemeldeten Arbeitssuchenden sind seit mehr als 12 Monaten arbeitslos, womit sie als Langzeitarbeitslose gelten. Konkret sind dies per Ende Juni 34’234 Personen, entsprechend einer Quote von 0,7%.
Im Vergleich zum Vormonat Mai ist die Zahl damit um knapp 1 Prozent zurückgegangen, womit sich die Situation gemäss Zürcher stabilisiert habe. Er stellt die Quote von 0,7% in Relation zum prozentualen Anteil der Langzeitarbeitslosen auf dem Höhepunkt der Finanzkrise vor über 10 Jahren. Damals erreichte diese im Maximum einen Wert von 0,8%.
«Die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit zeigt ein Abbild der aktuellen Krise», sagte Zürcher. Es brauche etwas Zeit, bis die Zahl derjenigen zurückgehe, die schon lange nach einer Arbeit suchen. Mit der Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosenunterstützung werde den Arbeitnehmern diese Zeit aber auch verschafft.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/arbeitslosenquote-sinkt-im-juni-auf-28/
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
Limitierte Bargeldeinkäufe – Pressespiegel / DJN, 8.7.2021
Die EU-Kommission plant der Süddeutschen Zeitung zufolge eine europaweite Höchstgrenze für Bargeldgeschäfte. In zwei Wochen will die Behörde ein Gesetzespaket für den Kampf gegen Geldwäsche präsentieren, und die SZ berichtet unter Berufung auf Entwürfe der Rechtsakte, dass die Kommission ein Bargeldlimit von 10.000 Euro einführen will. In einigen Mitgliedstaaten existieren ohnehin solche Limits, nicht aber in Deutschland. Außerdem sehen die Entwürfe der SZ zufolge vor, bis Anfang 2023 eine EU-Behörde zum Kampf gegen Geldwäsche zu etablieren. (Süddeutsche Zeitung, FT)
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53355307-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm
Ifo, KOF und Istat stellen Eurozone Economic Outlook ein – DJN, 7.7.2021
Die Wirtschaftsforscher des Ifo-Instituts, der KOF-Konjunkturforschungsstelle in Zürich und des Istat in Rom haben den Eurozone Economic Outlook eingestellt. Die letzte Ausgabe sei im März veröffentlicht worden, teilte das Ifo-Institut mit. Diese Kurzfristprognose für den Euroraum erschien seit Januar 2004 viermal im Jahr.
Die Prognose umfasste eine Schätzung des realen Bruttoinlandsprodukts, der Konsumausgaben der privaten Haushalte, der Bruttoanlageinvestitionen, der Industrieproduktion und der Inflationsrate im Euroraum für das abgelaufene Quartal und eine Prognose für das laufende und das folgende Quartal.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53346641-ifo-kof-und-istat-stellen-eurozone-economic-outlook-ein-015.htm
Christoph Herwartz: Umbau der Wirtschaft: Die Industrie warnt vor erheblichen Risiken der EU-Klimastrategie – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 6./7.7.2021
Am 14. Juli stellt die EU-Kommission ihre umfassenden Klimaschutzpläne vor. Für viele Unternehmen bergen die Gesetzesentwürfe große Gefahren.
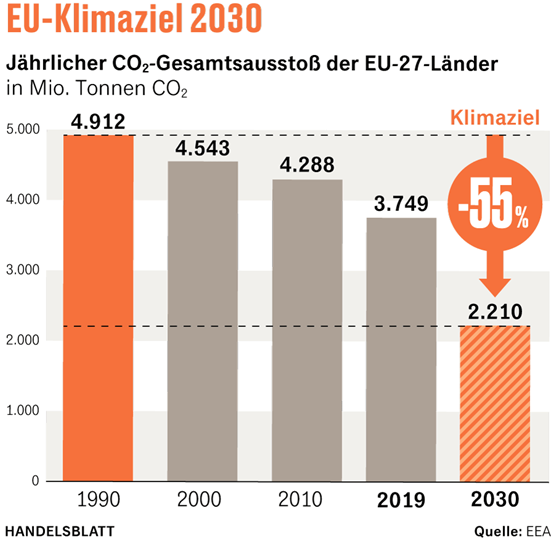
Für das größte Umbauprojekt der europäischen Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg wird das Tempolimit allenfalls einen homöopathischen Beitrag liefern können. Die Rede ist von der Reduktion des CO2-Ausstoßes um 55 Prozent bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 1990. Allmählich wird bekannt, was in dem Richtlinien- und Verordnungspaket steht, mit dem die EU-Kommission dieses Ziel durchsetzen wird. Unseren Brüsseler Kollegen liegen nun die Details vor.
In den Fokus rückt dabei der sogenannte CO2-Grenzausgleich. Mit diesem Klimazoll sollen energieintensive Produkte belegt werden, die aus Staaten mit laxerer Klimapolitik in die EU eingeführt werden. Umgekehrt könnten Exportsubventionen nötig werden, um zum Beispiel klimaneutral produzierten europäischen Stahl auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu halten. Es geht in den kommenden Jahren also nicht nur um einen Umbau der Wirtschaft, sondern auch um neue Regeln für den Welthandel.
Talking Point für den nächsten Davos-Stammtisch: Wird diese neue Handelsordnung im Rahmen der moribunden Welthandelsorganisation WTO entstehen? Oder sie endgültig ins politische Jenseits befördern?
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/umbau-der-wirtschaft-die-industrie-warnt-vor-erheblichen-risiken-der-eu-klimastrategie/27396492.html
Hans Bentzien: EU-Kommission hebt Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 an – DJN, 7.7.2021
Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums im laufenden und kommenden Jahr angehoben. Wie sie im Rahmen ihrer Sommerprognose mitteilte, rechnet sie für 2021 jetzt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,8 (Frühjahrsprognose: 4,3) Prozent. Für 2022 werden nun 4,5 (4,4) Prozent Wachstum erwartet. Dadurch wird das BIP sein Vorkrisenniveau laut EU-Kommission bereits im vierten Quartal erreichen. In der Frühjahrsprognose war dies noch für das erste Quartal 2022 avisiert worden.
Die Kommission nannte zwei Hauptgründe für die Prognoseanhebung: „Erstens hat die Aktivität im ersten Quartal des Jahres die Erwartungen übertroffen. Zweitens führten eine effektive Strategie zur Eindämmung des Virus und Fortschritte bei Impfungen zu sinkenden Zahlen von Neuinfektionen und Krankenhausaufenthalten, was wiederum den EU-Mitgliedsstaaten erlaubte, ihre Volkswirtschaften im folgenden Quartal wieder zu öffnen.“
*** Aufschwung des Privatkonsums bereits jetzt im Gang ***
Positive Umfrageergebnisse bei Verbrauchern und Unternehmen sowie Mobilitätsdaten deuten laut EU-Kommission darauf hin, dass ein starker Aufschwung des privaten Konsums bereits im Gange ist. Darüber hinaus gebe es Anzeichen für eine Belebung des Tourismus in der EU, der von der Einführung des neuen digitalen Covid-Zertifikats der EU ab dem 1. Juli profitieren sollte. „Diese Faktoren werden voraussichtlich schwerer wiegen als die negativen Auswirkungen der temporären Rohstoffknappheit und der steigenden Kosten in Teilen des verarbeitenden Gewerbes“, erläuterte die Kommission.
Die Risiken für ihre Prognosen sind laut Kommission ausgewogen, zwei von ihnen hebt sie jedoch hervor: „Die Risiken, die durch das Auftreten und die Verbreitung von Covid-19-Virusvarianten entstehen, unterstreichen die Notwendigkeit beschleunigter Impfkampagnen.“ Und: „Die Inflation könnte höher ausfallen als prognostiziert, wenn die Versorgungsengpässe länger andauern und der Preisdruck stärker an die Verbraucher weitergegeben wird.“
*** Deutsches BIP dürfte 2021 um 3,6 Prozent steigen ***
Der deutschen Volkswirtschaft traut die Behörde in diesem Jahr ein Wachstum von 3,6 (3,4) Prozent zu. Für 2022 wird ein Plus von 4,6 (4,1) Prozent erwartet. Die Deutsche Bundesbank hatte im Juni Wachstumsraten von 3,7 und 5,2 Prozent vorausgesagt. Frankreichs Wachstumsprognose für 2021 wurde auf 6,0 (5,7) Prozent erhöht und die für 2022 mit 4,2 Prozent bestätigt. Für Italien erwartet die Kommission 5,0 (4,2) und 4,2 (4,4) Prozent Wachstum.
Den Prognosen zufolge wird die Inflation im Euroraum von 0,3 Prozent 2020 auf 1,9 (1,7) Prozent im laufenden Jahr steigen, bevor sie 2022 auf 1,4 (1,3) Prozent zurückgeht. Sowohl die Wachstums- als auch die Inflationsprognosen der Kommissionen weichen nur marginal von denen der Europäischen Zentralbank (EZB) ab.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53347129-eu-kommission-hebt-wachstumsprognosen-fuer-2021-und-2022-an-015.htm
Markit: Stärkstes Wachstum im Euroraum seit 15 Jahren – DJN, 5.7.2021
Dank boomender Geschäfte in Industrie und Servicesektor hat die Eurozone im Juni das stärkste Wirtschaftswachstum seit 15 Jahren verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 59,5 Zähler von 57,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.
Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 59,2 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer des Markit-Instituts ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.
„Die wirtschaftliche Erholung in Europa hat im Juni einen Gang zugelegt, aber auch der Inflationsdruck hat zugenommen“, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. „Die Dienstleister erhöhen aktuell ihre Preise so stark wie seit über 20 Jahren nicht mehr, da die Kosten in die Höhe schnellen.“
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 58,3 Punkte von 55,2 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Wert von 58,0 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53325829-markit-staerkstes-wachstum-im-euroraum-seit-15-jahren-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases
Hans Bentzien: EU-Kommission schlägt freiwilligen Green-Bond-Standard vor – DJN, 6.7.2021
Die EU-Kommission hat eine neue Strategie für ein nachhaltigeres Finanzsystem und einen Standard für „grüne Anleihen“ (European Green Bond Standard) vorgeschlagen.
Laut Mitteilung der Kommission sieht die Nachhaltigkeitsstrategie folgende Punkte vor:
- Erweiterung der existierenden Instrumente für nachhaltige Finanzierung, um den Zugang zu Finanzierungen für den Übergang zu einer inklusiven und kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erleichtern
- Verbesserte Möglichkeiten der Teilhabe am Wirtschaftswachstum für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Verbraucher durch die richtigen Instrumente und Anreize
- Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Wirtschafts- und Finanzsystems gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken
- Den Beitrag des Finanzsektors zur Nachhaltigkeit erhöhen
- Sicherstellung der Integrität des EU-Finanzsystems und Überwachung seines geordneten Übergangs zur Nachhaltigkeit
- Internationale Initiativen und Standards für nachhaltige Finanzen entwickeln und EU-Partnerländer unterstützen
Der „freiwillige“ Green-Bond-Standard soll allen privaten und staatlichen Emittenten eine Orientierung bei der Finanzierung nachhaltiger Investments geben. Er ist als „Goldstandard“ gedacht, der auch dazu dient, Investoren vor „Green Washing“ zu schützen. Das sind die vier wichtigsten Anforderungen des Standards:
- Die durch die Anleihe aufgebrachten Mittel sollten vollständig für Projekte verwendet werden, die mit der EU Taxonomie übereinstimmen
- Es muss über detaillierte Berichtsanforderungen sichergestellt werden, dass volle Transparenz über die Verwendung der Anleiheerlöse besteht
- Alle grünen EU-Anleihen müssen von einem externen Prüfer kontrolliert werden, um die Einhaltung der Verordnung zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass die finanzierten Projekte mit der Taxonomie übereinstimmen. Spezifische, begrenzte Flexibilität ist hier für staatliche Emittenten vorgesehen
- Externe Prüfer, die Dienstleistungen für Emittenten grüner EU-Anleihen erbringen, müssen bei der Europäischen Wertpapiermarktaufsichtsbehörde registriert sein und von ihr beaufsichtigt werden. Auch hier ist eine spezifische, begrenzte Flexibilität für staatliche Emittenten vorgesehen
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53339487-eu-kommission-schlaegt-freiwilligen-green-bond-standard-vor-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): EU: Höhere Steuersätze in elf EU-Staaten wegen globaler Mindeststeuer – DJN, 9.7.2021
Die Einführung einer globalen Mindeststeuer für große Unternehmen wird nach den Worten von EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni erhebliche Konsequenzen auch für die EU-Mitgliedstaaten haben. „Ein Mindeststeuersatz von 15 Prozent würde bedeuten, dass de facto elf EU-Länder ihre Steuersätze erhöhen müssten“, sagte Gentiloni den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir schaffen damit aber nicht die Differenzierung bei der Besteuerung ab, wir werden ja nicht überall nur 15 Prozent haben“, betonte der Kommissar. Es werde aber verhindert, dass die Unterschiede bei der Besteuerung zu groß würden.
Gentiloni zeigte sich zuversichtlich: „Wir sind ziemlich optimistisch, dass eine Einigung auf einen globalen Mindeststeuersatz jetzt möglich ist, wir haben eine gute Basis dafür.“ Zuvor hatten sich nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bereits rund 130 Länder darauf geeinigt, global agierende Unternehmen fairer zu besteuern. Dazu ist eine globale Mindestbesteuerung von mindestens 15 Prozent vorgeschlagen worden. In der EU gilt in Steuerfragen das Einstimmigkeitsprinzip. Daher müssten alle Mitgliedsstaaten dem Vorhaben einer Mindeststeuer zustimmen. Einige Länder, wie etwas Irland und Estland, haben allerdings Vorbehalte.
Trotz der erwarteten Mindeststeuer-Einigung wird die EU-Kommission nach Gentilonis Worten aber an ihren Plänen für eine europäische Digitalabgabe für Unternehmen der Digitalwirtschaft festhalten, obwohl es dagegen massive Einwände der US-Regierung gibt. „Das europäische Projekt einer Digitalabgabe für große Unternehmen wird davon aber nicht berührt. Wir werden den Vorschlag dazu in Kürze vorlegen“, sagte Gentiloni. „Wir kennen die Vorbehalte unserer amerikanischen Partner, wir diskutieren natürlich mit ihnen: Aber es ist klar, dass diese Digitalabgabe etwas anderes ist als frühere Pläne für eine Besteuerung von digitalen Dienstleistungen oder entsprechende nationale Digitalsteuern.“ Der Wirtschaftskommissar versicherte: „Unser Plan richtet sich nicht gegen amerikanische Konzerne.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53370934-eu-hoehere-steuersaetze-in-elf-eu-staaten-wegen-globaler-mindeststeuer-015.htm
Sabela Ojea: EU genehmigt Kauf von Willis Towers durch Aon unter Auflagen – DJN, 9.7.2021
Die Europäische Kommission hat die Übernahme der Willis Towers Watson plc durch den Konkurrenten Aon plc unter Auflagen genehmigt. Aon müsse dafür bestimmte Verpflichtungen wegen möglicher Wettbewerbsverstöße erfüllen. Die EU-Kartellbehörde teilte mit, dass die Verpflichtungen die Veräußerung zentraler Einheiten von Willis Towers Watson an das Maklerunternehmen Arthur J. Gallagher beinhalten, was die Präsenz des Maklers im Europäischen Wirtschaftsraum verbessern würde.
Sowohl Towers Watson als auch Aon seien führende Akteure auf den Märkten für Versicherungs- und Rückversicherungsmakler, sagte Margrethe Vestager, die Kartellchefin der EU. „Das von der Kommission akzeptierte Abhilfemaßnahmenpaket stellt sicher, dass europäische Unternehmen, einschließlich Versicherungsgesellschaften und große multinationale Kunden, weiterhin eine gute Auswahl und gute Dienstleistungen bei der Auswahl eines für ihre Bedürfnisse geeigneten Maklers haben werden“, so Vestager weiter.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53372035-eu-genehmigt-kauf-von-willis-towers-durch-aon-unter-auflagen-015.htm
ITALIEN
Italien: Industrieproduktion fällt überraschend – dpa-AFX, 9.7.2021
In Italien ist die Industrieproduktion im Mai überraschend gefallen. Im Monatsvergleich habe die Produktion um 1,5 Prozent nachgegeben, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Zudem revidierte Istat den Anstieg vom April von zunächst 1,8 Prozent auf 1,5 Prozent nach unten.
Im Jahresvergleich stieg die Industrieproduktion um 21,1 Prozent. Es war ein Anstieg von 24,8 Prozent erwartet worden. Die Fertigung war im Mai 2020 wegen der Corona-Beschränkungen in der ersten Welle der Pandemie noch stark belastet worden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53368926-italien-industrieproduktion-faellt-ueberraschend-016.htm
DEUTSCHLAND
BDI: Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen so hoch wie nie zuvor – WOCHENENDÜBERBLICK / DJN, 5.7.2021
Deutsche Unternehmen sind laut dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) stärker denn je Ziel krimineller Attacken. „Noch nie wurde die deutsche Wirtschaft so stark angegriffen wie heute. Die Anzahl der Angriffe ist in der Corona-Pandemie weiter gestiegen, weil Unternehmen im Homeoffice noch verwundbarer sind“, sagte Matthias Wachter, Leiter der Abteilung Sicherheit beim BDI, der Welt am Sonntag.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53323543-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-03-und-04-juli-2021-015.htm
Ransomware auf „Großwildjagd“: Hacker attackieren jetzt Software-Firmen mit tausenden Kunden –
Die Attacke auf die Software von Kaseya zeigt die Schwächen in der globalen Netzarchitektur. Auch in Deutschland sind mehrere IT-Dienstleister betroffen – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 6.7.2021
Diese Nachricht erinnert an einen Hollywood-Film, allerdings an einen, der erst noch gedreht werden muss: Ein Hacker-Konglomerat nutzt das lange Wochenende rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag, um unbemerkt eine Schadsoftware beim US-Softwareunternehmen Kaseya einzuschleusen. Kaseya gibt das Programm über die eigene Software unbemerkt an seine Kunden weiter. Deren Daten werden dadurch verschlüsselt. Weltweit sollen über 1000 Unternehmen betroffen sein, mehrere auch in Deutschland.
Die Hackergruppe, die auf den James-Bond-tauglichen Namen REvil hört, erklärte im vergangenen Oktober, sie wolle mit solchen Aktionen insgesamt zwei Milliarden Dollar erbeuten. Im aktuellen Fall soll das rettende Entschlüsselungsprogramm angeblich 70 Millionen Dollar kosten. Und je nachdem, wie viele Hacker-Thriller man schon gesehen hat, mag man erleichtert aufatmen und denken: Zum Glück wollen sie nicht unsere Zivilisation zerstören, sondern einfach nur Geld.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://app.handelsblatt.com/technik/it-internet/ransomware-auf-grosswildjagd-hacker-attackieren-jetzt-software-firmen-mit-tausenden-kunden/27393092.html
Erster Cyber-Katastrophenfall in Deutschland – Landkreis Anhalt-Bitterfeld lahmgelegt: Auszahlung von Sozialleistungen blockiert – Trotz großer Datenmengen zu Bürgern: Kommunen besonders schlecht gegen Angriffe geschützt – Die Welt, 10.7.20221
Nach einem Hackerangriff auf die Server des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist die Verwaltung blockiert, so können etwa keine Sozialleistungen mehr an die Bürger ausgezahlt werden. Um schnell reagieren zu können, gilt der Katastrophenfall.
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat wegen einer schweren Cyberattacke auf das Netzwerk seiner Verwaltung den ersten Cyber-Katastrophenfall in Deutschland ausgerufen. Die Verwaltung des Landkreises in Sachsen-Anhalt muss nach eigenen Angaben fast zwei Wochen lang ihre Arbeit weitgehend einstellen, weil Kriminelle das Computersystem am 6. Juli attackiert hatten. „Wir sind praktisch vollkommen lahmgelegt – und das wird auch in der kommenden Woche so sein“, sagte ein Sprecher am Samstag. Der Landkreis mit rund 157.000 Einwohnern kann deshalb etwa keine Sozial- und Unterhaltsleistungen mehr auszahlen. Die Sicherheitsbehörden ermitteln.
Der Angriff hatte sich am Dienstag ereignet. Aus bislang unbekannter Quelle seien mehrere Server infiziert worden, hieß es. In der Folge sei eine noch nicht genau spezifizierte Zahl von Dateien verschlüsselt worden. Alle kritischen Systeme wurden vom Netz getrennt, um einen eventuellen Datenabfluss zu verhindern.
Der Katastrophenfall wurde ausgerufen, um schneller reagieren zu können, wie der Landkreis-Sprecher erläuterte. Jetzt gehe es darum, die Quelle der Infektion zu finden, sowie um Analyse und Bekämpfung des Virus. Die IT-Infrastruktur müsse wieder aufgebaut werden. Schnellstmöglich sollten die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger wieder aufgenommen werden. Es seien viele finanzielle Belange von Bürgern betroffen. Dabei geht es etwa um Menschen, die auf Sozialgeld warten, oder auch um Jugendhilfe.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) teilte am Samstag mit, dass es eingeschaltet und vor Ort sei. „Es gab in Deutschland schon Angriffe auf Kommunen, aber keine, die daraufhin einen Katastrophenfall ausgerufen hat“, sagte eine Sprecherin.
*** Trotz großer Datenmengen zu Bürgern: Kommunen besonders schlecht gegen Angriffe geschützt ***
Zu den Angreifern wollte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Verweis auf die polizeilichen Ermittlungen keine Angaben machen. In Sicherheitskreisen wird vermutet, dass es sich erneut um Erpressung handelt. In solchen Fällen verschlüsseln Angreifer Daten, die sie erst nach Zahlung einer geforderten Summe wieder freigegeben.
In Sicherheitskreisen wird darauf verwiesen, dass die kommunale IT-Infrastruktur in Deutschland wahrscheinlich am schlechtesten gegen Cyberangriffe geschützt ist – obwohl hier sehr viele Daten der Bürger anfallen. Große Firmen und der Bund hingegen leisten sich umfangreiche IT-Abteilungen. Beim BSI gibt es ein Nationales Cyberabwehrzentrum, das Angriffe vor allem auf die Bundesverwaltung registrieren und abwehren soll. Unternehmen der sogenannten kritischen Infrastruktur wie etwa der Energieversorgung unterliegen zudem eine Meldepflicht für Cyberangriffe. Kommunen verfügen teilweise über veraltete Soft- und Hardware und nur kleine IT-Abteilungen.
In den vergangenen Monaten hatten sich die Angriffe krimineller Gruppen auf Netzwerke sowohl auf Firmen als auch öffentliche Einrichtungen gehäuft. So wurden etwa Medizinfirmen und das Klinikum Düsseldorf angegriffen, das danach Abteilungen vorübergehend schließen musste. Erst vergangene Woche hatte ein Cyberangriff einer Erpressergruppierung in den USA und anderen Staaten wie Deutschland hunderte Firmen betroffen. Teilweise werden auch staatliche Akteure hinter den kriminellen Gruppen vermutet. (dpa/Reuters/dp)
QUELLE: https://www.welt.de/politik/deutschland/article232427525/Anhalt-Bitterfeld-Hackerangriff-auf-Landkreis-loest-Katastrophenfall-aus.html
Der Cyber-Krimi und seine Kosten – Steingarts Morning Briefing, 6.7.2021
GRAPHIK: Median der für Unternehmen anfallenden Kosten durch Cyberattacken in ausgewählten Ländern, in US-Dollar
Die Bedrohung für eine Weltwirtschaft am Fuße des Digitalzeitalters ist nicht existenziell, aber beunruhigend. Die Beratungsfirma Accenture rechnet allein in der Hightech-Branche im Zeitraum von 2019 bis 2023 mit einem Umsatzverlust von 735 Milliarden US-Dollar weltweit, verursacht durch Cyberkriminalität. Matthias Wachter, Sicherheitsexperte beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), sagt:
„Noch nie wurde die deutsche Wirtschaft so stark angegriffen wie heute.“
FAZIT: Der Rechtsstaat muss sich modernisieren und revitalisieren, wenn er den Gefährdern auf Augenhöhe begegnen will. Eine aggressive und sich ungebremst ausbreitende Cyberkriminalität wäre für die Wirtschaft das, was die Pandemie für die Menschen ist: teuer für alle, tödlich für viele.
QUELLE: nicht verlinkbar.
Holzpreise klettern kräftig Wohnungsbau ist noch teurer geworden – n-tv, 9.7.2021
Die globale Nachfrage an Baustoffen nimmt in der Corona-Krise zu. Die Preise für Holz, Stahl und Dämmstoffe ziehen im Vorjahresvergleich kräftig an. Entsprechend wird Wohnungsbau auch in Deutschland teurer.
Der Neubau von Wohnungen in Deutschland hat sich im Mai so stark verteuert wie seit 2007 nicht mehr. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lagen im Mai des laufenden Jahres um 6,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Dies sei der höchste Anstieg der Baupreise binnen Jahresfrist seit Mai 2007 (plus 7,1 Prozent gegenüber Mai 2006), teilte die Wiesbadener Behörde mit.
Im Mai 2007 hatte die damalige Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 Prozent auf 19 Prozent zu dem kräftigen Preisanstieg beigetragen. Aktuell treibt unter anderem die große Nachfrage nach Baumaterialien wie Holz, Stahl und Dämmstoffen auf den Weltmärkten die Preise. Zimmer- und Holzbauarbeiten in Deutschland zum Beispiel verteuerten sich überdurchschnittlich, hier lagen die Preise im Mai 2021 um 28,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Preise für Ausbauarbeiten nahmen im Mai gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent zu.
Die Umsätze im Bauhauptgewerbe in Deutschland liegen auf Jahressicht bislang dennoch unter Vorjahresniveau: Von Januar bis einschließlich April 2021 blieben die Erlöse nach Angaben des Bundesamtes um 5,6 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, obwohl es im April im Jahresvergleich ein Umsatzplus von 3,6 Prozent gab. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau).
Der Aufwärtstrend soll im Juni aber erstmals unterbrochen worden sein, berichteten die Experten des Hamburger Forschungsinstituts HWWI. Unter dem Strich waren Industrierohstoffe im Juni an den Weltmärkten 1,8 Prozent günstiger zu haben als im Mai. Eine leichte Entspannung registrieren die HWWI-Volkswirte auch bei Holz. Das erklären sie unter anderem mit erhöhten Kapazitäten amerikanischer Sägewerke sowie mit wegen der hohen Baustoffpreise zurückgestellten Bauprojekten. (ntv.de, mba/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wohnungsbau-ist-noch-teurer-geworden-article22672005.html
SIEHE DAZU
=> Kurzvideo – Waldbesitzer haben Nachsehen: So kommt es zum paradoxen Preisunterschied beim Holz – Borkenkäfer und Hitze bedingen Preisverfall beim Rundholz – Flaschenhals Sägewerke: Schnittholz mit stark wachsender Teuerung – n-tv, 21.6.2021
Waldbesitzer dürften sich derzeit die Haare raufen. Borkenkäfer und andere Schädlinge führen zu einem Überangebot an Rundholz. Die Preise sind im Keller. Gleichzeitig steigen die Preise für Schnittholz in nie dagewesene Höhen. ntv liefert Hintergründe zum Holzmarkt-Paradox.
QUELLE (inkl. 1:40-min-Video): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/So-kommt-es-zum-paradoxen-Preisunterschied-beim-Holz-article22629727.html
Kurzvideo: Auch an Zapfsäule wird’s teurer Opec-Streit treibt Heizöl-Preise in die Höhe – n-tv, 7.7.2021
Der Ölpreis klettert in die Höhe. Damit wird auch das Heizen und Tanken derzeit immer teurer. Hauptverantwortlich ist eine Meinungsverschiedenheit in der OPEC.
QUELLE (inkl. 1:35-min-Video): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Opec-Streit-treibt-Heizoel-Preise-in-die-Hoehe-article22666593.html
Kurzvideo – Staus in den Containerhäfen: Drohen Deutschland leere Regale und höhere Preise? – n-tv, 9.7.2021
Ob Holz, Stahl oder Computerchips – seit Monaten klagen Unternehmen über Lieferengpässe. Sie können nicht produzieren, obwohl die Auftragsbücher voll sind. Doch auch im Einzelhandel, in Drogerien oder Modeketten wachsen die Sorgen vor leeren Regalen. Sind die Befürchtungen berechtigt oder unbegründet?
Textilien und Fahrräder betroffen. Andere Waren weniger betroffen, da Händler vorgesorgt haben. Leere Regale drohen eher nicht.
QUELLE (inkl. 1:37-min-Video): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Drohen-Deutschland-leere-Regale-und-hoehere-Preise-article22672717.html
Container-Chaos: Gelähmte Schifffahrt vorübergehend inflationstreibend auf erwartete 4 Prozent Jahresteuerung – Chefs von Kik und Rossmann schlagen Alarm: Händler bereiten Kunden auf höhere Preise und Lücken in Regalen vor – Die Frachtraten haben sich vervielfacht, Container sind kaum zu bekommen, die Läger laufen leer. Für viele Händler ist die Lage „dramatisch“ – Rürup: nächstes Jahr Rückkehr zu 2 Prozent Inflation – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 7./8.7.2021
Für Menschen, die in den altmodischen Kategorien von Ursache und Wirkung denken oder einfach nur gerne Billard spielen, hat es fast etwas Beruhigendes: Eine globale Pandemie geht eben doch nicht spurlos an der Weltwirtschaft vorüber. Auch dann nicht, wenn Staaten und Notenbanken die Folgen mit billionenschweren Programmen zu überdecken suchen. „Ich schließe nicht aus, dass bei der Inflationsrate in Deutschland für einige Monate eine Vier vor dem Komma stehen wird“, sagt Bert Rürup, Chef des Handelsblatt Research Institute (HRI). Denn: Ein „verknapptes Güterangebot“ werde einer „kurzfristig stark anziehenden Konsumentennachfrage“ gegenüberstehen.
Das „verknappte Güterangebot“ ist dabei eine freundliche Umschreibung für das Chaos, das derzeit in der weltweiten Logistik herrscht. Die frischgeimpfte und vom Lockdown befreite Bevölkerung in den Industriestaaten will endlich wieder shoppen. Doch wichtige Häfen arbeiten noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Frachtschiffe warten tagelang auf die Abfertigung, Container sind knapp, die Frachtraten explodieren. Einzelhändler wie Kik oder Rossmann stimmen ihre Kundschaft nun auf steigende Preise ein. Verwundern kann dabei vor allem, dass es so lange gedauert hat, bis der Inflationseffekt eintritt. Und beruhigend mag wirken, dass HRI-Experte Rürup die Vier vor dem Komma für einen vorübergehenden Peak hält:
Spätestens ab dem nächsten Jahr wird sich dieser Preisauftrieb wieder spürbar in die Nähe der Zwei-Prozent-Marke zurückbilden.
Merke: Selbst nach einem richtig verkorksten Billard-Stoß kommen die Bälle irgendwann wieder zur Ruhe. Und nur wenn es ganz blöd läuft, liegt der Schwarze am Ende im falschen Loch. Jetzt Artikel lesen…
QUELLE: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/container-chaos-chefs-von-kik-und-rossmann-schlagen-alarm-haendler-bereiten-kunden-auf-hoehere-preise-und-luecken-in-regalen-vor/27393900.html
Ifo: Materialmangel in der Baubranche verschärft sich – DJN, 8.7.2021
MÜNCHEN (Dow Jones)–Die deutschen Bauunternehmen leiden einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge immer stärker unter Materialmangel und steigenden Einkaufspreisen. „Die Probleme sind vielfältig und haben sich gegenüber dem Vormonat nochmals verschärft“, sagte Felix Leiss, Umfrageexperte beim Ifo-Institut. 95,2 Prozent der Befragten berichteten im Juni von steigenden Einkaufspreisen in den vorangegangen drei Monaten.
Im Hochbau meldeten zudem 50,4 Prozent der Betriebe Beeinträchtigungen durch Lieferverzögerungen. Im Mai waren es 43,9 Prozent und im April 23,9 Prozent. Im Tiefbau berichteten im Juni 40,5 Prozent der Befragten von Problemen bei der Beschaffung. Das entspricht einem spürbaren Anstieg gegenüber dem Vormonat, als es 33,5 Prozent waren. Noch im März war im Tiefbau mit 2,9 Prozent kaum von Lieferproblemen die Rede.
„Die Versorgung mit Schnittholz ist immer noch ein großes Thema auf den deutschen Baustellen. Aber auch erdölbasierte Baustoffe sind knapp. So fehlt es vielerorts an synthetischen Dämmmaterialien, Kanalgrundrohren und andere Kunststoffteilen. Dazu kommen die Lieferprobleme und Preissteigerungen beim Stahl“, sagte Leiss.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53355979-ifo-materialmangel-in-der-baubranche-verschaerft-sich-015.htm
Hans Bentzien: Sentix: Deutsche Wirtschaft in der Hochkonjunktur – DJN, 5.7.2021
Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung von Investoren in der Hochkonjunktur. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex steigt im Juli auf 33,8 (Juni: 32,9) Punkte, den höchsten Stand seit Februar 2018. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 37,8 (29,5) Punkte, während der Index der Erwartungen auf 30,0 (36,3) Punkte nachgab.
„Die wirtschaftlichen Öffnungsschritte im Dienstleistungs- und Handelsbereich befeuern auch in Deutschland die konjunkturelle Lagebeurteilung“, schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Veröffentlichung. Mit dem 14. Anstieg in Folge klettere die Lage auf den besten Wert seit November 2018.
Der Konjunkturindex des Euroraum stieg auf 29,8 (28,1) Punkte, wobei der Lageindex auf 29,8 (21,3) Punkte anzog, der Erwartungsindex aber auf 29,8 (35,3) Punkte zurückging.
Laut Hübner nähert sich die Wirtschaft einem „Punkt des maximalen Momentums“. „Die Erwartungen der Anleger, dass sich diese gute Lage weiter verbessern kann, bleiben zwar noch klar positiv, sinken aber“, schreibt er. Das sei vor allem für die Aktienmärkte von Bedeutung.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53326058-sentix-deutsche-wirtschaft-in-der-hochkonjunktur-015.htm
Hans Bentzien u.a.: Trotz Rückgang Normalisierung der Wirtschaftslage: ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland überraschend schwächer als erwartet – Optimistische Expert*innen: Gute Aussichten auf Sicht von sechs Monaten – DJN/dpa-AFX, 6.7.2021
Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt. Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Juli deutlicher als erwartet abgeschwächt. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen sank auf 63,3 (Juni: 79,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf lediglich 75,0 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung verbesserte sich dagegen deutlicher als erwartet – auf 21,9 (minus 9,1) Punkte. Erwartet worden war ein Stand von 8,0 Punkten.
Im Mai hatte der Indikator mit 84,4 Punkten noch den höchsten Stand seit über 21 Jahren erreicht.
Allerdings hat sich die Bewertung der aktuellen Lage deutlich verbessert. Der entsprechende Indikator stieg um 31,0 Punkte auf 21,9 Punkte. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg auf 5,5 Punkte. Der Lagebeurteilung ist damit erstmals seit zwei Jahren positiv. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland werde nun ähnlich eingeschätzt wie Anfang 2019, erklärte das ZEW.
„Die Normalisierung der Wirtschaftsentwicklung geht weiter“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die Lagebeurteilung habe den Rückgang in der Corona-Krise klar hinter sich gelassen und die Erwartungen befänden sich trotz des Rückgangs auf einem hohen Niveau: „Obwohl die ZEW-Konjunkturerwartungen abermals deutlich zurückgehen, befinden sie sich noch auf einem sehr hohen Niveau. Die Finanzmarktexpertinnen und -experten rechnen daher in sechs Monaten mit einer überdurchschnittlich positiven gesamtwirtschaftlichen Lage“, kommentierte ZEW-Chef Achim Wambach das Ergebnis. Im Mai hatten die ZEW-Konjunkturerwartungen mit 84,4 Punkten den höchsten Stand seit über 20 Jahren erreicht. Im Juni es bereits zu einem unerwarteten Rückgang gekommen.
Auch die Konjunkturerwartungen für die Eurozone verschlechterten sich im Juli. Der entsprechende Indikator sank auf 61,2 (81,3) Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage verbesserte sich dagegen auf 6,0 (minus 24,4) Punkte.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53336014-zew-konjunkturerwartungen-fuer-deutschland-schwaecher-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53335959-deutschland-zew-konjunkturerwartungen-trueben-sich-ueberraschend-deutlich-ein-016.htm
Hans Bentzien: Auftragseingang der deutschen Industrie im Mai viel schwächer als erwartet – DJN, 6.7.2021
Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Mai viel schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,7 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 54,3 (April: 80,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 1,0 Prozent prognostiziert.
Ohne Großaufträge ergab sich ebenfalls ein Rückgang von 3,7 Prozent. Den für April gemeldeten Rückgang bei den gesamten Auftragseingängen von 0,2 Prozent revidierten die Statistiker auf ein Plus von 1,2 Prozent.
Die Inlandsbestellungen erhöhten sich im Mai auf Monatssicht um 0,9 (minus 1,8) Prozent, während sich die Auslandsaufträge um 6,7 (plus 3,2) Prozent verringerten, darunter die aus dem Euroraum um 2,3 (plus 2,0) Prozent. Die Bestellungen von Vorleistungsgütern nahmen um 3,6 (minus 0,3) Prozent ab und die von Investitionsgütern um 4,6 (plus 2,6) Prozent. Die Auftragseingänge für Konsumgüter stiegen dagegen um 3,9 (minus 2,4) Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53333451-deutscher-auftragseingang-im-mai-viel-schwaecher-als-erwartet-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): Ifo: Produktionserwartungen nur leicht gestiegen – DJN, 7.7.2021
Die Produktionserwartungen im verarbeitenden Gewerbe haben sich aufgrund von Lieferengpässen im Juni nur leicht erhöht. Der Indikator stieg auf 27 Punkte nach 26 im Mai, so das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts. „Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten stehen derzeit einem kräftigeren Anstieg der Industrieproduktion entgegen“, erläutert Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Allerdings sei die Entwicklung in den einzelnen Branchen ganz unterschiedlich.
Am deutlichsten hätten sich die Produktionsaussichten bei den Herstellern von Leder, Lederwaren und Schuhen verbessert. Den größten Rückgang gab es demnach in der Pharmaindustrie. Auch in der Nahrungsindustrie haben sich die Erwartungen deutlich verbessert. In der Bekleidungsindustrie, bei den Gummi- und Kunststoffwarenherstellern und der Autobranche sind die Erwartungen leicht besser als im Vormonat. Nahezu unverändert auf hohem Niveau bleiben die Produktionsaussichten im Maschinenbau. Auch die Elektrobranche, die Chemieindustrie und die Metallerzeuger haben unverändert gute Erwartungen.
Die Erwartungen der Getränkehersteller und der Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten haben sich leicht eingetrübt, ihre Produktionsaussichten bleiben aber auf einem hohen Niveau. Die Textilhersteller nehmen ihre Erwartungen deutlich zurück und rechnen mit einer geringen Ausweitung ihrer Produktion.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53345016-ifo-produktionserwartungen-nur-leicht-gestiegen-015.htm
Hans Bentzien: Deutsche Produktion sinkt im Mai um 0,3 Prozent – DJN, 7.7.20212
Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Mai schwächer als ursprünglich prognostiziert entwickelt und ist – wie nach schwachen Industrieumsatzzahlen zu erwarten war – leicht gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurück und lag um 17,3 (April: 27,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert.
Allerdings war wegen des am Dienstag gemeldeten Rückgangs des Industrieumsatzes um 0,5 Prozent bereits ein Produktionsrückgang angenommen worden. Das ursprünglich für April gemeldete Produktionsminus von 1,0 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,3 Prozent.
Die Industrieproduktion im engeren Sinne verringerte sich im Mai auf Monatssicht um 0,5 (minus 0,4) Prozent. Die Erzeugung von Vorleistungsgütern nahm um 0,6 (plus 0,4) Prozent zu und die von Konsumgütern um 4,1 (minus 2,8) Prozent. Die Produktion von Investitionsgütern sank dagegen um 3,4 (minus 0,1) Prozent. Die Bauproduktion erhöhte sich um 1,3 (minus 1,8) Prozent, während die Energieproduktion um 2,1 (plus 5,5) Prozent nachließ.
Nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) sank die Produktion vor allem wegen Versorgungsengpässen bei Halbleitern im Automobilbereich. „Der Ausblick für die Industriekonjunktur insgesamt bleibt aber positiv angesichts einer nach wie vor hohen Nachfrage sowie deutlicher Verbesserungen beim Geschäftsklima und den Exporterwartungen“, urteilte das Ministerium.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53345010-deutsche-produktion-sinkt-im-mai-um-0-3-prozent-015.htm
Hans Bentzien: Deutscher Industrieumsatz sinkt im Mai um 0,5 Prozent – DJN, 6.7.2021
Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Der für April zunächst gemeldete Rückgang von 2,6 Prozent wurde auf 2,5 Prozent revidiert. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz um 5,4 Prozent niedriger.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53333452-deutscher-industrieumsatz-sinkt-im-mai-um-0-5-prozent-015.htm
Andreas Plecko: Deutsche Exporte steigen im Mai leicht – DJN, 8.7.2021
Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Mai wie erwartet leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,3 Prozent mehr als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus in dieser Höhe vorausgesagt. Die Exporte sind damit den 13. Monat in Folge gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 36,4 Prozent höher.
Die Importe stiegen im Mai um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 32,6 Prozent. Die hohen Zuwächse im Jahresvergleich bei den Ex- und Importen erklären sich vor allem durch das niedrige Außenhandelsniveau des Vergleichsmonats; Ökonomen sprechen von einem Basiseffekt.
Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, lagen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent niedriger und die Importe um 9,4 Prozent höher.
Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 12,6 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 16,0 Milliarden Euro gerechnet. Der Überschuss in der Leistungsbilanz betrug nach vorläufigen Berechnungen der Bundesbank 13,1 Milliarden Euro. Ökonomen hatten 14,5 Milliarden Euro erwartet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53356270-deutsche-exporte-steigen-im-mai-leicht-015.htm
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juni um 0,7 Prozent – DJN, 9.7.2021
Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 7,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.
Im Vergleich zum Durchschnitt der zwölf Monate vor der Corona-Krise in Deutschland (März 2019 bis Februar 2020) war die Fahrleistung saison- und kalenderbereinigt 3,8 Prozent höher. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53367427-lkw-maut-fahrleistungsindex-steigt-im-juni-um-0-7-prozent-015.htm
Hans Bentzien: Commerzbank: Konsum wird wichtigste deutsche Wachstumsstütze – DJN, 6.7.2021
Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen erwartet, dass der private Konsum in den nächsten Monaten die wichtigste Stütze des Wirtschaftswachstums in Deutschland sein wird. „Zum einen werden andere Nachfragekomponenten wie die Exporte und die Ausrüstungsinvestitionen noch einige Zeit durch die weltweiten Materialengpässe in der Industrie gebremst, zum anderen hat der private Verbrauch im Vergleich zu der Situation vor Ausbruch der Pandemie am meisten aufzuholen“, schreibt Solveen in einem Kommentar. Eine Auflösung unfreiwilliger Ersparnisse braucht es dazu seiner Meinung nach nicht.
Während sich Investitionen und Exporte im Winterhalbjahr robust zeigten, brach der private Konsum aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkungen erneut ein und war im ersten Quartal preisbereinigt um 11 Prozent niedriger als Ende 2019, also vor der Pandemie. Zugleich lagen die real verfügbaren Einkommen im ersten Quartal aber nur um 2 Prozent unter dem Niveau von Ende 2019, und die nominalen Einkommen waren sogar etwas höher, wie Solveen vorrechnet. „Der Rückgang bei den Nettolöhnen sowie den Einkommen aus Betriebsüberschüssen, selbständigen Tätigkeiten und Vermögen wurde durch zusätzliche Transfers des Staates wie das Kurzarbeitergeld zwischenzeitlich mehr als ausgeglichen“, schreibt er.
In der Folge stieg die Sparquote der privaten Haushalte teilweise auf über 20 Prozent und war damit fast doppelt so hoch wie der langfristige Durchschnitt. „Zwischen Anfang 2020 und dem Ende des ersten Quartals dieses Jahres haben die privaten Haushalte damit – in den meisten Fällen unfreiwillig – mehr als 160 Milliarden Euro mehr auf die hohe Kante gelegt, als sie es bei einer Sparquote auf dem Niveau von deren langfristigen Durchschnitt getan hätten“, kalkuliert Solveen. Das entspreche fast 8 Prozent des jährlichen verfügbaren Einkommens, und im zweiten Quartal dürften diese „Corona-Ersparnisse“ noch einmal deutlich zugenommen haben.
Solveen glaubt nicht, dass die Haushalte diese Ersparnisse demnächst ausgeben werden. „Natürlich wird mancher Haushalt, dessen Kasse am Ende des Monats normalerweise leer ist und in der nun noch Geld vorhanden ist, sich einen lange gehegten Wunsch erfüllen. Der größte Teil dieser Ersparnisse dürfte aber von Haushalten gebildet worden sein, die solche Budgetbeschränkungen in normalen Zeiten zumindest nicht spüren“, gibt er zu bedenken.
Trotzdem wird der private Verbrauch seiner Einschätzung nach in den kommenden Quartalen voraussichtlich in einem Ausmaß zunehmen, wie er es in den vergangenen 50 Jahren nicht getan habe. „So lange die Delta-Variante des Virus nicht weitere Lockerungen verhindert oder die Politik sogar zu neuerlichen Einschränkungen veranlasst, spricht nichts dagegen, dass die privaten Haushalte ihr Ausgabeverhalten normalisieren, also die Sparquote wieder auf ihr normales Niveau von knapp 11 Prozent absenken“, prognostiziert Solveen. Schon das alleine würde den privaten Verbrauch bei unverändertem Einkommen um mehr als 11 Prozent steigen lassen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53335279-commerzbank-konsum-wird-wichtigste-deutsche-wachstumsstuetze-015.htm
Hohes Wachstumstempo mit Dämpfer: ISM-Index für Dienstleistungen wächst langsamer – Schwächere Nachfrage und Personalmangel dämpfen – Boom bei Gastgewerbe, Freizeit und Reisen kann Nachfrageexplosion nicht völlig befrieden – Hemmschuhe bilden „schwere Lieferkettenunterbrechungen und Preissteigerungen“ – DJN, 6.7.2021
Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist im Juni weiterhin mit hohem Tempo gewachsen. Die Wachstumsrate verringerte sich aber im Vergleich zum Vormonat, da die Nachfrage schwächelte und die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, Kandidaten für offene Stellen zu finden.
Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe sank im Juni auf 60,1 von dem im Mai registrierten Rekordwert von 64,0, so die Daten aus einer vom Institute for Supply Management zusammengestellten Umfrage. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 63,3 erwartet.
„Die Expansionsrate im Dienstleistungssektor bleibt stark, trotz des leichten Rückgangs der Wachstumsrate gegenüber dem Allzeithoch des Vormonats“, sagte Anthony Nieves, Vorsitzender des ISM Services Business Survey Committee.
Die Wiederaufnahme der zuvor eingeschränkten Aktivitäten in den Bereichen Gastgewerbe, Freizeit und Reisen führte zu einem Boom bei den Verbraucherausgaben im Dienstleistungssektor. Viele Firmen berichteten, dass sie mit der starken Nachfrage nicht mithalten können.
„Herausforderungen mit Materialknappheit, Inflation, Logistik und Beschäftigungsressourcen sind weiterhin ein Hindernis für die Geschäftsbedingungen“, sagte Nieves.
Der ISM-Index für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor sank auf 60,4 von 66,2 im Vormonat, während der Index für die Auftragseingänge auf 62,1 von 63,9 im Mai zurückging. Der Beschäftigungsindex fiel auf 49,3 von 55,3 und lag damit nach fünf aufeinanderfolgenden Wachstumsmonaten den Bereich der Kontraktion.
Der Index für Lieferantenlieferungen fiel auf 68,5 von 70,4 im Vormonat, aber die Befragten berichteten in ihren Kommentaren weiterhin von Ausfällen in der Lieferkette und logistischen Verzögerungen.
Der Preisindex ging etwas zurück auf 79,5 von 80,6 im Vormonat, blieb aber auf hohem Niveau.
„Schwere Lieferkettenunterbrechungen und Preissteigerungen halten auf dem Markt an, und zwar in allen Sektoren“, sagte ein Befragter aus dem Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53339869-ism-index-fuer-dienstleistungen-waechst-langsamer-015.htm
Markit: Deutsche Dienstleister kommen im Juni besser in Schwung – Stark anziehende Kosten bedingen explosionsartige Preissteigerung – DJN, 5.7.2021
Mit weiteren Lockerungen hat der deutsche Servicesektor im Juni an Dynamik gewonnen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 57,5 von 52,8 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 58,1 vorhergesagt. Vorläufig war für Juni ein Wert von 58,1 ermittelt worden.
Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Juni beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – stieg auf 60,1 von 56,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, liegt es darunter, eine Schrumpfung.
„Einhergehend mit der stark anziehenden Nachfrage schnellten allerdings auch die Kosten weiter in die Höhe, was zusammengenommen dafür sorgte, dass die Dienstleister ihre Preise so explosionsartig erhöhten, wie es in über zwanzig Jahren Datenerhebung nicht der Fall war“, sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53325804-markit-deutsche-dienstleister-kommen-im-juni-besser-in-schwung-015.htm
SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de
Starke Nachfrage nach E-Mobilen: Deutscher Automarkt mit kräftigem Zuwachs im Juni – Neuzulassngen noch unter Niveau der Vor-Pandemie-Zeit – Weiter ungeliebt: Kraftfahrzeuge mit fossilen Brensstoffen lassen Federn – DJN, 5.7.2021
Der deutsche Automarkt hat im Juni auch dank der starken Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ein deutliches Wachstum verzeichnet. Die Zulassungen kletterten um 25 Prozent auf 274.152 Personenkraftwagen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Im ersten Halbjahr liegt der Zuwachs damit bei 15 Prozent. Dennoch erreichte der Markt nur das zweitniedrigste Niveau seit 1991, so der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK).
„Nach dem dramatischen Einbruch im vergangenen Jahr erholt sich der Pkw-Markt im laufenden Jahr nur langsam“, erklärt VDIK-Präsident Reinhard Zirpel laut Mitteilung. Die Neuzulassungen blieben 2021 noch deutlich unter dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie. „Besser sieht es dagegen im Nutzfahrzeug-Markt aus, der sein Vorkrisenlevel wieder erreicht.“
Bei den deutschen Marken verzeichnete Smart im Juni mit 211,6 Prozent den größten Zuwachs, gefolgt von Opel (69,3 Prozent) und VW (+46,1 Prozent). Zweistellige Zulassungssteigerungen zeigten sich ebenfalls bei Audi (29,0 Prozent), Mini (27,2 Prozent) und BMW (20,9 Prozent).
Der positive Trend der Pkw-Neuzulassungen mit alternativen Antrieben führte auch im Juni zu deutlichen Zulassungssteigerungen, so das KBA. 33.420 neu zugelassene Elektro-Pkw (BEV) ergeben den Angaben zufolge ein Plus von 311,6 Prozent und einen Anteil von 12,2 Prozent. Neuzulassungen mit fossilen Brennstoffen gingen gegenüber dem Vorjahresmonat hingegen weiter zurück: Der Anteil der Benziner lag nach einem Rückgang von 4,6 Prozent bei 39,5 Prozent, bei den Diesel-Pkw lag der Anteil nach einem Rückgang von 18,8 Prozent bei 19,9 Prozent, wie das KBA weiter mitteilte.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53327151-deutscher-automarkt-mit-kraeftigem-zuwachs-im-juni-015.htm
VDA reduziert Auto-Absatzprognose für Deutschland 2021 – DJN, 7.7.2021
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet wegen der Engpässe bei Leistungshalbleitern dieses Jahr in Deutschland mit einem geringeren Absatzplus von Neuwagen als bisher. Das Wachstum werde bei 3 Prozent auf 3 Millionen Fahrzeuge gesehen, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller während einer Pressekonferenz. Bisher hatte der Verband das Absatzplus bei 8 Prozent auf 3,15 Millionen Fahrzeuge erwartet. Für den Weltmarkt rechnet der Verband dieses Jahr nach wie vor mit einem Absatzplus von 9 Prozent. Besonders in Europa laufe es schwächer als erwartet.
Wegen der Lieferprobleme bei Halbleitern könnten kurzfristig Kapazitäten verschoben werden. Langfristig würde nur der Aufbau von Kapazitäten helfen, so Müller.
Bei der Debatte über die Antriebsart warnte der VDA vor einem Verbot des Verbrenners. Innovationspotenziale würden dadurch abgeschnitten, die Wahlfreiheit der Verbraucher beschränkt werden. Zudem forderte der Verband von der EU-Kommission einen „verbindlichen Plan“ für einen raschen Ausbau der Lade- und Tankinfrastrukturen für alle klimafreundlichen Energieträger. Im Moment seien rund 68 Prozent der Ladepunkte in der EU nur in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53347769-vda-reduziert-auto-absatzprognose-fuer-deutschland-2021-015.htm
Videobeitrag: Tourismus – „Als nackte Kulisse missbraucht“ Insta-Touristen am Königssee drohen 25.000 Euro Strafe n-tv,
Soziale Medien machen immer wieder Jagd nach dem perfekten Foto zum Alltag. Der Königssee in Bayern wird in den vergangenen Jahren häufig von Influencern belagert, damit ist nun Schluss. Mit hohen Strafen und einem Betretungsverbot gehen die Behörden gegen die ungewollten Touristen vor.
QUELLE: (inkl. 2:18-min-Vidoe): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Insta-Touristen-am-Koenigssee-drohen-25-000-Euro-Strafe-article22662360.html
IMK: Reform der Schuldenbremse würde Regierung viel Geld bringen – WOCHENENDÜBERBLICK / DJN, 5.7.2021
Würde die Schuldenbremse wie geplant von 2023 an wieder gelten, müsste die nächste Regierung drastisch sparen. Das hat das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung berechnet, wie Der Spiegel berichtet. Besser komme in der IMK-Studie der Vorschlag von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) weg, die Schuldenbremse wegen der Pandemiefolgen für mehrere Jahre auszusetzen. Das würde den finanziellen Spielraum für die nächste Regierung um fast 200 Milliarden Euro erhöhen.
QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Insta-Touristen-am-Koenigssee-drohen-25-000-Euro-Strafe-article22662360.html
Andrea Thomas (WSJ): Scholz erwartet Mehreinnahmen in Milliardenhöhe durch globale Mindeststeuer – DJN, 9.7.2021
Bundesfinanzminister Olaf Scholz Scholz (SPD) erwartet mit der Einführung einer globalen Mindeststeuer Mehreinnahmen in Milliardenhöhe für Deutschland. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Scholz, dass er von dem Treffen der 20 führenden Wirtschaftsnationen, das am heutigen Freitag in Venedig beginnt, eine Unterstützung für die Einführung dieser globalen Mindestbesteuerung von mindestens 15 Prozent erwartet. Auch zeigte er sich zuversichtlich, dass man sich auch innerhalb der Europäischen Union trotz Widerstand einiger Länder, wie etwa Irland und Estland, auf diese Mindeststeuer einigen wird.
„Ich rechne auch mit Mehreinnahmen“, erklärte Scholz im Deutschlandfunk vor dem Treffen. Bevor die letzten Details der Vereinbarungen festgelegt sind, womit im Herbst zu rechnen ist, könne er zwar noch keine konkrete Summe nennen. „Es wird für Deutschland auch um Milliarden zusätzliche Einnahmen gehen vor allem durch die globale Mindestbesteuerung“, erklärte Scholz. Zuvor hatten sich nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bereits 130 Länder darauf geeinigt, global agierende Unternehmen fairer zu besteuern.
Scholz sagte, eine Mindeststeuer von 15 Prozent für global agierende Unternehmen führe zu mehr Gerechtigkeit und beende den Steuersenkungswettbewerb der Länder. Auch in den USA und in Großbritannien erhöhe man gerade die Unternehmenssteuer in Richtung der 30 Prozent, die für deutsche Unternehmen im Durchschnitt anfallen.
Mit der globalen Mindeststeuer werde es möglich, dass Länder eine „faire und gerechte und kluge“ Besteuerung von Unternehmen vornehmen und ein globales Steuerdumping verhindern. „Wir haben eine große Erleichterung und das ist ein Gewinn für die Demokratie“, so Scholz.
Im ARD-Morgenmagazin sagte Scholz, er erwarte auch innerhalb der EU trotz des Einstimmigkeitsprinzips in Steuerfragen eine Zustimmung zu einer globalen Mindeststeuer. In der Vergangenheit seien alle Vereinbarung zur Steuervereinbarung zuerst auf globaler Ebene erzielt worden. „Dann hat die EU sie auch nachvollzogen, auch die Länder, die skeptisch waren“, so Scholz.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53368052-scholz-erwartet-mehreinnahmen-in-milliardenhoehe-durch-globale-mindeststeuer-015.htm
Umfrage: Viele junge Leute verzichten ganz auf ein Festnetztelefon – dpa-AFX, 6.7.2021
Das Festnetztelefon spielt bei vielen Menschen keine Rolle mehr. Wie eine Umfrage von Innofact im Auftrag des Vergleichsportals Verivox ergab, telefoniert jeder vierte Bundesbürger zu Hause gar nicht mehr über das Festnetz. Etwa die Hälfte dieser Verbraucher hat gar keinen entsprechenden Anschluss. Die andere Hälfte hat zwar einen, nutzt ihn aber nicht. Bei der Online-Befragung nahmen gut 1000 Menschen teil, nach Angaben von Verivox ist sie repräsentativ.
Die Befragten wurden in drei Altersgruppe eingeteilt. Die Erkenntnis: Je jünger, desto unwichtiger ist das altbewährte Telefon mit seiner Leitung bis in die Wohnung. In der Altersgruppe 18 bis 29 liegt der Anteil der Menschen, die daheim nie ihren Festnetzanschluss nutzen oder gar keinen haben, bei 40 Prozent. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es noch 31 Prozent und bei den 50 bis 69-Jährigen nur 13 Prozent. Senioren ab 70 waren nicht Teil der Umfrage.
Ein Grund für die gesunkene Bedeutung des Festnetzanschlusses dürfte die in den vergangenen Jahren geänderte Preispolitik der Telekommunikationsanbieter sein: Die meisten Mobilfunktarife beinhalten eine Flatrate und haben keine Minutenpreise für Inlandsverbindungen mehr – ob man daheim zum Flatrate-Festnetztelefon greift oder zum Handy, ist aus finanzieller Sicht also egal. Hinzu kommt, dass viele Verbraucher Gespräche ohnehin über Internetdienste wie WhatsApp, Skype oder Zoom führen.
Unter den Bürgern, die das Festnetz zum Telefonieren nutzen, kann der Umfrage zufolge ein Viertel seine Nummer nicht auswendig. Je jünger der Befragte, desto häufiger musste er bei der Frage nach seiner Festnetznummer passen. „Dass 85 Prozent der älteren Festnetznutzer ihre Nummer auswendig wissen, hat nicht nur mit einer häufigeren Nutzung zu tun“, erklärt Verivox-Experte Jens-Uwe Theumer. „Seit 2011 werden bei Neuanschlüssen im Festnetz wegen damals drohender Rufnummernknappheit nur längere Nummern vergeben.“ Diese seien schlechter zu merken als die früher verbreiteten, recht kurzen Nummern, die vor allem ältere Bestandsnutzer haben.
Das klassische Telefon wird künftig wohl unwichtiger werden. „Mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020 war die Nutzung der Festnetztelefonie in den vergangenen Jahren stets rückläufig“, sagt Theumer. „Dieser Corona-Effekt dürfte über kurz oder lang verpuffen: Längst ist das Smartphone zur Schaltzentrale des digitalen Alltags geworden, insbesondere für jüngere Menschen.“ Sollten viele Menschen auch langfristig im Homeoffice bleiben, könnte dies den Rückgang bei der Festnetznutzung zwar abmildern. Allerdings setzten sich Videotelefonie-Dienste immer mehr durch, sagt Theumer. „Dafür braucht es keinen festen Telefonanschluss, sondern stabiles Internet.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53332326-umfrage-viele-junge-leute-verzichten-ganz-auf-ein-festnetztelefon-016.htm
SIEHE DAZU:
=> Je jünger, desto weniger: So viele nutzen noch das Festnetztelefon – Whatsapp, Skype oder Zoom: Internet-Telefonie ist stark – Corona-Effekt dürfte wieder verpuffen: Pandemie steigerte Festnetztelefonie nach Abwärtstrend der vergangenen Jahre – n-tv/abe/dpa, 6.7.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/So-viele-nutzen-noch-das-Festnetztelefon-article22664790.html
ÖSTERREICH
- STATISTIK AUSTRIA
Großhandelspreisindex im Juni 2021 um 11,2% über Vorjahresniveau
Produktionsindex stieg im Mai 2021 um 23,4%
Ein Fünftel mehr Pkw-Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2021, aber noch rd. ein Viertel unter dem Niveau 2019
Außenhandel im April 2021: markante Zuwächse im Vergleich zum schwachen Vorjahresmonat; Einfuhren +44,9%, Ausfuhren +37,7%
QUELLE: https://www.statistik.at
- MELDUNGEN
EU erwartet in Österreich 2021 Wachstum um 3,8 Prozent – ORF, 7.7.2021
Die Aussichten für die heimische Wirtschaft haben sich wegen der Coronavirus-Impffortschritte und positiven Signale aus dem Welthandel laut der von der EU-Behörde heute in Brüssel vorgestellten Sommerprognose wieder leicht gebessert.
Sie hob ihre Prognose für 2021 erneut an. Heuer rechnet die EU-Behörde mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,8 Prozent. In ihrer Frühlingsprognose war sie von einem Plus von 3,4 Prozent ausgegangen. Dennoch liegt Österreich zumindest heuer unter dem EU-Durchschnitt.
Im kommenden Jahr dürfte für Österreich der Aufschwung andauern: Für 2022 geht die EU-Kommission von 4,5 Prozent Wachstum aus wie in der von der EU-Behörde in Brüssel vorgestellten Sommerprognose festgehalten. Das ist mit einem Plus von 0,2 Prozentpunkten geringfügig mehr als noch im Frühling erwartet. Mit einem 4,5-Prozent-Wachstum liegt Österreich 2022 im EU- und Euro-Zone-Durchschnitt.
Euro-Zone soll heuer um 4,8 Prozent wachsen
Die Wirtschaft in der Euro-Zone dürfte der Brüsseler Prognose zufolge heuer um 4,8 Prozent und 2022 um 4,5 Prozent wachsen. Auch in der gesamten EU wird das BIP schätzungsweise heuer um 4,8 Prozent steigen, im kommenden Jahr um 4,5 Prozent.
„Das reale BIP wird voraussichtlich im letzten Quartal 2021 sowohl in der EU als auch im Euro-Raum sein Vorkrisenniveau erreichen“, heißt es in der Vorausschau.
Noch Mitte Mai setzte die EU-Kommission schwächere Werte an. Damals hieß es, die Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone werde dieses Jahr um 4,3 Prozent steigen und in der EU um 4,2 Prozent. Für 2022 wurden 4,4 Prozent Wachstum für die EU und Euro-Zone prognostiziert.
„Die Unsicherheiten und Risiken bezüglich der Wachstumsaussichten sind hoch, bleiben aber insgesamt ausgewogen“, heißt es in einer Aussendung. Das Ausbreiten der Delta-Variante zeige, wie wichtig die Beschleunigung der Impfkampagnen sei.
QUELLE: https://orf.at/stories/3220156/
Arbeitslosigkeit: AMS soll wieder schärfer sanktionieren – ORF, 5.7.2021
Rund 360.000 Menschen waren Ende Juni in Österreich arbeitslos gemeldet. ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher sieht nun dennoch den richtigen Zeitpunkt für eine „Normalisierung“ der Lage auf dem Arbeitsmarkt gekommen. Dazu sei dem Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag eine neue Zielvorgabe übermittelt worden. Es soll wieder schärfer kontrollieren und sanktionieren.
Mit dem Rückgang der Kurzarbeit habe das AMS nun mehr Kapazitäten für die Vermittlung von Arbeitskräften, sagte Kocher bei einer Pressekonferenz mit dem Titel „Auf zu neuen Arbeitswelten“ am Montag. In den vergangenen Monaten sei es teilweise nicht möglich gewesen, die bestehenden Zumutbarkeitsbestimmungen wie die Aufnahme einer Arbeit oder die Teilnahme an Schulungen umzusetzen.
„Die Regeln werden nicht verschärft, sondern man setzt die bestehenden Regeln durch und macht das Ganze verbindlicher“, sagte Kocher. Die Vermittlung durch das AMS sei ganz wichtig, es müsse daher „auch die Verbindlichkeit der Vermittlung über Sanktionen sichergestellt werden“, sagte der Arbeitsminister bereits am Sonntag in der ZIB2. „Das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe können bei der Verweigerung einer zumutbaren Arbeit sechs Wochen, im Wiederholungsfall acht Wochen gestrichen werden“, hieß es es aus dem Arbeitsministerium.
Das AMS habe eine Zielvorgabe vom Ministerium bekommen, wonach die Verbindlichkeit insgesamt stärker betont werde, so der Minister. Nach einer starken Qualifikationsoffensive gehe es jetzt auch mehr um die Vermittlung. „Jetzt geht’s darum, dass dort, wo es schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden, dass in dem Bereich auch Vermittlung wieder stattfindet.“ Die Verbindlichkeit betreffe etwa die Wahrnehmung von Terminen beim AMS oder die Annahme eines Arbeits- oder Qualifikationsangebots.
*** „Das ist legitim“ ***
Während der Pandemie habe das AMS mehr Nachsicht walten lassen, so Kocher. Er sagte, dass es nicht darum gehe, Ältere und Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in den Niedriglohnbereich zu drängen: „Es geht um die, die das System nicht so nutzen, wie es genutzt werden sollte. Das ist legitim.“ Es gehe darum, die Regeln bei Menschen durchzusetzen, die arbeitslos seien, nur geringfügig arbeiten wollten, aber Vollzeit arbeiten könnten. Kocher: „Das ist ein Zeichen, dass mit Schwarzarbeit die Anreize so groß sind, nicht zu arbeiten. Das ist auf Dauer eine Ausnützung des Arbeitslosensystems.“
Die stärkere Vermittlung sei vor allem in Bereichen, wo derzeit ein Mangel an Arbeitskräften herrsche, notwendig. Das betreffe die Gastronomie, den Tourismus und einige Bereiche in der Industrie. Kocher sprach hier von einem „regionalen wie auch qualifikatorischen ‚Mismatch‘“. Entsprechend brauche es auch Anreize, um etwa die Mobilität von Arbeitskräften von Ost nach West zu fördern.
Gerade im Tourismus sei der Arbeitskräftemangel auch auf fehlende Saisonniers zurückzuführen: „Die Saisonnierkontingente wurden bisher nicht ausgeschöpft. Das wird sich von selbst wieder einpendeln.“ Aber die Branche werde daran arbeiten müssen, attraktiv zu bleiben.
*** Rot-Weiß-Rot-Karte beschleunigen ***
Auch Antonella Mei-Pochtler, die Leiterin der Stabsstelle ThinkAustria im Bundeskanzleramt, sprach bei der Pressekonferenz die Diskrepanz etwa bei vorhandenen und nachgefragten Qualifikationen und bei regionalen Unterschieden beim Arbeitskräfteangebot an. Auf Basis von Interview mit Vertretern aus rund 40 Unternehmen erarbeitete sie Strategien, um bei der mittel- und langfristigen Entwicklung des Arbeitsmarktes mithalten zu können.
Handlungsbedarf gebe es bei der Digitalisierung, insbesondere bei den KMU, bei der systematischen Gewinnung von Fachkräften – die Rot-Weiß-Rot-Karte müsse beschleunigt werden – und bei der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Inklusion.
Mei-Pochtler: „Wir haben keine Glaskugel, was in fünf, zehn, 15 Jahren passieren wird. Aber wir müssen schneller reagieren.“ Entscheidend sei auch, dass nicht nur die Deutschsprachigkeit forciert werde, sondern auch die Englischkenntnisse der Österreicher und Österreicherinnen verbessert würden.
*** Reform des Arbeitslosengeldes geplant ***
Trotz der Krise habe es 2020 einen Missbrauch von AMS-Leistungen in Millionenhöhe gegeben, so Kocher. Das AMS habe im März 2020 seine Kontrolltätigkeiten aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage vorübergehend ausgesetzt, dennoch wurden im vergangenen Jahr Sanktionen in der Höhe von 66 Millionen Euro verhängt. Gründe waren laut Kocher meistens Arbeits- und Schulungsverweigerung, versäumte Kontrolltermine sowie selbst verschuldete Kündigungen und Selbstkündigungen.
Nicht ausgeschlossen ist für Kocher die Forderung der Wirtschaftskammer, den Zuverdienst bei der Arbeitslosigkeit zu befristen. Das sei „eine Möglichkeit, die man sich anschauen kann“. Das müsse aber in eine größere Reform eingebettet werden. Dabei sei auch ein degressives Modell des Arbeitslosengeldes möglich – also dass am Anfang des Bezuges die Absicherung des Einkommens verbessert werde und das Geld mit der Dauer des Bezuges sinkt.
*** Langzeitarbeitslose im Fokus ***
Umso mehr sieht Kocher als einen wesentlichen Teil der bevorstehenden Arbeitsmarktpolitik, die Zahl von derzeit rund 150.000 Langzeitarbeitslosen zu reduzieren. Bis Ende 2022 soll die Langzeitarbeitslosigkeit auf das Niveau von vor der Krise gebracht werden – das wären um 50.000 weniger.
Dafür stehen im kommenden Jahr 300 Millionen Euro zur Verfügung – heuer noch 100 Mio. Euro. Die SPÖ sprach bei dieser Aktion „Sprungbrett“ von einem „Marketing-Schmäh“. Kocher sieht das Programm als „sehr ambitioniert“. Das AMS setzt dafür auf eine Kombination von Eingliederungsbeihilfen und gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung.
*** Wirtschaft erfreut, Grüne skeptisch ***
Unterstützung kam von der Industriellenvereinigung (IV). Vermittlung sei der entscheidende Schlüssel für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsmarktpolitik müsse nicht zuletzt aufgrund des akuten Fachkräftemangels in zahlreichen Produktionsbetrieben wieder in einen „Normalmodus“ zurückfinden.
Auch die Wirtschaftskammer begrüßte den Vorstoß. Fachkräftemangel sei das dringlichste Problem vieler Betriebe, sagte Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer. „Wir müssen daher dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt wieder besser zusammenpassen. Jede Maßnahme, die dafür sorgt, ist zu unterstützen“, so Kopf.
*** Zustimmung der ÖVP, Kritik der Grünen ***
Positives Echo kam vom ÖVP-Wirtschaftsbund: „Arbeit muss sich wieder lohnen – und um das zu erreichen, brauchen wir jetzt die richtigen Anreize“, so dessen Generalsekretär Kurt Egger. ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger forderte: „Wer arbeiten kann und nicht will, gehört sanktioniert.“
Kritischer sieht der grüne Arbeits- und Sozialsprecher Markus Koza Kochers Vorstoß: „Druck auf Betroffene schafft keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz.“ Die Krise sei noch nicht vorbei. Nach wie vor gebe es eine große Lücke zwischen Arbeitssuchenden und Jobangeboten
*** Opposition kritisch ***
Heftige Kritik übte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: „Anstatt Arbeitslose in der Krise zu unterstützen, Jobprogramme zu beschließen und in die heimische Wirtschaft zu investieren, ziehen die Türkisen mit freundlicher Unterstützung der Grünen die Daumenschrauben an …“
Von einer „neoliberalen Einfachlösung“ sprach FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. Das sei „soziale Kälte in Reinkultur“. Als „gut“ bezeichnete NEOS die Erkenntnisse der Regierung, dass es Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen brauche. NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker vermisste aber konkrete geplante Maßnahmen.
QUELLE: https://orf.at/stories/3219848/
Zweidrittel-Mehrheit für Erneuerbaren Ausbau Gesetz steht – Salzburger Nachrichten/APA, 6.7.2021
Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne haben sich nach langen Verhandlungen mit der SPÖ über letzte Nachbesserungen im Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) geeinigt – damit ist die für das Gesetz notwendige Zweidrittel-Mehrheit gesichert und das EAG kann morgen (Mittwoch) im Nationalrat beschlossen werden. „Die Energiewende in Österreich startet, das EAG ist fertig“, verkündete Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Wien.
ür ihre Zustimmung hatte die SPÖ noch eine Reihe von Änderungen gegenüber dem vom Ministerrat am 17. März beschlossenen Entwurf verlangt, insbesondere sollten einkommensschwache Haushalte entlastet werden.
Die Einigung sieht nun vor, dass nicht nur die von der GIS befreiten Haushalte von allen Ökostrom-Abgaben befreit werden, sondern auch die Belastung für andere Haushalte mit 75 Euro pro Jahr gedeckelt wird. Insgesamt sollen rund 550.000 Haushalte gar keine oder geringere Ökostrom-Abgaben bezahlen. Das sind laut SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll vor allem Sozialhilfeempfänger, Mindestpensionisten und alleinerziehende Frauen. Laut Gewessler hat sich die Ökostrombelastung für die Haushalte bisher um die 100 Euro pro Jahr bewegt, in den nächsten Jahren sollen es etwa 114 Euro sein.
„Wir stehen zu 100 Prozent zu den Zielen, die sich auch die Regierung im Regierungsprogramm gesetzt hat, bis 2030 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen“, sagte SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Der SPÖ sei sehr wichtig gewesen, „dass es sozial ausgewogen sein muss“ und „dass es keine Zwei-Klassen-Energiewende werden darf“.
Auch die Fernwärmeförderung wäre laut Regierungsvorlage gestoppt worden, sagte Schroll, „wir haben das in das Gesetz aufgenommen“. Dafür sollen in den nächsten zehn Jahren bis zu 300 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Das betrifft insgesamt 173 Projekte, die seit 2011 auf eine Umsetzung warten. Zusätzlich sollen bis 2024 jährlich 15 Mio. Euro in den Ausbau der Fernwärme fließen. Der Ausbau von Wasserstoff und grünem Gas soll mit jährlich 80 Mio. Euro gefördert werden.
„Das EAG ist das größte Energiepaket, das wir seit 20 Jahren über die Bühne bringen“, sagte ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner. „Vor 20 Jahren war es die Liberalisierung, jetzt ist es die weitere Ökologisierung.“ Das EAG sei ein „Rieseninvestitionspaket“, das in den nächsten zehn Jahren mit Förderungen von 10 Mrd. Euro Investitionen von 30 Mrd. Euro auslösen werde. Wasserstoff sei der Schlüssel für die Energiewende, meint Brunner, dafür stünden in den nächsten zehn Jahren 500 Mio. Euro zur Verfügung.
Nach der Einigung zwischen ÖVP, Grünen und SPÖ kann das EAG nun am 7. Juli mit der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat beschlossen werden. Anschließend wird das EAG am 14. Juli im Bundesrat behandelt und kann auch dort beschlossen werden. Parallel zum Beschluss läuft der Notifizierungsprozess mit der EU-Kommission für alle Teile, bei denen das notwendig ist, z.B. Förderungen über Marktprämien.
*** Reaktionen von Politik und Nutznießern ***
WWF-Klimasprecher Karl Schellmann bewertet die erstmals verankerten Schutzkriterien für ökologisch wertvolle Fluss-Strecken als „Durchbruch“, weil damit „zumindest die schädlichsten neuen Kraftwerke von Subventionen ausgeschlossen werden“. Völlig verfehlt seien hingegen die „Schlupflöcher für Verbauungen in Schutzgebieten sowie für Kleinwasserkraft-Anlagen, die für relativ wenig Stromgewinn sehr viel Natur zerstören“.
Die Umweltschutzorganisation Global 2000 begrüßt die Einigung zum Erneuerbaren Ausbau Gesetz zwischen ÖVP, SPÖ und Grünen. „Das ist ein wichtiger Schritt zur Klimaneutralität bis 2040 und der Anfang vom Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle“, sagte Klima- und Energiesprecher Johannes Wahlmüller. Christoph Wagner, Präsident von Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ), sprach in einer Mitteilung von einem „guten Tag für die Energiewende“.
„Um die Energiewende Wirklichkeit werden zu lassen, wird es jedoch nicht reichen, lediglich erneuerbare Kapazitäten zu erhöhen“, meint Greenpeace-Klimaexpertin Jasmin Duregger. „Wir müssen dringend insgesamt weniger Energie verbrauchen – allem voran muss dafür ein neues und besseres Energieeffizienzgesetz als nächster, wichtiger Schritt verabschiedet werden.
NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker bezeichnete die Einigung als „zähe Geburt“. Die letzten Monate seien von großer Planungsunsicherheit für Betriebe im Sektor erneuerbare Energie geprägt gewesen. „Gut, dass sich das nun ändern soll.“
Die Arbeiterkammer hofft, dass das EAG auch positive Beschäftigungseffekte bringen wird und begrüßt die Deckelung der jährlichen Förderkosten mit 1 Mrd. Euro. Für eine Erhöhung bedürfe es jetzt einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. „Damit ist gesichert, dass es nicht quasi „automatisch“ zu einer Erhöhung der jährlichen Fördersumme kommt, wenn das Geld knapp wird.“ Kritisiert wird, dass eine zentrale Forderungen der AK, dass der Erneuerbaren-Förderbeitrag, die Förderpauschale sowie der Grüngas-Förderbeitrag nicht der Umsatzsteuer unterliegen, nicht umgesetzt wird.
Für Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf ist das Gesetzespaket „ein großes Investitions- und Innovationsvorhaben“. Die WKÖ „steht zur Energiewende und zum 100-prozentigen Ausbau erneuerbarer Elektrizität bis 2030.“ Der Präsident der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, begrüßte, dass das EAG nicht nur Planungssicherheit für die Errichter und Betreiber von Ökostromanlagen schaffe, sondern auch für die Industrie, die ihre Prozesse von fossilen Energieträgern auf erneuerbaren Strom umzustellen habe.
Auch Oesterreichs Energie begrüßt die EAG-Einigung. Die wesentlichen Aspekte des Pakets seien aus Sicht der Strombranche „die differenzierte Förderkulisse, die Definition technologiespezifischer Ausbaupfade, die einen gleichzeitigen Ausbau aller Erzeugungsformen sicherstellt, und die Einführung einer wettbewerbsorientierten Marktprämie“, erklärte Michael Strugl, Präsident von Oesterreichs Energie.
Auch die Windkraft-Branche ist zufrieden. „Damit kann die Windparkplanung, die jetzt eineinhalb Jahre stillgestanden ist, wieder aufgenommen werden“, sagte Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. „Um das Regierungsziel erreichen zu können, die Windstromproduktion um 10 TWh zu steigern, wird der Ausbau aber mehr als 400 MW pro Jahr betragen müssen.“
QUELLE: https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/zweidrittel-mehrheit-fuer-erneuerbaren-ausbau-gesetz-steht-106212796
Ökostrom: Zulasten der Netze – Bis 2030 soll der gesamte heimische Strom grün sein. Ob bis dahin auch die Leitungen stark genug sind, ist jedoch unklar – Wiener Zeitung, 9.7.2021
Mehr als 280 Tage vergingen. Vom Gesetzesentwurf bis zum tatsächlichen Gesetz. Vergangenen Mittwoch war es dann soweit, das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wurde im Nationalrat beschlossen. Eine rekordverdächtig lange Zeit, die sich die Verantwortlichen bei der Umsetzung aber nicht mehr leisten können. Denn das Ziel, den heimischen Strom bis 2030 ausschließlich aus Sonne, Wind und Wasser zu erzeugen, ist ambitioniert.
Der Stromversorger Austrian Power Grid (APG) steuert und verantwortet das überregionale Stromtransportnetz. Das EAG sei nur der eine Teil, um die Stromversorgung umzustellen, sagt APG-Vorstand Gerhard Christiner. Um das Ziel zu erreichen, müssen gleichzeitig auch Netz- und Speicherkapazitäten erhöht werden. „Nur dann sehen wir die Sicherheit im Stromsystem im Sinne des Wirtschaftsstandorts Österreich nachhaltig gewährleistet“, sagt er. Christiner betont daher: „Der notwendige Umbau des Stromsystems ist eine Mammutaufgabe.“
Die Energie, die produziert wird, muss auch erfolgreich gemanagt werden. Dafür fehlt es jedoch in der Grundausstattung. Mehr Umspannwerke, stärke Stromnetze und das Vertrauen der Bevölkerung sind notwendig.
*** 21 Jahre für den Bau der Salzburger Freileitung ***
Christiner verweist auf den Ausbau der Freileitung in Salzburg, wo Einsprüche der Anrainer den Bau verzögerten. Sie forderten unterirdische Verkabelungen, um das Landschaftsbild zu schützen. Die Planungen begannen 2005, 2026 werden sie in Betrieb gehen. 21 Jahre sind dann vergangen. „Das Entscheidende ist die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren bei energiewirtschaftlichen Anlagen. Nur wenn die Verfahrensgeschwindigkeit schneller wird, können die Ziele bis 2030 erreicht werden.“
Doch das wird nicht einfach. Die Akzeptanz der Bevölkerung, wenn etwa ein Windrad gebaut wird, sei nicht mehr so hoch, wie noch vor ein paar Jahren. Auch die Ladesäulen für E-Autos werden deutlich steigen, um den Bedarf zu decken. Das werde nicht immer zur Freude der Anrainer sein. Zuständig ist dann nicht der Bund, sondern lokale Ebenen.
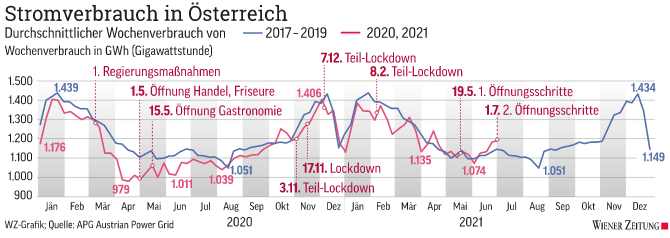
Nicht zu unterschätzen sind auch die Kosten der Stromwende. „Die aktuelle Netzinvestitionsplanung der APG in Höhe von 3,1 Milliarden Euro ist nicht die finale Antwort auf das EAG.“ Es werden ein paar dutzend Milliarden Euro investiert werden müssen. In die Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur der Bahn, in die Umstellung der mit Diesel betriebenen Nebenbahnen, Wärmedämmung in Gebäuden, Umstellung der Unternehmen von Öl und Gas auf erneuerbare Energien, um ein paar Beispiele zu nennen. Die gesamte Energiewende in Österreich werde 50 bis 100 Milliarden Euro kosten.
Und dann wäre da noch die Gefahr eines Blackouts, eines Stromausfalls. Dazu kam es beinahe im Jänner. Der kroatische Netzknoten fiel aus, das führte zu unterschiedlichen Frequenzen in Nord-, als in Südeuropa. Sie konnten im letzten Moment wieder angeglichen werden.
Mit erneuerbaren Energien steht das europäische Stromnetz vor neuen Herausforderungen, denn Sonnen- und Windkraft sind nicht immer verfügbar und müssen gespeichert werden. „Je mehr volatile Energie, desto leistungsstärker muss die Strominfrastruktur sein“, sagt Christiner. Dafür müssten aber noch Detailkonzepte erarbeitet werden.
Wie die Stromwende bis 2030 gelingen soll, werde noch analysiert, sagt er. Bis zum Netzentwicklungsplan 2022 werde es Antworten geben. Präsentiert wird dieser im November des nächsten Jahres. Dann wird man wissen, ob die Ziele des EAG erreicht werden können.
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2111985-Zulasten-der-Netze.html
KOMMENTAR AUS FREMDER FEDER
Thomas Fuster: Die Europäische Zentralbank will künftig auch Inflationsraten über 2 Prozent tolerieren. Das ist gefährlich und verheisst nichts Gutes für die Schweiz – Weitreichende Folgen – Bedrohte Stabilitätskultur – Neue Zürcher Zeitung, 8.7.2021
Eine Inflation von 2 Prozent gilt für Europas Währungshüter nicht länger als Obergrenze. Vielmehr sollen auch höhere Teuerungsraten toleriert werden. Mit dieser Strategieänderung entfernen sich Europas Währungshüter immer weiter von den Prinzipien der Stabilitätskultur.
Das eigene Handeln in regelmässigen Abständen zu hinterfragen, ist eine vernünftige Idee. Das gilt auch für die Geldpolitik, wo ein periodisches Innehalten in Zeiten negativer Zinsen und gigantischer Geldmengen erst recht geboten scheint. Im Falle der Europäischen Zentralbank (EZB), die ihre Strategie seit Januar 2020 einer detaillierten Überprüfung unterzogen hat, vermag das Ergebnis allerdings nicht zu überzeugen.
So wurde die Rückschau nicht genutzt, um Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Vielmehr werden die unheilvollen Trends mit der von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vorgestellten Strategie noch verstärkt. Das Signal lautet nämlich: noch mehr Geld drucken, noch niedrigere Zinsen, noch mehr Überforderung der Währungshüter.
*** Potenziell weitreichende Folgen ***
Der wichtigste Streitpunkt der Strategieüberprüfung betraf die Definition von Preisstabilität. Bisher strebte die EZB in mittlerer Frist eine Inflation von «unter, aber nahe 2 Prozent» an. Neu wird ein Ziel von schlicht 2 Prozent angepeilt. Wichtiger als diese Definition ist der Verweis auf den «symmetrischen» Charakter des Ziels; negative und positive Abweichungen sind künftig nämlich gleichermassen unerwünscht.
Was nach einer semantischen Spitzfindigkeit klingt, hat potenziell weitreichende Folgen. So ist das Inflationsziel von 2 Prozent nicht länger als Obergrenze zu verstehen. Vielmehr erteilt sich die EZB mit ihrer neuen Strategie nun die explizite Legitimation, auch ein Überschiessen der Inflation über 2 Prozent hinzunehmen. Für Bürgerinnen und Bürger, denen der Werterhalt des Euro am Herzen liegt, ist das keine beruhigende Nachricht.
Klüger wäre es gewesen, sich die Schweizerische Nationalbank (SNB) zum Vorbild zu nehmen. Diese definiert Preisstabilität als eine Inflation irgendwo zwischen 0 und 2 Prozent. Mit diesem breiten Zielband berücksichtigt die SNB nicht nur den Umstand, dass es für eine Notenbank sowieso unmöglich ist, die Inflation punktgenau zu steuern. Sie bewahrt sich auch Flexibilität, wenn die Teuerung innerhalb dieses Zielbandes schwankt.
Eine solche Flexibilität hat die EZB schon lange vermissen lassen. Sie verfällt stets in hektischen Aktivismus, wenn die Inflation auch nur minim vom 2-Prozent-Zielwert abweicht. Bei der SNB, wo man mit einer Inflation von 0,5 oder 1 oder 1,5 Prozent gleichermassen gut leben kann, ist das anders. Solche Gelassenheit wäre auch der EZB zu empfehlen.
*** Bedrohte Stabilitätskultur ***
Eine der wenigen europäischen Notenbanken, die für eine solch gelassenere Politik zu haben wäre, ist die Deutsche Bundesbank (Buba). Diese dürfte sich mit ihrer stabilitätspolitischen Tradition aber zusehends einsamer fühlen im Euro-System. Denn der geldpolitische Zeitgeist weht in eine andere Richtung.
Neidvoll blicken viele europäische Währungsbehörden – namentlich jene im Süden – nach Amerika, wo das Inflationsziel von 2 Prozent seit kurzem nur noch im Durchschnitt gilt. Das heisst: Eine zu niedrige Inflation in der Vergangenheit wird ausgeglichen durch ein Überschiessen der Teuerung in Zukunft. Einen solchen Automatismus sieht die neue Strategie der EZB zwar nicht vor, was primär dem Widerstand der Buba zu verdanken sein dürfte. Man bewegt sich aber auf das amerikanische Fed zu.
Einige Kommentatoren bezeichnen diese Annäherung bereits als «Tod der Bundesbank-Tradition». So weit muss man nicht gehen. Aber die Geldpolitik der EZB dürfte tendenziell noch lockerer werden und das Ziel der Preisstabilität weiter an Gewicht verlieren. Für die SNB verheisst das nichts Gutes. Will sie eine Aufwertung des Frankens verhindern, muss sie wohl – widerwillig – die Strategieänderung nachahmen, also ihre extrem expansive Politik länger als gewünscht fortsetzen. Auch die Schweiz wird deshalb darunter leiden, dass die EZB ihre Selbstreflexion nicht zu einer Stärkung der europäischen Währungsordnung genutzt hat. Vielmehr hat die komplexe Übung bloss zu einer Verschlimmbesserung geführt.
QUELLE: https://www.nzz.ch/meinung/die-europaeische-zentralbank-will-kuenftig-auch-inflationsraten-ueber-zwei-prozent-tolerieren-das-ist-gefaehrlich-und-verheisst-nichts-gutes-fuer-die-schweiz-ld.1634674
SIEHE DAZU LESERKOMMENTARE:
Leser Philip H.: Die Neubeurteilung des Inflationsziels der EZB verheisst vor allem sozialpolitisch nichts Gutes. Erwiesenermassen trifft der Geldwertverlust (= Inflation) vorwiegend untere und mittlere Einkommensschichten, welche über ungenügend reale Vermögenswerte verfügen, um einem inflationären Umfeld entgegenzuwirken. Es macht den Eindruck, dass die EZB bereit ist zunehmend grössere Bevölkerungsschichten innerhalb der EU relativ verarmen zu lassen, um einige marode EU-Staaten von einem mittelfristig drohenden Staatsbankrott zu bewahren. Diese Gratwanderung erscheint gefährlicher, als die Kommunikation der EZB zunächst vermuten lässt. Die bereits seit längerem zu beobachteten Abkehr von einer der Preisstabilität verpflichtenden Geldpolitik der EZB erscheint fahrlässig, da sie den Zusammenhalt der Gesellschaften und somit auch den Frieden bedroht. Die Auswirkungen einer solchen Geldpolitik geht weit über die Bevorzugung vermögender Bürger hinaus, indem sie die Saat legt für künftige gesellschaftliche Umwälzungen, bis zu kriegerischen Ereignissen hin. Es erstaunt, dass die EZB ihre grosse Verantwortung für das Wohlergehen der Bevölkerung der EU dermassen auf die leichte Schulter nimmt.
Leser Reinhard J.: Ich beobachte seit mehr als zehn Jahren eine Politisierung der EZB Entscheidungen. Die EZB ist n.m.M. schon längst nicht mehr unabhängig, eher ein Fortsatz Deutsch/ Französischer Diktate. Wenn Politiker in etwas eingreifen, wovon sie nichts verstehen, ist nichts GUTES am Ende zu erwarten.
Michael Heise: EZB zwischen Konjunkturstimulierung und Finanzmarktstabilität – Finanz & WIrtschaft,k 5.7.2021
Die Debatte über Korrekturen der expansiven Geldpolitik wird nicht lange auf sich warten lassen.
Fortschritte bei den Impfkampagnen und eine Erholung der Weltkonjunktur haben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Ländern der Eurozone in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. In diesem Umfeld hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Projektionen für den Anstieg der Konsumentenpreise und für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts in diesem und im nächsten Jahr erhöht. Da sie aber schon bald wieder mit Inflationsraten deutlich unterhalb ihres Zielwerts rechnet, bleibt sie bei einer unverändert expansiven Ausrichtung der Geldpolitik. Den Zeitpunkt für Ausstiegsdebatten und eine Straffung der Politik sieht sie noch nicht gekommen. Angesichts günstiger Wachstumsaussichten und weiter steigenden Inflationsdrucks wird sich diese Frage aber im weiteren Jahresverlauf mit grösserer Vehemenz stellen. Vorsichtige Korrekturen der Geldpolitik erscheinen angebracht.
Der höhere Preisniveauanstieg der vergangenen Monate ist nach Einschätzung der EZB vorwiegend durch temporäre Effekte bedingt. So hat sie ihre Inflationsprojektionen für dieses Jahr und auch für 2022 leicht erhöht, sieht jedoch bereits im kommenden Jahr eine Veränderungsrate der Konsumentenpreise im Euroraum von nur 1,5%, die unterhalb ihres Zielwerts liegt. Auch die etwas erhöhten Projektionen der EZB sind allerdings als sehr moderat anzusehen.
Richtig ist, dass sich die Inflationsrate in der Währungsunion auf einem deutlich niedrigeren Niveau bewegt als in den USA, doch die preistreibenden Mechanismen sind dieselben: Energieverteuerung und breite Steigerung der Rohstoffpreise, Angebotsengpässe bei Vorprodukten, hohe Transportkosten (Containerfrachtraten) und kräftige Steigerung der Nachfrage besonders nach Dienstleistungen werden die Inflationsraten auch auf der Konsumentenebene auf hohem Niveau halten und im Verlauf des zweiten Halbjahres wohl über 3% steigen lassen.
*** Lohnentwicklung ungewiss ***
Mit der Zeit werden Engpässe und Angebotseinschränkungen überwunden werden, und auch der preistreibende Nachholbedarf bei den Dienstleistungen wird abebben. In Anbetracht der hohen Geldbestände, die in der Eurozone während der Coronapandemie zusätzlich angespart wurden und die zum grossen Teil für Nachholkonsum verwendet werden dürften, könnte die gesamtwirtschaftliche Nachfrage allerdings noch bis weit ins Jahr 2022 hinein recht stark bleiben. Überdies hängt es in erheblichem Mass von den zukünftigen Lohnsteigerungen ab, ob die Inflationsraten schon bald wieder unter die Zielmarke von 2% sinken werden. Angesichts deutlicher Kaufkraftverluste für Lohnempfänger, stark steigender Unternehmensgewinne und des Arbeitskräftemangels in vielen Bereichen ist durchaus mit steigenden Lohnabschlüssen zu rechnen.
Die EZB hat bislang keinerlei Hinweise auf Korrekturen ihrer extrem expansiven Geldpolitik gegeben und setzt ihre Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) unvermindert fort. Den Moment für eine Diskussion über den geldpolitischen Ausstieg sei noch nicht gekommen; vielmehr sei es wichtig, weiterhin günstige monetäre Rahmenbedingungen zu sichern. Für die Teilnehmer an den Finanzmärkten ist dies eine Art Zusicherung, dass die EZB sich deutlich steigenden Kapitalmarktrenditen für Staatsanleihen und verschlechterten Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen entgegenstellen würde. Bei starker Konjunktur und anhaltend expansiver Geldpolitik stehen die Chancen daher gut, dass sich die Bewertungen etwa von Aktien oder Immobilien trotz des bereits erreichten hohen Niveaus weiter positiv entwickeln.
Allerdings wird sich die Frage nach Korrekturen der Geldpolitik, besonders im Hinblick auf eine Rückführung der gross dimensionierten Anleihenkaufprogramme, in den kommenden Monaten deutlicher stellen. Denn wenn die monetären Bedingungen zu lange zu locker bleiben, drohen – neben unerwünscht hohen Inflationserwartungen – auch zunehmende Übertreibungen an den Finanzmärkten, die eine Gefahr für das mittelfristige Wachstum darstellen. Darauf weist nicht nur der Internationale Währungsfonds regelmässig in seinen Analysen hin. Risiken für die gesamtwirtschaftliche Entwicklungen treten vor allem dann auf, wenn Übersteigerungen an den Finanzmärkten mit einer hohen Kreditdynamik im privaten Sektor einhergehen. Man muss sich nur an die Extremfälle der vergangenen zwei Jahrzehnte erinnern, die Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends oder die Subprime-Krise vor dreizehn Jahren, die gezeigt haben, wie gross die Verluste an Wachstum und Wohlstand sein können, wenn krasse Übertreibungen an den Finanzmärkten korrigiert werden.
Für die Geldpolitik kann es also wichtig und richtig sein, sich bei Finanzmarkteuphorie gegen den Wind zu lehnen und nicht allein auf die Bankenregulierung zu vertrauen, um die Finanzstabilität zu wahren. Auch in der derzeitigen Situation spricht einiges für diese Strategie: Sehr stark steigende (reale) Immobilienpreise, hohe Aktienmarktbewertungen, äusserst niedrige Risikoprämien in sehr vielen Finanzmarktsegmenten und der schubartige Anstieg der im privaten Sektor umlaufenden Geldmenge sprechen dafür, den Expansionsgrad der Geldpolitik zumindest etwas zu reduzieren und marktgetriebene Erhöhungen der Kapitalmarktrenditen nicht vollständig zu unterbinden. Das kann den Konjunktur- und Finanzmarktzyklus kurzfristig etwas dämpfen, bringt aber mittelfristig höheres und stetigeres Wachstum.
*** Flexiblere Inflationssteuerung ***
Die vermutlich im September anstehende strategische Überprüfung der Geldpolitik der EZB wäre eine Möglichkeit, die Auswirkungen der Notenbankpolitik auf die Finanzmarktentwicklung auch in systematischer und konzeptioneller Weise zu berücksichtigen. Sollte sich die EZB etwa für eine flexiblere Form der Inflationssteuerung entscheiden, bei der das Stabilitätsziel etwas umfassender oder auch als Bandbreite um die 2% formuliert wird, entstünde ein grösserer Handlungsspielraum für die Währungshüter, die Risiken und Nebenwirkungen ihrer Politik etwa auf die Finanzmarktentwicklung stärker zu gewichten. Monetäre Entwicklungen wie das Geldmengen- und das Kreditwachstum sind für die mittelfristige Finanzmarktstabilität in der Währungsunion von grosser Bedeutung, und es wäre gut, wenn ihnen geldpolitisch wieder mehr Bedeutung zukommen würde. Das wäre eine Stärkung der «zweiten Säule» der geldpolitischen Strategie, die seit Beginn der Währungsunion und der EZB existiert, aber in den vergangenen Jahren in der praktischen Politik keine hervorgehobene Rolle gespielt hat.
FAZIT: Geldpolitik ist stets eine Abwägung von Chancen und Risiken. Derzeit schätzt die EZB die Chancen einer fortgesetzt expansiven Politik offenbar als grösser ein als die Risiken und Nebenwirkungen, die sich als höhere Inflation und weiter steigende Gefahren an den Finanzmärkten zeigen können. Die Debatte über notwendige Korrekturen der expansiven Geldpolitik, die in den USA bereits stattfindet, wird im Euroraum nicht lange auf sich warten lassen. Auch hier dürfte der erste Schritt in einer Rückführung der grosszügigen Anleihenkaufprogramme liegen. Angesichts der nach jahrelangen Niedrigzinsen sehr hohen Bewertungen an den Finanzmärkten und des beträchtlichen Finanzierungsbedarfs der öffentlichen Haushalte werden Korrekturen der Geldpolitik Kritik hervorrufen und höchstwahrscheinlich auch Kursverluste bei Anleihen und anderen Finanzmarktprodukten nach sich ziehen. Im Interesse einer mittelfristig stabilen Wirtschafts- und Finanzmarktentwicklung müssen sie dennoch stattfinden.
MICHAEL HEISE ist Chefökonom von HQ Trust, ökonomischer Berater und Wirtschaftspublizist.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/ezb-zwischen-konjunkturstimulierung-und-finanzmarktstabilitaet/
Thomas Fricke: Überforderte Zentralbank: Wenn Notenbanker die Welt retten müssen – Der Spiegel, 10.7.2021
Finanzkrise, Eurokrise, Coronakrise, Klimakrise: Die Europäische Zentralbank mischt bei einer Alarmsituation nach der anderen mit. Dabei ist sie doch vor allem für stabile Preise zuständig. Oder etwa nicht?
Es lag schon eine Weile in der Luft – jetzt ist es raus: Europas Notenbanker wollen künftig dazu beitragen, das Klima zu retten. So verlautbarte Christine Lagarde, Chefin der mächtigen Europäischen Zentralbank, nach interner Strategiedebatte. Der EZB-Rat habe einen umfassenden Aktionsplan beschlossen, um »Überlegungen zur ökologischen Nachhaltigkeit systematischer in seiner Geldpolitik zu berücksichtigen«, hieß es am Donnerstag.
Und das Gezeter in Deutschland ist sofort groß, zumal die Notenbanker schon seit Jahren ungewöhnlich stark intervenieren und etwa Staatsanleihen kaufen: So viele Aufgaben überforderten die Währungshüter, die doch nur für die Wahrung von Preisstabilität zuständig sein sollten, schimpfen einige.
Wirklich? Was auf den ersten Blick naheliegend wirkt, könnte sich bei näherer Betrachtung als verklärte Schönwettervorstellung dessen herausstellen, was Aufgabe von Notenbanken ist – aus einer Zeit, in der die Welt noch einfacher schien. Wenn Währungshüter rund um den Globus heute immer wieder massiv eingreifen, hat das ja weniger mit einer plötzlichen Laune zu tun, sondern womöglich damit, dass es heute viel mehr Krisen und tiefere wirtschaftliche Schieflagen gibt. Da braucht es wahrscheinlich eine sehr viel grundlegendere Neudefinition dessen, was Zentralbanken tun, als es die EZB jetzt formuliert hat – und sehr viel mehr Schutz vor den Ursachen der eigentlichen Missstände.
*** Multimilliardenbeträge in wenigen Stunden ***
Klar wirkt es irre, wenn Notenbanken monatlich zweistellige Milliardenbeträge an Anleihen von Staaten und Unternehmen aufkaufen – oder wie beim Ausbruch der Coronapandemie in Krisennot binnen Stunden Multimilliarden aufkaufen, weil an den Finanzmärkten zunehmend Panikverkäufe getätigt werden. Das hat mit der urigen Vorstellung nur noch wenig zu tun, wonach die heiligen Währungshüter in Unabhängigkeit gelegentlich mal die Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt anheben oder senken.
Ebenso irre ist nur, zu suggerieren, die geschätzten Notenbanker hätten damit so mir nichts, dir nichts angefangen – etwa weil sie damit irgendwelchen Finanzministern einen Gefallen tun wollten.
Wieso dann? Nach althergebrachtem Verständnis sollten die Notenbanker über das Auf und Ab der Zinsen schlicht und einfach für Preisstabilität sorgen – in guten Zeiten höhere Zinsen, damit Konjunktur und Preise nicht überschießen (und umgekehrt). Denn von stabiler Kaufkraft haben alle gleichermaßen etwas, hieß es. Und weil alle anderen wirtschaftlichen Ziele – ob Vollbeschäftigung, ordentliche Staatshaushalte oder gut funktionierende Finanzmärkte – entweder von allein laufen oder durch die Regierenden zu gewährleisten sind. Nach dem Motto: Was haben die Notenbanker mit all dem zu tun? Da ergibt es auch Sinn, die Hüter des Geldes mit dieser vermeintlich neutral-technokratischen Aufgabe allein zu lassen – und sie möglichst unabhängig zu machen, wie das über Jahrzehnte als Diktum galt.
Mit der Wirklichkeit hat das Traummodell aber zunehmend weniger zu tun – schon seit in den Achtzigerjahren die große Deregulierung und Globalisierung der Finanzmärkte ihren Lauf nahm. Kein Zufall: Erstmals massiv intervenieren mussten die Währungshüter 1987, als nach dem ersten Schub der Finanzderegulierung in den USA und Großbritannien die Aktienmärkte vor Freude erst eskalierten – und dann im Herbst crashten.
Es folgten finanzeuphorisierte Booms und anschließende Crashs in Japan, Südostasien und anderen Schwellenländern in den Neunzigerjahren, später die Euphorie und der Crash rund um die Hightech-Revolution und die (angebliche) New Economy. Nicht zu vergessen: der große (Immobilien-)Crash 2008. Anschließend die Eurokrise. Ähnliches Muster. Und aktuell, als die Notenbanken nach Ausbruch der Pandemie zu Hilfe eilten.
*** Rettung geglückt, die Finanzparty geht weiter ***
Jedes Mal mussten die Notenbanken ran und retten – und sei es wie bei Mario Draghi 2012 schlicht über: Wir retten, egal was es kostet. Da reichte schon die Botschaft, um Spekulationen aufs Euro-Aus zu ersticken. Krise weg.
Sicher, jede Rettungsaktion hat an sich wieder dazu beigetragen, dass die Finanzparty weitergehen konnte – nur ist die Rettungsaktion der Feuerwehr dafür nicht weniger dringlich gewesen. Die lokale freiwillige Feuerwehr rückt ja auch aus, egal wer das Feuer gelegt hat.
Je stärker der Einfluss der Finanzmärkte samt auseinanderdriftender Vermögen, desto wackeliger ist auch die Annahme geworden, dass das, was die Notenbanken jenseits akuter Krisen tun, per se völlig neutral und für alle gut ist. Natürlich ist es nicht egal, wie hoch die Zinsen sind. Von hohen Sätzen profitieren vor allem die, die viel Vermögen haben, und es leiden die Schuldner. Umgekehrt führt jede Rettungsaktion wie zuletzt in der Coronakrise dazu, dass etwa die Banken, die dadurch wieder mehr Geld haben, auch wieder mehr Geld in Aktien investieren – was die Kurse treibt und dazu beigetragen hat, dass die oberen zehn Prozent, die das Gros der Aktien halten, überdurchschnittlich von der Krise profitiert haben. Umgekehrt ist nicht unwichtig zu erörtern, was ohne Intervention realwirtschaftlich passiert wäre: wenn alle Erfahrung darauf hindeutet, dass etwa dank niedriger Zinsen ein Finanzcrash verhindert wurde, der am Ende zulasten der weniger Betuchten gegangen wäre.
So ein Finanzcrash endet oft mit hoher Arbeitslosigkeit und fallenden Einkommen. Ähnliches gilt für die Geldpolitik auch außerhalb akuter Krisen. Wenn Notenbanken eine Inflation mit höheren Zinsen bremsen wollen, funktioniert das auch darüber, dass bei höheren Zinsen schlicht weniger investiert wird – und es im Zweifel mehr Arbeitslose gibt.
*** Geldpolitik lässt sich nicht auf das pure Überwachen stabiler Preisniveaus reduzieren ***
Ähnliches gilt im Grunde auch für die Klimakrise. Auch da ist die Annahme eher gewagt, nach der die Notenbanker sozusagen klinisch neutral agieren. Wenn sie vermeintlich gleichmäßig-neutral Anleihen von Unternehmen kaufen, die das Klima aber stark schädigen, tragen sie in Wirklichkeit auch dazu bei, dass es umso länger dauert, bis diese Unternehmen in klimaneutrale Produktion investieren. Das zementiert bestehende Strukturen in einer Zeit, in der es gesellschaftlicher Konsens ist, dass sich die wirtschaftlichen Strukturen zur Rettung des Klimas möglichst schnell wandeln müssen. Was wäre da demokratisch?
Es hat jedenfalls etwas Absurdes, wenn Notenbanken anno 2021 monatlich so viel Geld ausgeben, um Anleihen zu kaufen, ohne mit dem vielen schönen Geld aktiver zur Lösung des womöglich dramatischsten Problems unserer Zeit beizutragen. Zumal nicht auszuschließen ist, dass bei den nächsten Klimaschocks all jene Finanzwerte abstürzen, die noch stark an fossilen Energien hängen – was wiederum den nächsten Crash nach sich ziehen könnte. Auch das wäre nicht im Interesse unserer Währungshüter.
All das zusammen stellt fundamental infrage, wie sich die Urväter der klinisch-neutral-unabhängigen Notenbankerwelt das vorgestellt hatten. Geldpolitik ist (heute) weder neutral noch gesellschaftlich auf das pure Überwachen stabiler Preisniveaus reduzierbar. Sosehr es die Notenbanker und ihre Vordenker auch wünschen. Was sie tun, ist de facto immer politisch und demokratisch relevant.
Natürlich ist es ein Problem, wenn Notenbanken über so wichtige Dinge wie Finanzstabilität, Vermögensverteilung und Arbeitslosigkeit irgendwie doch mitentscheiden müssen – ohne dass sie dafür gewählt wurden und demokratisch hinreichend Rechenschaft abgeben müssten. Nur ist die Wirklichkeit nun einmal so. Und es hilft nichts, dafür die Retter zu schelten – man schimpft ja auch die Feuerwehr nicht dafür, dass sie zur Löschung des Waldbrands angerückt ist und beim Löschen alles nass gemacht hat.
Wer nicht will, dass die EZB so massiv interveniert, Staatsanleihen kauft und die Zinsen noch etwas niedriger hält als ohnehin schon, der sollte sich dringend dafür einsetzen, die Finanzglobalisierung wieder so stark unter Kontrolle zu bringen, dass nicht die halbe Welt am Wankelmut regelmäßig abdriftender Spekulation hängt, Banken sich stattdessen wieder stärker auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren, reale Investitionen zu finanzieren, und es überhaupt weniger Stoff zum Spekulieren gibt – sprich: es nicht alle paar Jahre zum nächsten irren Boom und zum nächsten großen Crash kommt. Bis dahin ist es zwar bitter, wenn Notenbanken immer wieder intervenieren müssen. Nur hilft’s ja nichts, wenn bei Nichteingreifen sehr viel schwerere reale Krisen mit Arbeitslosigkeit und Deflation drohen.
Da muss man die Brandursachen bekämpfen – nicht die Feuerwehr.
Utopie? Wirkt so. Nur lohnt sich der Versuch. Wenn das eines Tages gelingt, die Finanzwelt wieder aufs Wesentliche zu schrumpfen, brauchen Notenbanker nicht mehr in der Not Krisen zu beenden. Oder mit Daueraufkäufen die Deflation zu verhindern. Oder die Zinsen noch etwas niedriger zu halten. Oder damit zu leben, dass die eigene Politik die Aktien-Reichen noch aktienreicher macht. Es bräuchte womöglich nicht einmal Aufregung darum, ob die Notenbanker dem Klima helfen sollten oder nicht. Die Frage nach grünen oder braunen Anleihen würde sich ja umso weniger stellen, je weniger Anleihen die Währungshüter zur Stabilisierung der Welt kaufen müssten.
Das wäre dann fast wieder wie früher – vor der großen Finanzsause.
THOMAS FRICKE, Jahrgang 1965, leitet seit 2007 das Internetportal WirtschaftsWunder. Von 2002 bis 2012 war er Chefökonom der »Financial Times Deutschland«. Er ist Mitgründer des »Forum New Economy«, in dem sich Experten zusammengeschlossen haben, um ein neues wirtschaftliches Leitmotiv zu entwerfen.
QUELLE: https://www.spiegel.de/wirtschaft/ezb-wenn-notenbanker-die-welt-retten-muessen-kolumne-a-aa6e921b-2d68-4cd3-9d9f-b8f889467d90
Interview: Ökonom erklärt Negativzinsen „In der Verfassung steht nichts von Sparern“ – n-tv, 5.7.2021
Verfassungsrechtler Paul Kirchhof behauptet, die negativen Einlagezinsen der Europäischen Zentralbank verstießen gegen die Verfassung, da sie Sparer „enteigneten“. Wirtschaftsprofessor Jens Südekum erklärt im ntv.de-Interview, warum er diese Argumentation für ein „Desaster“ hält und was es mit den Minuszinsen der Banken wirklich auf sich hat. …
F: ntv.de: Sie haben die Aussagen von Paul Kirchhof als ein „einziges Desaster“ bezeichnet. Was stört Sie denn daran am meisten?
A: Jens Südekum: Am meisten stört mich eine Widersprüchlichkeit an der Aussage von Herrn Kirchhof: Erstens beklagt er sich über Negativzinsen, die angeblich die EZB zu verantworten hat. Andererseits spricht er sich strikt gegen staatliche Neuverschuldung aus. Diesen Ausweg, der dafür sorgen könnte, dass die Zinsen wieder ein bisschen steigen, der ist ihm auch nicht recht. Von Verfassungswidrigkeit zu sprechen, ist aus meiner Sicht zudem völlig verfehlt. In der Verfassung steht nichts von Sparern. Der Sparer als Figur taucht dort gar nicht auf.
F: Kirchhof kritisiert, dass die EZB in das verfassungsrechtlich geschützte Privateigentum eingreife. Ist das denn nicht so?
A: Nein, die EZB betreibt Geldpolitik gemäß ihres Mandates. Das Mandat lautet Preisstabilität. Das ist so definiert, dass die Inflationsrate in der Eurozone unterhalb, aber nah bei zwei Prozent liegen sollte. Wenn man schaut, was tatsächlich passiert ist in den letzten 10 bis 15 Jahre, dann wurde dieses Ziel systematisch unterboten, die Inflation war immer zu niedrig. Das ist der Grund, warum die EZB eine so expansive Geldpolitik betreibt, und die Leitzinsen so niedrig sind. Es ist ein Instrument, mit dem die EZB ihr Mandat erfüllt, wozu gehört, dass die Eurozone nicht in eine Deflation abrutschen darf.
F: Kirchhof argumentiert – und viele Menschen haben das so in Erinnerung -, dass man sich früher darauf verlassen konnte auf seine Spareinlagen Zinsen zu bekommen und so Geld zu verdienen. War das wirklich so?
Mit Spareinlagen hat man noch nie Geld verdient, real. Nominalzinsen waren früher höher, das stimmt. Also die Zinsen, die tatsächlich gutgeschrieben wurden auf dem Sparbuch, die lagen auch schon mal bei drei Prozent oder höher. Aber das waren Zeiten als die Inflation auch bei drei oder fünf Prozent oder noch höher lag. Das heißt, die Realverzinsung von Sparguthaben war auch zu Zeiten der Bundesbank, als es die D-Mark noch gab, typischerweise negativ.
F: In der Diskussion erscheint es oft so, als würden die Zinsen der Sparer durch die EZB festgelegt. Können Sie mit einfachen Worten erklären, wie das Zinsniveau tatsächlich entsteht?
A: Makroökonomisch ist es so: Zinsen werden, wie jeder Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Das Angebot an Kapital ist sehr hoch, weil die Menschen sehr viel sparen, was auch mit der Demografie, der Alterung der Gesellschaft zu tun hat. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Kapital über die Jahre immer weiter zurückgegangen. Unter anderem, weil wir nicht mehr wie früher große Stahlwerke haben, wo riesige Summen investiert werden müssen. Wir haben heute viele Dienstleistungsunternehmen, die gar nicht mehr so auf den Bankensektor angewiesen sind, was Investitionen angeht. Das heißt, die Zentralbanken sind nicht dafür verantwortlich, dass die Zinsen so niedrig sind, sondern sie müssen in ihrer Geldpolitik versuchen, mit diesem neuen Umfeld klarzukommen. Deshalb sind die Einlagezinsen der Zentralbanken im Zeitablauf immer weiter gesunken. Die Zentralbanken sind Getriebene der globalen Marktentwicklung der ständig sinkenden Zinsen.
F: Vor dem Hintergrund, dass die abnehmende Kapitalnachfrage ein Faktor für die gesunkenen Zinsen ist, fordern Sie und viele andere Ökonomen schon länger höhere staatliche Investitionen und Schuldenaufnahme. In der Krise sind die Staatsschulden allerdings geradezu explodiert. Dennoch hat sich bei den Zinsen nichts getan.
A: Das ist richtig. Während der Corona-Krise wurden hohe neue Schulden aufgenommen. Die Zinsen haben -noch – nicht darauf reagiert, weil das erstmal eine einmalige Krisenreaktion war und weil die Zentralbanken diese neuen Schulden fast vollständig aufgekauft haben. Um eine Zinsreaktion sehen zu können, müsste diese Politik der höheren Neuverschuldung über einen längeren Zeitraum gemacht werden. In dem Moment würden die Märkte das auch realisieren und die Zinsen würden wieder auf ein etwas höheres Maß ansteigen. Dabei reden wir aber nicht über Zinsniveaus, wie wir sie aus den 60er- und 70er-Jahren kennen. Aber wenn der Staat wieder etwas mehr Geld investiert und sich über Neuverschuldung Kapital besorgt, würde das Zinsniveau wieder um ein paar Basispunkte ansteigen.
F: Verschiedene Politiker fordern schon länger, Minuszinsen für Verbraucher durch Banken einfach zu verbieten oder zumindest gesetzlich stark einzuschränken. Ist das aus Ihrer Sicht möglich und sinnvoll?
A: Möglich wäre das natürlich. Ich denke aber, man sollte damit anfangen, dass die Banken besser begründen, ob die Minuszinsen für ihre Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich mit den negativen Einlagezinsen bei der EZB zusammenhängen. Oder nutzen nicht viele Banken einfach das Zinsumfeld, um ein bisschen abzukassieren, obwohl eigentlich die Belastungen für sie selbst durch die negativen EZB-Einlagezinsen ziemlich gering sind?
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/In-der-Verfassung-steht-nichts-von-Sparern-article22663302.html
Jan Gänger: Kirchhof wittert Enteignung: Es gibt kein Recht auf Zinsen – n-tv, 5.7.2021
Die Europäische Zentralbank hat einen neuen Gegner: Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhof. Der Jurist hält die Negativzinspolitik für einen Verstoß gegen die Verfassung. Ökonomisch ergibt das allerdings keinen Sinn.
Das Geldvermögen der Deutschen ist gigantisch. In der Corona-Krise ist es auf einen Rekordwert geklettert, auf knapp 7 Billionen Euro schätzte die Bundesbank das Volumen Ende 2020. Tendenz: steigend. Der Löwenanteil steckt in Bankguthaben, Bargeld und Anleihen. Nur ein geringer Anteil ist in Aktien investiert.
So ungleich das Vermögen verteilt ist und auch wenn viele Deutsche gar kein Geld zurücklegen (können): Die Empörung über Strafzinsen bei Banken – dort gerne als „Verwahrentgelt“ bezeichnet – ist hierzulande groß. Und so trifft der Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhof einen Nerv, wenn er Negativzinsen in einem Gutachten als verfassungswidrig bezeichnet und in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank eine „Enteignung der Sparer“ sieht. In Deutschland ist die Vorstellung tatsächlich weit verbreitet, es gebe für Sparer einen Anspruch auf Zinsen. Ökonomisch ist das zwar Unsinn, menschlich allerdings verständlich.
Dem Vergleichsportal Verivox zufolge verlangen derzeit 349 Banken Negativzinsen von Privatkunden – fast doppelt so viele wie noch Ende 2020. Und nun kündigte auch die drittgrößte deutsche Bank ING an, künftig ab einem Freibetrag von 50.000 Euro einen Negativzins zu verlangen.
Der Hintergrund: Seit Jahrzehnten gehen die Realzinsen – also die Zinsen unter Berücksichtigung der Inflation – weltweit tendenziell zurück. Über die Gründe sind sich Ökonomen uneins. Die Finanzkrise hat diesen Trend noch verschärft, da die großen Zentralbanken mit ultra-lockerer Geldpolitik auf den Konjunktureinbruch reagierten. Zinsen sind der Preis des Geldes, und der richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Je weniger Haushalte konsumieren und je weniger Unternehmen und Staat investieren, umso niedriger werden die Zinsen.
*** Wohin mit dem Geld? ***
Die Negativzinsen sind ein Ergebnis davon, dass zu viel gespart und zu wenig investiert wird. Deutschlands Banken werden mit Spareinlagen regelrecht geflutet – sie wissen nicht, wohin damit. Derweil verlangt die EZB von den Banken Strafzinsen, wenn sie das Geld bei der Zentralbank parken. Und diese Kosten reichen immer mehr von ihnen an ihre Kundschaft weiter.
Schuld an den niedrigen Zinsen ist allerdings nicht die EZB. Sie reagiert auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld, das sich nur begrenzt von der Geldpolitik beeinflussen lässt. Das ändert aber nichts daran, dass sie von Bankenlobby und Politik für niedrige Zinsen kritisiert wird.
Dabei ist niemand gezwungen, sich von dem Zinsniveau bestrafen zu lassen. Wer viel Geld auf dem Konto liegen hat, kann einen Teil davon beispielsweise in Aktien stecken. Langfristig lässt sich an der Börse schon seit Langem mehr Rendite erzielen als die Zinsen, die Banken für Sparbücher und Festgeld anbieten. Das in Deutschland so beliebte Sparbuch war schon immer eine schlechte Investition.
Das bedeutet nicht, dass Sparer jetzt all ihr Geld in den Aktienmarkt stecken sollten. Doch es dürfte sich lohnen, dort langfristig und breit gestreut zu investieren – beispielsweise durch Sparpläne in Indexfonds.
Ein Problem ist, dass Aktien hierzulande keinen besonders guten Ruf haben. Vielen Kleinanlegern dürfte etwa das Debakel um die T-Aktie in den Knochen stecken, für die Manfred Krug eifrig die Werbetrommel gerührt hatte. Dass Bankberater vor der Finanzkrise ihren Kunden komplexe, hochriskante und plötzlich wertlose Finanzprodukte aufgeschwatzt haben, hat für einen nachhaltigen Vertrauensverlust gesorgt. Und dann sind da noch die Crashs an den Börsen: Dotcom-Blase, Lehman-Zusammenbruch oder Corona-Absturz halten Sparer vom Aktienmarkt fern – unabhängig davon, dass sich die Börsen immer wieder von Einbrüchen erholt haben.
Unabhängig, wie man zum Investieren an der Börse steht: Nennenswerte Zinsen für auf Konten geparkte Ersparnisse wird es auf absehbare Zeit nicht geben – egal, was Kirchhof davon hält.
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Es-gibt-kein-Recht-auf-Zinsen-article22662762.html
Oliver Picek: Neue Chefs von IHS und Wifo: Wirtschaftsliberale an den Schaltstellen – Die einseitige Besetzungspolitik birgt die Gefahr, dass ihre wirtschaftspolitischen Ratschläge zu einhellig, ja gar undurchdacht werden. Eine Einladung zum produktiven Disput – KOMMENTAR DER ANDEREN / Der Standard, 6.7.2021
Bisher galten die Chefs von IHS und Wifo als „sakrosankt“, künftig werde man genauer hinschauen müssen, sagt Oliver Picek, der Chefökonom des sozialliberalen Momentum-Instituts.
Der Coup ist gelungen. Österreichs Wirtschaftsforschung wird marktliberal – zumindest die Spitzen der zwei wichtigsten Institutionen im Lande. Mit der Berufung des Ökonomen und CDU-Beraters Lars Feld an die Spitze des Instituts für höhere Studien (IHS) werden ab Herbst die beiden großen Wirtschaftsforschungsinstitute von überzeugten und meinungsstarken Marktliberalen geführt. Schon zuvor ist bekannt geworden, dass Gabriel Felbermayr Wifo-Chef wird. Beide sind exzellente Wissenschafter, doch beide kommen mit weltanschaulich ähnlicher Schlagseite. Der eine gilt in deutschen Medien als „Streiter für den Markt“, der andere als „jemand, der für den Markt einsteht“.
Die beiden Männer werden künftig die Regierung beraten und politische Maßnahmen beurteilen – aus einer wirtschaftsfreundlichen, liberalen Perspektive. Im Tandem kann man sich ihre Ratschläge leicht vorstellen: niedrigere Gewinnsteuern für Unternehmen und deren Eigentümer und Eigentümerinnen, obwohl das das teuerste und ineffektivste Mittel ist, um Investitionen anzukurbeln. Das Pensionsantrittsalter erhöhen, obwohl sich die Alterung auch anders bewältigen ließe. Staatsschulden abbauen, aber keinesfalls die Steuern erhöhen – womit sich als Konsequenz ein Abbau der Sozialausgaben ergibt. Den Staat zurückdrängen, obwohl es keinen wissenschaftlich belegten Zusammenhang zwischen Staatsquote und Wirtschaftswachstum gibt. Vermögensteuern für eine Lastenverteilung der Corona-Krise bleiben tabu, obwohl vermögensbezogene Steuern in Österreich sehr niedrig sind.
*** Zu ähnliche Sicht ***
Nicht zufällig überschneiden sich fast alle dieser Einschätzungen mit jenen industrienaher Denkfabriken. Es handelt sich naturgemäß um weltanschaulich geprägte Ansichten, weil die Wirtschaftswissenschaft die meisten dieser Fragen bei weitem nicht so eindeutig beantworten kann, wie ihre wortgewaltigen Vertreter und Vertreterinnen vorgeben.
Wie stark die Berührungspunkte beider Volkswirte mit Unternehmenseinheiten waren, zeigt ein Blick auf die Lebensläufe: Feld fungierte als wissenschaftlicher Beiratsvorsitzender der von reichen Spendern und einigen Konzernen finanzierten Agenda Austria und sitzt im Wirtschaftsrat der CDU. Felbermayr sitzt dem Beirat von Eco Austria vor, einem Wirtschaftsforschungsinstitut, das die Industriellenvereinigung aus der Taufe hob, als die IV das renommierte Wifo über Nacht als zu „linkslastig“ bezeichnet und ihm die Zuschüsse gestrichen hat. Nimmt man die Besetzungen in der Nationalbank hinzu – eine Ökonomin von Raiffeisen als Chefökonomin, ein streng Konservativer als Gouverneur, dann denken bald alle, die in Österreich am Tisch sitzen dürfen, ähnlich. Zu ähnlich.
*** Beispiel Finanzkrise ***
Das ist problematisch, denn große Herausforderungen warten. Wie die Corona-Krise bezahlen? Wie die Klimakrise wirklich angehen? Wie verhindern, dass Reiche immer reicher werden und so die Demokratie aushebeln? Für Antworten auf diese Fragen braucht es eine kontroverse, aber produktive Diskussion der Fakten und deren Interpretation. So lassen sich vorgefasste Meinungen hinterfragen. So erreicht man die besten Lösungen.
Eine einseitige Besetzungspolitik der Chefsessel birgt die Gefahr, dass die wirtschaftspolitischen Ratschläge zu einhellig und damit undurchdacht werden. Schon in der Finanzkrise, der letzten großen Wirtschaftskrise vor Corona, hat sich dieser „group think“ katastrophal ausgewirkt. Die dominante Meinung in der Ökonomie war, dass Märkte – und vor allem Finanzmärkte – reibungslos funktionieren. Andersdenkende wurden ignoriert, bis es zum Crash kam, der bis heute nachteilige ökonomische Folgen verursacht. Die Volkswirtschaft als Wissenschaft hat daraus gelernt, die Spitze der Forschung hat den Status neu bewertet und ihren Glauben an unregulierte Märkte großteils aufgegeben. Ausgerechnet zu einer Zeit, als sich die internationale Forschung weiterentwickelt, kommt es in Österreich nun zum Siegeszug des Wirtschaftsliberalismus.
*** Pause für Neoliberale ***
Dabei verkündete Vizekanzler Werner Kogler unlängst noch eine „Sendepause für Neoliberale“. Die Pause, wenn es sie denn gab, dauerte nur kurz. Lauter als je zuvor werden wir auf allen Kanälen beschallt. Eine Erkenntnis der Sozialpsychologie ist, dass Menschen Meinungen umso eher glauben, je öfter sie diese gehört haben – unabhängig davon, ob sie die Aussage für richtig oder falsch halten. Im antiken Rom wusste das schon Cato, der jede seiner Reden mit dem gleichen Satz beendete (der Feind, Karthago, müsse zerstört werden).
Dass man nun aber vorsichtiger bei der Einordnung der Top-Experten und Top-Expertinnen in der Wirtschaftsberatung werden muss, ist für Österreich neu. Bisher galten die Chefs von IHS und Wifo als „sakrosankt“, als unabhängige, scheinbar neutrale Einordner von Wirtschaft und Politik. Das war schon bisher falsch. Die Wissenschaftstheorie erklärt uns, dass pure Objektivität oder Neutralität unmöglich ist, dass die Interpretation wissenschaftlicher Ergebnisse mit einer vorgefassten theoretischen Brille erfolgt. Tragen alle die gleiche rosa Brille, sieht die Welt nur noch einfärbig aus. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Rezepten der einflussreichen Institutschefs war daher immer angebracht. Mit den jetzigen Jobbesetzungen aber mehr denn je.
OLIVER PICEK ist Chefökonom der sozialliberalen Denkfabrik Momentum-Institut in Wien.
QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000127968674/neue-chefs-von-ihs-und-wifo-wirtschaftsliberale-an-den-schaltstellen