Views: 109
Die zurückliegende Woche war mehr als reichlich mit Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.
Schon wie letzte Woche hier vermerkt:
FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie letzte Woche ebenso – summa summarum nur zu vermerken, dass sich die Wirtschaft weltweit zwar weiter belebt hat, wenn auch nicht mehr mit Riesenschritten wie in der letzten Zeit, eher mit leichten Eintrübungen da und dort – ebenso steigt allerdings auch die Inflation wegen der deutlich zunehmenden Rohstoff- und Energiepreise. Die vermehrte Geldentwertung sei, so die EZB, nur ein vorübergehendes, kein bleibendes Phänomen. Die gestörten Lieferketten sorgen für reichlichen Preisauftrieb. SENTIX sieht keine Sommerhausse an den Finanzmärkten kommen, eher das Gegenteil dürfte der Fall sein. Gold und Silber glänzen weiterhin.
IN DEN VORDERGRUND schoben sich u.a. die Wirtschaftsprognosen für Deutschland, abermals die Nachrichten zu den diversen Zentralbanken, Einzelnes zur NextGeneration-Anleihe.
BEACHTENSWERT AUCH Studien zu den Befindlichkeiten junger Menschen.
ÜBERSICHT
- INTERNATIONAL
- Rohstoffe Superzyklus bei den Rohstoffen – Steigende Rohstoffpreise treiben die Inflation und belasten große Teile der Weltwirtschaft. Doch es gibt auch Profiteure dieser Entwicklung
- Weltweites Vermögens-Ranking: Private Vermögen erreichen zusammen Rekordwert von 250 Billionen US-Dollar: weltweit machte die Pandemie Menschen reicher gemacht – Superreiche vermehren sich wie nichts: 60.000 Menschen auf der Welt mit mehr als 100 Mio US-Dollar – Nach den USA und China liegt Deutschland mit 2.900 Superreichen auf Platz drei
BÖRSEN - SENTIX-Sentimente: schwache Nachverfalls-Woche. Mit Blick auf jahrelange Beobachtungen lässt „finale Stärkephase“ bis Ende Juli wahrscheinlich erscheinen. Aber: Profils verlieren an Grundvertrauen in Aktien; Gold verschnauft zunächst, setzt dann Aufschwung fort.
- Commerzbank sieht Gefahr einer Finanzblase im Euroraum – Immobilienmarkt betroffen – Finanzstabilität: EZB setzt makroprudenzielle Instrumente gegen Finanzblasen ungenügend ein – EZB sieht keine Immobilienblase – Inflation unter Zielgröße: notwendiger Schritt gegen Finanzblasen für EZB-Rat zu groß
- Wall Street: 500 Milliarden Dollar: US-Konzerne steigern Aktienrückkäufe auf neuen Rekord – Die Unternehmen geben 2021 so viel für den Erwerb eigener Aktien aus wie nie zuvor. Das treibt die Börsenkurse – lässt aber die Schulden steigen
- Die Reddit-Trader kommen! – Auch in deutschen Internet-Foren werden jetzt Penny-Aktien hochgejubelt. Der Schweizer Markt wird verschont, bis jetzt
ZENTRALBANKEN - – JAPAN
BoJ hält an lockerer Geldpolitik fest – Neues Kreditprogramm, neue Kreditfazilität, denn: Klimawandel mit langfristig „extrem große[m] Einfluss“ auf Wirtschaft, Preise und finanziellen Bedingungen – Pandemie-Folgen: Programm mit zinslosen Krediten bis März 2022 verlängert – Zielrendite für 10-jährige Anleihen weiter bei 0 Prozent, ebenso weiter der Einlagenzins von minus 0,10 Prozent – BoJ bestätigt Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) - – SCHWEIZ
Der Chart des Tages: Nationalbank: kein Wort zu viel zum Franken - – EUROPÄISCHE UNION
EZB: Analysten zu Leitzinsen und Anleihekaufprogrammen (APP): 2024e erste Anhebung des Einlagenzinses, 2025e positiver Zinssatz – PEPP: kein volle Ausschöpfung der eingeräumten 1,85 Billonen Euro, Nettokäufe im März 2022 beeindet - Minderung des Tier-1-Kapital um 70 Milliarden Euro für 39 Banken – EZB verlängert Sonderregelung für Anwendung der Leverage Ratio – Anforderung einer Leverage Ratio von 3 Prozent ab 28. Juni
- EZB/Lane: Höhere Haushaltsdefizite nicht besorgniserregend – Im Vergleich zu vergangenen Schuldenepisoden stehen dieses Mal hohe inländische Privatvermögen den Staatsschulden gegenüber – Nettoauslandsschulden bleiben niedrig – Eine Art Inlandsverschuldung: Künftige Ausgaben öffentlicher Hände werden aus NExtGeneration-Anleihe bezahlt werden, nicht aus nationalen Staatshaushalten
- EZB/Schnabel: Marktneutralität durch Markteffizienz ersetzen, um Klimaschutzbelange zu unterstützen – CO2-produzierende Unternehmen nehmen Anleihemarkt stärker in Anspruch – Regulierung möglich: Ausschluss COS-intensiver Anleihen oder langsame Anpassungen der Geldpolitik (Tilting) – Tilting als komplizierter Weg: enger Markt für „grüne“ Anleihen lässt einschleichende Strategie mit Umgang CO2-intensiver Anleihen geraten sein
- Lagarde: Trotz Kompletter Erholung des BIP 2022Q1e: Beendigung PEPP Ende März 2022 keine ausgemachte Sache
- Derzeit verfrühte Diskussion um PEPP-Ausstieg: EZB/Lane dämpft Erwartungen für Ratssitzung im September – Datengrundlage für Entscheidungen möglicherweise im September noch nicht vorhanden – Eingeplantes PEPP-Volumen von 1,85 Billionen Euro wird womöglich nicht ausgeschöpft werden
- Abkehr von Krisenhilfen: EZB-Ratsmitglied Olli Rehn: Im September wird diskutiert – Im Fokus das umfangreiche Anleihe-Kaufprogramm PEPP – Auch in 2021Q3 umfangreiche Anleihekäufe
- Lagarde: EZB am Wochenende vom 19./20.6. bei Strategiediskussion gut vorangekommen – Im Vorfeld geplanter Strategieüberprüpfung: vertiefte informelle Diskussionen über die künftige geldpolitische Strategie – Themen: Definition und Messung von Preisstabilität und ihr zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation
- COMMENT: Als wunderschöne gediegene und abgelegene Treffpunkte…
- Lagarde: Häufigere EZB-Strategieprüfungen mit Amtszeit der Präsidentschaft abstimmen – Lagarde stellt Periode von fünf Jahren in Frage: Strategieüberprüfung grundlegend, daher nicht zu häufig durchführen
- EZB/Panetta: Bargeldnachfrage steigt trotz sinkender Barzahlungen – Private sichern sich in Krisensituationen ab: Banknoten gefragt – Umfrage: Mitte 2020 nutzten 40 Prozent Bargeld seltener
- Enria/Bankenaufsicht: EZB berät am 23. Juli über Ausschüttungsverbot – Empfehlung zum Dividendenausschüttungs- und Aktienrückkaufsstopp wurde von den meisten Banken eingehalten – Verbot soll „kein permanentes Instrument im Werkzeugkasten“ der Bankenaufsicht werden
- EZB-Vorschlag: Großbanken müssen Vorstandssitze mit Frauen besetzen zur Hebung der Effektivität der Unternehmensführung – Nur 8 Prozent der Vorstandsvorsitzenden europäischer Kredit- und Investmentinstitute Frauen – Nur ein Fünftel der Positionen in den Führungsgremien der größten europäischen Banken von Frauen besetzt – Unterschiedliche Gleichstellungsgesetze in den europäischen Ländern als Hürde
- – DEUTSCHLAND
Coronakrise – Für den Fall des Notfallendes: Weidmann fordert baldiges Ende der Krisen-Hilfen – Bedingung: gefestigte Wirtschaftserholung – Älteres APP-Programm nicht zum Abferdern eines auslaufenden PEPP-Programmes heranziehen – Keine Einstimmigkeit im EZB-Rat bezüglich PEPP: Weidmann bedauert beschleunigtes Aufkaufprogramm im nächsten Quartal - Bundesbank: Basel 3 hebt Eigenkapitalanforderungen deutscher Banken um 8% – Für größere Banken Anhebung um 22 Prozent – Basel 3 noch nicht in EU-Recht gegossen – Regulatorische Entlastung kleiner Banken bei konstanten Anforderungen an deren Kapital- oder Liquiditätsausstattung
- Wuermeling: Deutsche Banken konnten Negativzins 2020 mindestens kompensieren dank Konditionsanpassungen im Einlagengeschäft – Weitergabe von Negativzinsen und andere Zinsanpassungen
- Höhepunkt kommt erst: Deutsche Banken derzeit mit weniger notleidenden Krediten als erwartet – Statt erwarteten 45 Milliarden Euro nur 33 Milliarden Euro – Zeitverzögerte Krise: Volumen der notleidenden Kredite für 2022 bei 47 Milliarden Euro erwartet – Ausfallswahrscheinlichkeiten werden zu gering eingeschätzt
USA - Astrid Dörner: „Es könnte sich herausstellen, dass die Inflation höher ist und länger anhält, als wir erwarten.“: US-Notenbank-Chef Jerome Powell stellt zwei Zinsschritte bis Ende 2023 in Aussicht und erwartet höhere Inflation – Die US-Notenbank lässt ihren Leitzins unverändert, bereitet die Märkte aber auf eine Abkehr der ultralockeren Geldpolitik vor. Fed-Chef Powell schraubt zudem die Inflationserwartung nach oben – Unicredit-Experten: gefühlte Inflation liegt bei 4,1 Prozent
- Höchstpreise schrecken Käufer: ab US-Holzpreis bricht in Rekordtempo ein
- Stärkster Zuwachs seit 2010: Erzeugerpreise steigen im Vorjahresvergleich deutlich um +6,6 Prozent – stärkster Zuwachs seit Erhebungsbeginn – Inflationserwartungen werden angeheizt
- Frühindikatoren des Conference Board steigen wie erwartet – Zusammengesetzter Indikator stieg bereits im April
- Philly-Fed-Index im Juni wenig verändert, aber Subindex für Auftragseingang bildet sich schwächer, Beschäftigungssubindex stärker ab
- New Yorker Konjunkturindex fällt im Juni stärker als erwartet – Indices für Ordereingang und Beschäftigung sanken
- US-Industrieproduktion im Mai auf Monatssicht um +0,8 Prozent gestiegen – Basiseffekt: Anstieg im Jhresvergleich um +16,3 Prozent – Starker Anstieg auch für die Produktion im verarbeitenden Gewerbe: Vormonatsplus 0,9 Prozent, Jahresplus 18,3 Prozent
- Der Chart des Tages – US-Einzelhandel deutlich über dem langjährigen Trend: annualisiertes Wachstum für die vergangenen zwei Jahre bei 10 Prozent
- Umsätze der US-Einzelhändler im Mai schwächer als erwartet – Lieferkettenstörungen als Ursache
- Baugenehmigungen und -beginne enttäuschen, wenig Zunahem bei neu begonnenen Wohnungsbauten – Expertenerwartungen wurden für beide Parameter enttäuscht
- Nach Revision für die Vorwoche nach unten: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen wider Erwarten – Negligeable Erhöhung der Zahl der Arbeitslosenempfänger
CHINA - Der Chart des Tages – Kein Platz für Jeans: Container-Frachtkosten steigen rapide – Ungeliebte Inflation wird in witer Jahreshälte Thema bleiben
- Corona ist nicht unser einziges Problem: Containerhafen Yantian, einer der umtriebigsten Häfen der Welt, liegt Corona-bedingt lahm
- China: Einzelhandel und Industrie entwickeln sich schwächer als erwartet
- Chinesische Direktinvestitionen in Europa fallen 2020 auf 10-Jahres-Tief – Befürchtung des Unternehmens-Aufkaufs durch China nicht eingetreten – Trotz attraktiven Industriestandorts: Pandemiefolgen, chinesische Kapitalabluss-Hemmnisse, europäische Restriktionen hemmen chinesische Investitionen – Deutschland von China vor allen anderen bevorzugt – EU-China-Streitereien könnten chinesische Investitionsneigungen künftig vermehrt stören
GROSSBRITANNIEN - Virulente Delta-Variante bedingt höchsten Tageswert an Corona-Neuinfektionen seit Februar – Hohe bekannte Inzidenz und gleich hoch eingeschätzte Dunkelziffer dafür – Geplantes Restriktionsende auf 19. Juli verschoben – Beschleunigtes Impfprogramm geplant
Großbritannien: Einzelhändler verlieren im Mai überraschend an Umsatz – Hintergrund: Lockerungen bedingen vermehrte Bar- und Restaurant-Besuche, Lebensmittelhandel verliert nach kräftigem Anstieg im April deutlich – Einzelhändler-Umsatz insgesamt steigt dank Basiseffekt um 25 Prozent – Online-Umsätze überwiegen
SCHWEIZ - Starker Aufschwung: Die Schweizer Wirtschaft hat das Vorkrisenniveau wieder erreicht – Experten: erst 2022 wird Wirtschaft den Vor-Corona-Pfad wieder vollständig aufgenommen haben – Lockerungsschritte beflügeln
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Coronakrise mit neuem Fragezeichen: Ausbreiten der Delta-Variante soll auch Thema bei EU-Gipfel sein – EU-Beziehung zu Russland und Türkei – Diskurs im inklusiven Gipfel-Format: Fortschritte im Bereich Banken und Kapitalmarktunion
- Neueste Entwicklung betreffend Emission der NextGenerationEU -Anleihe (NGEU): EU lässt mehrere Banken wieder zu Anleiheemissionen zu – Liste der entlasteten Banken: JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Nomura, Unicredit und Credit Agricole – Mit Geldstrafen sanktionierte Banken
- COMMENT: Sanktionen und Restriktionen hin oder her. …
- Emission der NextGenerationEU-Anleihe (NGEU) im Volumen von 20 Milliarden Euro: EU schloss mehrere Großbanken von Anleiheemissionen aus – Betroffen sind u.a.: Barclays, JP Morgan, Nomura, Unicredit, Bank of America, Citigroup und Credit Agricole
- Finanzminister der Europäischen Union (EU) blicken auf Freitag: Deutsches Finanzministerium sieht EU-Aufbaufonds gut im Zeitplan – 23 Länder haben ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne bereits vorgelegt – Im Fokus: wirtschaftliche Erholung in Europa, Umsetzung des EU-Wiederaufbauplanes, Stärkung der Banken-Union, Vorbereitung des 20G-Treffens Mitte Juli u.a. – Globale Mindessteuer im Blick – Kreise
- Inflation im Euroraum steigt im Mai auf 2,0 Prozent auf Jahressicht – Jahres-Kernteuerung von 0,7 Prozent auf 1,0 Prozent angestiegen
- Industrie in der Eurozone im April stärker erholt als erwartet
- Keine Inflation in Sicht: Wachstum der Euroraum-Arbeitskosten verlangsamt sich stark – Niedrige Lohnnebenkosten durch Steuererleichterungen und staatliche Subventionen bedingt
- Nach drei Jahren währenden Rückgängen: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im April – Handels- und Kapitalbilanz jeweils mit positivem Saldo – Kapitalbilanz gespalten: Plus bei Direktinvestitionen, Minus bei Portfolioinvestitionen in Form von Aktien und Anleihen
- Jahrelanger Handelsstreit beendet: USA und EU setzen Boeing-Airbus-Streit aus – Strafzölle werden für fünf Jahre ausgesetzt
- EU und USA vor Einigung im Boeing-Airbus-Handelsstreit – Kreise
FRANKREICH - Frankreich: Inflation steigt auf höchsten Stand seit Ende 2018
ITALIEN - Italien / HVPI: Inflation stabil bei 1,2 Prozent – Geldentwertung nimmt im Monatsvergleich leicht ab
- Italiens erloschene Leidenschaft für China
DEUTSCHLAND – FRANKREICH - Merkel und Macron im Gespräch über Rückkehr zum Stabilitätspakt in nächsten Jahren – Rückkehr zur bis 2023 ausgesetzten Defizitregel „erst in Jahren“ – Merkel: „Vor-Pandemieniveau wirtschaftlich zu erreichen, möglichst schnell.“ – Macron: Wachstum und Jobs an erster Stelle
- Deutsche HVPI-Inflation steigt im Mai deutlich auf 2,4 Prozent – Nationale Inflationsrate steigt um 0,5% auf 2,5 Prozent – Energieprodukte und CO2-Abgabe als Treiber
DEUTSCHLAND - Nach vorausgelaufenen stärkeren Zuwächsen im Mai höchster Zuwachs seit Herbst 2008: Erzeugerpreise steigen im Jahresvergleich weiter auf 7,2 Prozent – Experten-Erwartungen für Mai übertroffen – Wegen Lieferkettenproblemem: Vorleistungsgüter mit deutlichen Preisanstiegen – Massiv im Aufwind recycelte Metalle und Schrott – Holz und Stahl steigen auf Jahressicht um ein Drittel – Energiepreise
- Treibhausgasneutralität bis 2045 Klimaschutz als Miet-Preistreiber gefürchtet – Die angestrebte Klimaneutralität beinhaltet verschärfte Vorgaben für Gebäude
- Auftragsbestand der deutschen Industrie im April auf Rekordwert
- DIW hebt deutsche Wachstumsprognose leicht an: 2021e +3,2 Prozent, 2022e +4,3 Prozent – Immer Mehr Menschen geimpft und sinkende Indizdenzen sorgen für beginnende Wirtschaftsnormalisierung – Langer Weg zur Erholung: Pandemie könnte dennoch für Rückschläge sorgen
- IfW: Selbsttragender Aufschwung in Deutschland mit 2021e + 3,9 Prozente, 2022e +4,8 Prozent – Preissteigernde Produktionshemmnisse bremsen Aufschwung – Gute Auftragslage gedämpft durch Lieferengpässe – Aufgestaute Kaufkraft treibt Wirtschaft, aber auch Preise an – Unterjährige Teuerung bis zu 4 Prozent möglich, im Gesamtjahr milder mit 2021e + 2,6 Prozent, 2021e +1,9 Prozent
- RWI: Deutsche Konjunktur nimmt wieder Fahrt auf: Wachstum 2021e+3,7 Prozent, 2022e +4,7 Prozent – Gering sinkende Arbeitslosenquote von 2021e 5,8 Prozent auf 2022e 5,7 Prozent – Relativ „schwache“ Inflation erwartet: 2021e 2,5 Prozent, 2022e 1,9 Prozent – Öffentliche Haushalte fallen von 160 Mrd 2020e auf 68 Mrd 2021e – Lieferengpässe bremsen, Dienstleistungserholung beflügelt – Erfolgreiche Pandemiebekämpfung als Erholungsfaktor – Zunahme der Konsumnachfrage bereits in 2021Q2e
- IMK: Wirtschaftsboom fast 20 Mal wahrscheinlicher als Rezession – Prognose: Konjunkturaufschwung nimmt mit zunehmender Durchimpfungsrate an Breite und Stärke zu – Hoher Nachfragerückstau der Privathaushalte
- Ifo senkt deutsche BIP-Prognose 2021 von 3,7 Prozent auf 3,3 Prozent ab – Prognoseanhebung für 2022 um 1,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent – Inflation 2021e +2,6 Prozent, 2022e auf 1,9 Prozent – Boom bei Konsumausgaben für 2022e mit +7,2 Prozent – Ausrüstungsinvestitionen hoch im Kurs mit +8,6 Prozent, 2022e +6,8 Prozent – Sinkende Arbeitslosenquoten: 2021e +5,8 Prozenht, 2022e +5,2 Prozent – Lockere Geldpolitik wird vorerst bleiben – Öffentlicher Haushalt mit grö0erem Finanzierungsloch 2021e von 150,4 Mrd. Euro (2020: 149,2 Mrd Euro), das 2022e stark auf 49,6 Mrd zusammenschrumpft – 2021e+2022e: Exporte-Zuwächse +10,4 und +5,6 Prozent, Importe +11,4 Prozent und +7,3 Prozent – Unter kritscher EU-Marke von 6 Prozent: deutscher Leistungsbilanzüberschuss sinkt von 231 über 206 auf 184 Milliarden Euro oder von 7,0 über 5,8 auf 4,9 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung
- IWH: Konjunkturaussichten im Sommer günstig – BIP 2021e +3,9 Prozent, 2022e + 4 Prozent – Lockerungen beflügeln insbesondere Dienstleistungsbranchen – Privatkonsum dürfte in kommenden Monaten stark anziehen – Ausrüstungsnvestitionen im Aufwind – Leferkettenprobleme als Bremse – Restrisiko: neuerliche Pandemie-Restriktionen
Deutscher Einzelhandelsumsatz für April nach unten revidiert – Umsatzplus von 7,2 Prozent auf Jahressicht - Bundesnotbremse lässt deutschen Gastgewerbeumsatz im April sinken – Fast minus 70% geringerer Umsatz im Vergleich zum Februar 2020 – Hotel, Beherbungsbetriebe, Gastronomie und Caterer litten nach schwacher Belebung im März weiter – April: auch Produktion und Einzelhandel insgesamt sanken, geringer Exportanstieg
- Nach außerordentlich starkem März: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschand fällt im April stark
- Deutsche Industrie besorgt über chinesisches Gesetz gegen Sanktionen – EU-China-Investitionsabkommens liegt derzeit auf Eis
- Ifo gegen Rückverlagerung von Produktion nach Deutschland, gegen staatliche Eingriffe in Lieferketten – Alternative: Bezugsquellen international diversifizieren, Vertiefung des EU-Binnenmarktes, Stärkung der WHO – Offene Weltmärkte garantieren deutschen Wirtschaftserfolg – Export der deutschen Wertschöpfung ins Ausland hoch – Aufbau strategischer Reserven erhöhen Versorugungssicherheit – Integrationspotenzial bei grenzüberschreitendem Warenverkehr opimaler gestalten – Schaffung eines vollständig integrierten europäischen Marktes für digitale Leistungen bedeutsam
- Tourismus: „Wir schaffen es kaum“ Urlauber überrennen Tui
- 27 Prozent weniger als 2020 Deutsche Rüstungsexporte stark gesunken
- Bestellboom in der Corona-Krise: 63 Pakete pro Haushalt im Pandemiejahr
- Ifo-Präsident Fuest warnt vor Vermögensteuer – Abschreckung von Investoren im In- und Ausland zugunsten eines Umverteilungseffektes zu sehr hohem Preis
- Studie zu Geld und Sozialneid : Nur jeder vierte Deutsche will reich sein
ÖSTERREICH
*Baukosten im Mai 2021 weiter gestiegen - Sommerurlaubsreisen 2019-2021: Urlaub in Österreich und Italien beliebt
- Inflation steigt im Mai 2021 auf 2,8%
- IWF: Laut IWF braucht Österreich kein Sparpaket aber eine CO2-Steuer – CO2-Steuer als wichtigste Strukturmaßnahme für Österreichs Wirtschaft – Digitalisierung zweites Mega-Thema – Normalisierung des Staatshaushalts dank Wirtschaftserholung: Verschuldung von 80% BIP-Anteil wird sich in wenigen Jahren selbst reguliert haben – Eigenkapitalbildung unterstützen – OeNB-Chef Holzmann: Maastricht-Kriterien erreichbar durch „Spare in der Not, so hast du in der Zeit“ [sic!, richtig: Spare in der Zeit, so hast du in der Not]
- IMF – Austria: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission
- Plus 10,5 % zum Vorjahr Holz, Sprit, Kunststoff, Stahl als Treiber: Baukosten legen massiv zu – Statistik Austria meldet Anstieg von 10,5 Prozent gegenüber dem ersten Coronakrisen-Mai 2020 und Zuwachs von 3,6 Prozent gegenüber dem Vormonat April
- Mit Digitalisierung und Dekarbonisierung aus der Krise. WIFO-Studie im Auftrag der OeNB beleuchtet wirtschaftspolitische Hebel zur Forcierung von Investitionen
- Nur 44 Prozent der Österreicher wollen im Sommer verreisen – Die Mehrheit davon will laut einer Umfrage der Statistik Austria im Inland urlauben
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Andreas Breitenfellner, Thomas Zörner: Entwarnung: Die EZB ist weiter auf Kurs – Preisstabilität bleibt im Fokus der Zentralbank, die sich gerade deshalb um die geänderten Rahmenbedingungen durch den Klimawandel sorgt
INTERNATIONAL
Rohstoffe Superzyklus bei den Rohstoffen – Steigende Rohstoffpreise treiben die Inflation und belasten große Teile der Weltwirtschaft. Doch es gibt auch Profiteure dieser Entwicklung – CORONA SPEZIAL MORNING BRIEFING HANDELSBLATT / HANDELSBLATT, 13./14.6.2021
Der Anstieg der Rohstoffpreise hilft manchen Ländern dabei, die Coronakrise schneller zu verkraften als zuerst befürchtet. Indonesien etwa meldete im April Exporte im Wert von 18 Milliarden Dollar – ein Anstieg von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kein anderes Land exportiert so viel Kraftwerkskohle wie Indonesien. Rohstoffexperten sehen die Entwicklung als Teil eines weit größeren Trends. Sie sprechen von einem „Superzyklus“, einem viele Jahre dauernden und viele Rohstoffe umfassenden Anstieg der Preise, die deutlich über dem langfristigen Trend liegen. „Vor allem ärmere, rohstoffexportierende Länder profitieren vom Superzyklus, was ihnen auch helfen wird, ihre Schulden zu bedienen“, sagt DIW-Chef Marcel Fratzscher. Seit Jahresbeginn stiegen die Preise von Kupfer um 28 Prozent, Eisenerz um 30 Prozent und Lithium um 46 Prozent.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/politik/international/rohstoffe-superzyklus-bei-den-rohstoffen-diese-laender-sind-die-grossen-gewinner/27268004.html
Weltweites Vermögens-Ranking: Private Vermögen erreichen zusammen Rekordwert von 250 Billionen US-Dollar: weltweit machte die Pandemie Menschen reicher gemacht – Superreiche vermehren sich wie nichts: 60.000 Menschen auf der Welt mit mehr als 100 Mio US-Dollar – Nach den USA und China liegt Deutschland mit 2.900 Superreichen auf Platz drei – Business Insider, 14.6.2021
Laut einer Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat das Corona-Krisenjahr 2020 die Menschen weltweit reicher gemacht.
Das Finanzvermögen steigt auf einen Rekordwert von 250 Billionen Dollar.
Vor allem der Club der Superreichen ist kräftig gewachsen. Weltweit haben rund 60.000 Menschen ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar.
Das Corona-Krisenjahr 2020 hat die Superreichen noch reicher gemacht. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Der Club der Superreichen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar wuchs demnach im Krisenjahr weltweit um 6.000 auf rund 60.000 Mitglieder. Diese besitzen den Angaben zufolge 15 Prozent des weltweit investierbaren Vermögens. Deutschland belegt dabei Platz drei im globalen Ranking — mit 2900 Superreichen. An der Spitze stehen die USA, gefolgt von China. Die USA führten auch insgesamt das weltweite Vermögens-Ranking an mit 136 Billionen Dollar, gefolgt von Asien ohne Japan (111,9 Billionen) und West-Europa (103 Billionen). Für die kommenden Jahre rechnet BCG angesichts der erwarteten Konjunkturerholung nach der Corona-Krise mit einem stetigen Wachstum des weltweiten Privatvermögens. Bis 2025 dürfte es um jährlich durchschnittlich knapp fünf Prozent auf dann 544 Billionen Dollar zulegen. Reicher werden der Prognose zufolge in der Summe vor allem Menschen in Nordamerika, Asien ohne Japan und Westeuropa.
*** Privatvermögen steigt auf Rekordwert ***
Aber nicht nur die Reichen haben in der Pandemie mehr Geld angehäuft. Das private Finanzvermögen aller Menschen stieg gegenüber dem Vorjahr um gut acht Prozent auf den Rekordwert von 250 Billionen Dollar – das entspricht rund 205 Billionen Euro. Dazu trugen steigende Börsenkurse und wachsende Ersparnisse bei.
Erstmals berücksichtigte BCG auch Sachwerte wie Grundbesitz oder Gold. Das Gesamtvermögen abzüglich Schulden belief sich so auf 431 Billionen Dollar. In Deutschland stieg das private Finanzvermögen unter anderem aus Bargeld, Kontoguthaben, Aktien, Pensionen und Lebensversicherungen den Angaben zufolge um rund sechs Prozent auf rund neun Billionen Dollar. Das Sachvermögen erhöhte sich um fünf Prozent auf 13 Billionen Dollar. Abzüglich der Schulden besaßen die privaten Haushalte in Deutschland insgesamt knapp 20 Billionen Dollar.
„Traditionell investieren die Deutschen lieber in Immobilien als in Wertpapiere, das zeigt die Sachwertquote von knapp 60 Prozent deutlich“, analysierte Anna Zakrzewski, BCG-Partnerin und Autorin der Studie. „Gleichzeitig sparen Anlegende in Deutschland überdurchschnittlich stark.“ Viele Menschen hielten in der Krise ihr Geld zusammen, zudem bremsten die zeitweisen Schließungen im Einzelhandel und Reisebeschränkungen den Konsum.
Die Zahl der Dollar-Millionäre hierzulande erhöhte sich den Angaben zufolge um 35.000 auf 542.000. Das Beratungsunternehmen führte den Anstieg auch auf die Entwicklung des Eurokurses zurück, der im Vergleich zum Dollar zugelegte. Das machte sich bei der Umrechnung in die US-Währung bemerkbar. Weltweit besaßen den Angaben zufolge 26,6 Millionen Menschen ein Finanzvermögen von einer Million Dollar und mehr, das waren 1,8 Millionen mehr als im Vorkrisenjahr.
QUELLE: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/weltweites-vermoegens-ranking-deutschland-hat-2900-superreiche-a/
BÖRSEN
SENTIX-Sentimente: Schwache Nachverfalls-Woche wahrscheinlich – SENTIX, 20.6.2021
Der Juni-Future-Verfall hat an den Aktienmärkten meist eine große Bedeutung. Die Anleger ziehen Halbjahresbilanz und sind aufgefordert, sich für das zweite Halbjahr und – noch wichtiger – für die oftmals volatilen Sommermonate zu positionieren. Die Woche nach dem Verfall ist meist von einer Kursschwäche begleitet bevor noch einmal eine finale Stärkephase bis Ende Juli folgt. Diesem Verlauf stehen die Sentimentdaten nicht unbedingt entgegen, wobei Volatilität ihre Schatten voraus wirft.
Weitere Ergebnisse: * Aktien: Profis verlieren an Grundvertrauen * Gold: Erst Stabilisierung, dann wieder Aufschwung
QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-25-2021.html
Hans Bentzien: Commerzbank sieht Gefahr einer Finanzblase im Euroraum – Immobilienmarkt betroffen – Finanzstabilität: EZB setzt makroprudenzielle Instrumente gegen Finanzblasen ungenügend ein – EZB sieht keine Immobilienblase – Inflation unter Zielgröße: notwendiger Schritt gegen Finanzblasen für EZB-Rat zu groß – DJN, 14.6.2021
Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert sieht die Gefahr einer Finanzblase im Euroraum. „Die aktualisierte Analyse des Finanzzyklus im Euroraum bestätigt, dass die Gefahr einer Blase am Immobilienmarkt im Euroraum immer mehr zunimmt“, schreibt Schubert in einer Analyse. Der Analyst verweist darauf, dass vor allem die realen Immobilienpreise – eine von drei aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) für die Bestimmung von Finanzzyklen wichtigen Messgrößen – im Euroraum seit 2015 ungebremst stiegen.
„Makroprudenzielle Instrumente, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) als effektive Maßnahme gegen Blasen an den Finanzmärkten angesehen werden, wurden offenbar bisher nicht ausreichend eingesetzt oder ihre Wirkung war nicht ausreichend“, schreibt Schubert. Dagegen könne die Geldpolitik offenbar einen erkennbaren Einfluss auf den Finanzzyklus ausüben, da der langfristige Zyklus der realen US-Immobilienpreise sich merklich abgeflacht hatte, nachdem die US-Notenbank ab 2015 zwischenzeitlich den Fuß vom Gaspedal genommen habe.
Die EZB räumt in ihren Finanzstabilitätsberichten eine Überbewertung in vielen Immobilienmärkten ein, sieht darin aber kein Stabilitätsrisiko, weil die steigenden Preise nicht mit einer zu starken Kreditvergabe einhergehen. Tatsächlich hält sich der Anstieg der beiden weiteren zyklischen Indikatoren – das Verhältnis von Krediten zur Wirtschaftsleistung und das Verhältnis von Krediten zur Inflationsrate – noch in Grenzen.
Schubert schlägt vor, dass die EZB bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen deren Wirkung auf die Finanzstabilität stärker berücksichtigen und eine Politik des „leaning against the wind“ betreiben solle. Das bedeutet: Die Geldpolitik aus Gründen der Finanzstabilität straffen, auch wenn das mit Blick auf die Inflationsentwicklung noch nicht notwendig wäre.
Schubert begrüßt daher den Vorschlag des französischen EZB-Ratsmitgliedes Francois Villeroy de Galhau, dass die EZB die derzeitige „monetäre Säule“ ihrer geldpolitischen Strategie zu einer „monetären und finanziellen Säule“ ausbauen sollte. Diese zweite Säule wäre für die vertiefte Erforschung des Finanzzyklus verantwortlich.
„Die EZB sollte im Rahmen dieser neuen Säule Variable wie die Verschuldung von Unternehmen und Haushalten, Informationen aus den Geschäftsbankbilanzen, Indikatoren für überzogene Risikotoleranz und exzessive Kredite sowie Aktien- und Hauspreise überwachen“, rät Schubert. Eine Gewähr dafür, dass sich die EZB künftig tatsächlich „gegen den Wind lehnt“, sähe Schubert darin aber nicht.
„Der eigentlich notwendige Schritt, gegen die Gefahr von Blasen an den Finanzmärkten auch dann vorzugehen, wenn in Boom-Phasen die Inflation noch unterhalb des EZB-Ziels liegt, dürfte für die meisten EZB-Ratsmitglieder viel zu groß ausfallen“, meint er.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53141829-commerzbank-sieht-gefahr-einer-finanzblase-im-euroraum-015.htm
Ulf Sommer: Wall Street: 500 Milliarden Dollar: US-Konzerne steigern Aktienrückkäufe auf neuen Rekord – Die Unternehmen geben 2021 so viel für den Erwerb eigener Aktien aus wie nie zuvor. Das treibt die Börsenkurse – lässt aber die Schulden steigen – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 15.6.2021
Weltweit sind die Börsen dank steigender Konzerngewinne und niedriger Zinsen auf Rekordniveau. An der Wall Street trägt dazu ein weiterer Effekt bei: Das Angebot an Aktien wird durch Aktienrückkäufe verknappt. Bis kurz vor der Jahresmitte haben US-Unternehmen angekündigt, 2021 für gut 500 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückzukaufen und einzuziehen. Die Rückkäufe sind damit so umfangreich wie noch nie und doppelt so hoch wie zum selben Zeitpunkt 2020.
Die börsennotierten Unternehmen selbst sind mittlerweile die größte Käufergruppe an der Wall Street. Allein Apple und Alphabet kündigten Rückkäufe von zusammen 140 Milliarden Dollar an. Weil die Firmen die Rückkäufe meist mit Anleihen finanzieren, sind auch die Schulden auf Rekordniveau. Waren die 500 US-Konzerne im Aktienindex S&P 500 vor zehn Jahren mit 6,5 Billionen Dollar verschuldet, sind es aktuell 10,6 Billionen.
Kritiker sprechen von Bilanzkosmetik: Ein Viertel aller Gewinnsteigerungen erreichten US-Konzerne in den letzten zehn Jahren durch einen höheren Gewinn pro Aktie, weil die Zahl der Aktien durch Rückkäufe kleiner wurde. Der absolute Gewinn hingegen stagnierte oder sank.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/wall-street-500-milliarden-dollar-us-konzerne-steigern-aktienrueckkaeufe-auf-neuen-rekord/27285450.html
Eflamm Mordrelle: Die Reddit-Trader kommen! – Auch in deutschen Internet-Foren werden jetzt Penny-Aktien hochgejubelt. Der Schweizer Markt wird verschont, bis jetzt – Finanz & WIrtschaft, 16.6.2021
«To the Moon» lautet der Schlachtruf der Kleinanleger, die sich auf der Internet-Plattform Reddit treffen, um mit Penny-Aktien schnelles Geld zu verdienen – oder zu verlieren. Ein Ziel ist dieser Tage die französische Biotech-Aktie Neovacs. Zufall oder nicht, nachdem Anfang Woche im Reddit-Forum (Subreddit) zum Kauf des Titels aufgerufen worden war, schoss das Papier ein Fünftel hoch, verlor am Dienstag aber wieder 13%. Bis 18. Juni sollen sich zehntausend Anleger für Neovacs begeistern.
Dass sich junge, netzaffine Kleinanleger auf Reddit treffen, um koordiniert mit Penny-Stocks zu spekulieren ist ein aus den USA importiertes Phänomen. Seit Januar haben dort «Meme-Aktien» wie Gamestop, AMC, Blackberry oder Clover Health Kurssprünge gemacht, ohne dass fundamental etwas für den Kauf der Papiere sprechen würde ausser reine Spekulationslust oder die Genugtuung, einem Hedge Fund, der auf fallende Kurse wettet, eins auszuwischen – eine in der eher subversiven Reddit-Community verbreitete Motivation.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/die-reddit-trader-kommen/
SIEHE DAZU: https://www.reddit.com/r/Wallstreetbetsgermany/
ZENTRALBANKEN
- JAPAN
Megumi Fujikawa: BoJ hält an lockerer Geldpolitik fest – Neues Kreditprogramm, neue Kreditfazilität, denn: Klimawandel mit langfristig „extrem große[m] Einfluss“ auf Wirtschaft, Preise und finanziellen Bedingungen – Pandemie-Folgen: Programm mit zinslosen Krediten bis März 2022 verlängert – Zielrendite für 10-jährige Anleihen weiter bei 0 Prozent, ebenso weiter der Einlagenzins von minus 0,10 Prozent – BoJ bestätigt Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) – DJN, 18.6.2021
Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und startet eine neue Kreditfazilität für Banken zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der Klimawandel werde langfristig einen „extrem großen Einfluss“ auf die Wirtschaft, die Preise und die finanziellen Bedingungen haben, begründete die Notenbank nach der Sitzung des geldpolitischen Rats die Maßnahme. Das Kreditprogramm werde auf einem früheren Programm aufbauen, das den Banken helfen soll, Kredite an Wachstumssektoren der Wirtschaft zu vergeben.
Die BoJ beschloss während ihrer Sitzung zudem, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen um ein halbes Jahr zu verlängern. Das Programm mit zinslosen Krediten an Banken laufe nun bis März 2022. An der Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen von rund 0 Prozent hielt die Notenbank fest, ebenso wie am Einlagensatz von minus 0,10 Prozent. Zudem bestätigte die BoJ das Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) mit 12 Billionen Yen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53184835-boj-haelt-an-lockerer-geldpolitik-fest-neues-kreditprogramm-015.htm
- SCHWEIZ
Andreas Neinhaus: Der Chart des Tages: Nationalbank: kein Wort zu viel zum Franken – Finanz & Wirtschaft, 14.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/franken-vola-hat-stark-abgenommen-1-640×464.png
Am Donnerstag berät das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Die vierteljährlichen Lagebeurteilungen sind eigentlich die Höhepunkte im jährlichen SNB-Kalender. Diesmal geht es vor allem darum, Aufsehen zu vermeiden.
Die gesamte Aufmerksamkeit dürfte dem Franken gelten. Er hat sich in den vergangenen drei Monaten erneut aufgewertet. Der Euro ist unter 1.10 Fr./€ gerutscht und notiert 1.0877. Der Dollar ist nur knapp 90 Rp. wert. Während im Ausland die Inflationsangst umgeht, ist die Schweiz davon nicht betroffen. Die Teuerung ist nach langer Zeit erstmals wieder knapp über die Nulllinie getreten. Die Europäische Zentralbank hat an ihrer Sitzung vergangene Woche deutlich gemacht, dass sie sich von den aktuell steigenden Preisen nicht aus dem Konzept bringen lässt und die Marktzinsen weiterhin möglichst niedrig halten wird. Die SNB wird diesem Plädoyer folgen.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2074/
- EUROPÄISCHE UNION
Hans Bentzien: EZB: Analysten zu Leitzinsen und Anleihekaufprogrammen (APP): 2024e erste Anhebung des Einlagenzinses, 2025e positiver Zinssatz – PEPP: kein volle Ausschöpfung der eingeräumten 1,85 Billonen Euro, Nettokäufe im März 2022 beeindet – DJN, 18.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals die Ergebnisse einer Analystenumfrage zur Entwicklung von Leitzinsen und Anleihekaufprogrammen veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Analysten im Vorfeld der Ratssitzung am 10. Juni damit rechneten, dass die EZB ihren Einlagensatz im Mai 2024 zum ersten Mal, und zwar um 10 Basispunkte, anheben wird.
Nicht mehr negativ erwarten sie den Einlagensatz demnach im zweiten Quartal 2025. Für den Hauptrefinanzierungssatz prognostizierten die Analysten eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember 2024. Eine Minderheit der Analysten (10 Prozent) hielt eine Senkung des Einlagensatzes (im Dezember 2021, um 10 Basispunkte) für denkbar.
Die befragten Analysten äußerten auch ihre Meinung dazu, wo die EZB die Untergrenzen ihrer Leitzinsen sieht: Die des Einlagensatzes bei minus 0,80 (derzeit: minus 0,50) Prozent und die des Hauptrefinanzierungssatzes bei 0,00 (0,00) Prozent.
Ihre unter dem APP-Programm zu erwerbenden Anleihebestände wird die EZB nach Meinung der Beobachter ab Dezember 2023 nicht mehr vergrößern. Anschließend werde sie diese Bestände für acht Monate konstant halten, sagen die Analysten. Nach ihrer Meinung zur Dauer des PEPP-Programms hat die EZB die Analysten nicht befragt, wohl aber zu den voraussichtlichen Volumina. Die Analysten erwarten, dass das PEPP sein Maximalvolumen von 1.829 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022 erreichen wird.
Ihr Maximum – 3.498 Milliarden Euro – dürften die über APP und PEPP erworbenen Anleihebestände zusammen demnach im ersten Quartal 2024 erreichen. 2031 soll die EZB davon noch 2.719 Milliarden Euro halten. Aus den Prognosen ergibt sich, dass für das APP unmittelbar nach der erwarteten Beendigung der PEPP-Nettokäufe keine höheren APP-Käufe erwartet werden.
Es wird prognostiziert, dass die EZB das PEPP-Volumen von 1.850 Milliarden Euro nicht voll ausschöpfen und die Nettokäufe im März 2022 beenden wird. Eine Minderheit prognostiziert allerdings eine Aufstockung des PEPP um 125.000 Milliarden.
Die nächste Analystenumfrage findet im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 22. Juli statt, die Ergebnisse werden am Montag danach veröffentlicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53192582-ezb-analysten-erwarten-erste-anhebung-des-einlagenzinses-2024-015.htm
Hans Bentzien u.a.: Minderung des Tier-1-Kapital um 70 Milliarden Euro für 39 Banken – EZB verlängert Sonderregelung für Anwendung der Leverage Ratio – Anforderung einer Leverage Ratio von 3 Prozent ab 28. Juni – DJN(dpa-AFX, 18.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Geschäftsbanken in der Corona-Krise weiter unter die Arme greifen. Eine bereits im vergangenen Jahr eingeführte Ausnahmeregelung bei der Verschuldungsquote wird um weitere neun Monate verlängert werden, wie die EZB am Freitag mitteilte. Die Entlastung, die eigentlich Ende Juni auslaufen sollte, hat damit eine Laufzeit bis zum März 2022.
Mit der Verlängerung können Banken auch in den kommenden Monaten bei der Berechnung der Verschuldungsquote bestimmte Vermögenswerte wie Einlagen bei der Zentralbank auszunehmen. Das ermöglicht ihnen eine höhere Quote.
Mit Hilfe der Maßnahme können Banken ihre Finanzreserven stärker für neue Geschäfte einzusetzen. Die EZB beaufsichtigt seit November 2014 die größten Banken und Bankengruppen im Euroraum
Das bedeutet anders gewendet: Die Europäische Zentralbank (EZB) verlängert ihre Sonderregelung für die Anwendung der ungewichteten Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) durch Banken bis 31. März 2022. Damit bleiben Exponierungen der Banken gegenüber der EZB von den Eigenkapitalanforderungen in dieser Definition weiterhin ausgenommen, zum Beispiel Banknoten, Münzen und Zentralbankeinlagen.
Die Anforderung einer Leverage Ratio von 3 Prozent wird ab 28. Juni verbindlich. Wollen Banken die von der EZB angebotene Entlastung nutzen, müssen sie die seit Beginn der Corona-Krise neu hinzugekommenen Exponierungen so von den bis dahin bestehenden trennen, dass nur die neuen nicht bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung herangezogen werden. Stichtag ist der 19. Dezember 2019.
Laut EZB verringert die Regelung den Bedarf der 39 größten Banken des Euroraums an Tier-1-Kapital um 70 Milliarden Euro.
QUELLE:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53189296-ezb-verlaengert-ausnahmeregelung-fuer-verschuldungsquote-von-banken-016.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53189429-ezb-verlaengert-sonderregelung-fuer-anwendung-der-leverage-ratio-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Lane: Höhere Haushaltsdefizite nicht besorgniserregend – Im Vergleich zu vergangenen Schuldenepisoden stehen dieses Mal hohe inländische Privatvermögen den Staatsschulden gegenüber – Nettoauslandsschulden bleiben niedrig – Eine Art Inlandsverschuldung: Künftige Ausgaben öffentlicher Hände werden aus NExtGeneration-Anleihe bezahlt werden, nicht aus nationalen Staatshaushalten – DJN, 17.6.2021
Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, macht sich keine Sorgen wegen des starken Anstiegs der Defizite in den öffentlichen Haushalten des Euroraums. Lane sagte beim GSE Summer Forum, die von Manchen geäußerten Befürchtungen speisten sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit, in der hohe Haushaltsdefizite häufig mit hohen Leistungsbilanzdefiziten zusammen gefallen seien. Im aktuellen Fall hätten diese fiskalischen Defizite als Gegenposten Überschüsse der privaten Haushalte, die enorm gespart hätten. „Es handelt sich nicht um einen Anstieg der Nettoauslandsschulden – das ist relevant für künftige Makro-Dynamiken“, sagte Lane.
Der EZB-Chefvolkswirt wies außerdem darauf hin, dass die EU-Länder inzwischen gemeinsame Anleihen begäben, um der Corona-Krise zu begegnen. „Es wird in den nächsten Jahren viel fiskalische Ausgaben geben, die aus diesen Ressourcen bezahlt werden, nicht aus den nationalen Haushalten“, sagte er.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53179671-ezb-lane-hoehere-hauhaltsdefizite-nicht-besorgniserregend-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Schnabel: Marktneutralität durch Markteffizienz ersetzen, um Klimaschutzbelange zu unterstützen – CO2-produzierende Unternehmen nehmen Anleihemarkt stärker in Anspruch – Regulierung möglich: Ausschluss COS-intensiver Anleihen oder langsame Anpassungen der Geldpolitik (Tilting) – Tilting als komplizierter Weg: enger Markt für „grüne“ Anleihen lässt einschleichende Strategie mit Umgang CO2-intensiver Anleihen geraten sein – DJN, 14.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) sollt bei der Umsetzung ihrer Geldpolitik nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel das Prinzip der Marktneutralität durch das Prinzip der Markteffizienz ersetzen. Das würde es ihr ermöglichen, Belange des Klimaschutzes besser zu berücksichtigen.
„Wenn der Markt die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken falsch bewertet, kann die Einhaltung des Grundsatzes der Marktneutralität eine Marktstruktur unterstützen, die eine effiziente Ressourcenallokation behindert“, sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext bei einem EZB-Symposium. Im Vertrag sei aber festgelegt, dass die EZB ihr Mandat durch Förderung einer effizienten Ressourcen-Allokation ausüben solle.
Die Anwendung des Marktneutralitätsprinzips im Rahmen des Programms zum Ankauf von Unternehmensanleihen führt laut Schnabel zu einer Bevorteilung von Unternehmen aus CO2-intensiven Industrien. Grund ist, dass sich solche Unternehmen stärker auf dem Anleihemarkt finanzieren als andere. Theoretisch existieren laut Schnabel zwei Politikansätze, diesem Problem zu entgehen.
- Ausschluss CO2-intensiver Anleihen von Ankäufen
Diese Methoden hätten den Nachteil, dass sie Unternehmen keinen Anreiz böten, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. - Langsame Anpassung der Geldpolitik („Tilting“)
Die EZB würde ihre Operationen langsam den Nachhaltigkeitsanforderungen anpassen. Allerdings stoßen diese Methoden auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung. So könnte es zu Liquiditätsproblemen kommen, weil der Markt „grüner“ Anleihen klein ist, oder der Preisbildungsmechanismus könnte beeinträchtigt werden. Deshalb könnte erwogen werden, über Tilting-Strategien auch solche Emittenten zu begünstigen, die einen glaubwürdigen Pfad zur CO2-Verringerung eingeschlagen haben. Solche Strategien könnten auf der Ebene von Sektoren, Unternehmen oder Anleihearten angewendet werden.
Die Anwendung von Tilting-Strategien auf Staatsanleihen wäre laut Schnabel noch komplizierter. „Diese und andere Erwägungen sind Schlüsselelemente unserer laufenden Strategiedebatte“, sagte die EZB-Direktorin.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53144532-ezb-schnabel-marktneutralitaet-durch-markteffizienz-ersetzen-015.htm
Hans Bentzien: Lagarde: Trotz Kompletter Erholung des BIP 2022Q1e: Beendigung PEPP Ende März 2022 keine ausgemachte Sache – DJN, 14.6.2021
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums wird laut den aktuellen Projektionen der Europäischen Zentralbank (EZB) im ersten Quartal 2022 sein Vor-Corona-Niveau erreichen, eine Beendigung des Pandemiekaufprogramms PEPP ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde aber trotzdem keine ausgemachte Sache. „Ich will damit nicht andeuten, dass das PEPP am 31. März endet – wir haben viel Flexibilität, aber in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten bewegen wir uns in die richtige Richtung“, sagte Lagarde in einem Interview der Zeitung Politico.
Der EZB-Rat hatte in der vergangenen Woche beschlossen, das PEPP bis Ende März 2022 laufen zu lassen, auf jeden Fall aber so lange, bis er die Corona-Krisen-Phase für beendet hält. Lagardes Äußerungen deuten darauf hin, dass diese Bedingung mit Erreichen des Vorkrisenniveaus beim BIP erfüllt sein könnte. „Unsere Projektion und das Design des PEPP, wie wir es haben, scheinen in die richtige Richtung zu gehen“, sagte sie, fügte aber hinzu, es sei „viel zu früh, diese Fragen zu diskutieren“.
Im EZB-Rat gibt es ein deutliches Übergewicht der geldpolitischen „Tauben“, zu denen Lagarde selbst auch zählt. Sie würden das PEPP und seine Flexibilität beim Anleihekauf gerne möglichst lange erhalten. „Man nimmt einem Patienten die Krücken erst dann ab, wenn sich die Muskeln soweit erholt haben, dass der Patient auf seinen eigenen Beinen gehen kann“, sagte Lagarde in dem Interview.
Als ein Ausweg erscheint einigen Analysten, mit Beendigung des PEPP die Käufe unter dem APP-Kaufprogramm deutlich zu erhöhen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53138719-lagarde-beendigung-pepp-ende-maerz-2022-keine-ausgemachte-sache-015.htm
Hans Bentzien: Derzeit verfrühte Diskussion um PEPP-Ausstieg: EZB/Lane dämpft Erwartungen für Ratssitzung im September – Datengrundlage für Entscheidungen möglicherweise im September noch nicht vorhanden – Eingeplantes PEPP-Volumen von 1,85 Billionen Euro wird womöglich nicht ausgeschöpft werden – DJN, 17.6.2021
Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat versucht, die Erwartung von Marktteilnehmern zu dämpfen, dass der EZB-Rat im September über die Zukunft des Pandemiekaufprogramms PEPP entscheiden wird. Lane sagte in einem Interview mit Bloomberg TV: „Wir werden nicht unbedingt alle harten Daten haben, die wir haben möchten, wenn wir in die September-Sitzung gehen.“ Die Sitzung im September werde zwar wichtig sein, doch würden im Herbst noch viele wichtige Daten kommen.
Lane wiederholte die Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass Diskussionen über einen langsamen Ausstieg aus dem PEPP „verfrüht“ und „unnötig“ seien. Das PEPP hat ein Gesamtvolumen von 1.850 Milliarden Euro und läuft laut EZB bis Ende 2022, mindestens aber so lange „bis die Corona-Krisenphase vorbei ist“. Bei Käufen im aktuellen Tempo von monatlich 20 Milliarden Euro, das die EZB gerade erst für das dritte Quartal bestätigt hat, reicht das Volumen bis Ende März.
Die EZB betont, dass die 1.850 Milliarden Euro nicht ausgeschöpft werden müssen, wenn sich günstige Finanzierungsbedingungen auch mit weniger Mitteleinsatz absichern ließen. Andererseits könne das Programm aber auch aufgestockt werden, falls nötig. Ihr „Kompass“ sind die Finanzierungsbedingungen im Verhältnis zum Inflationsausblick. Gegenwärtig versuchen die meisten EZB-Ratsmitglieder Erwartungen zu dämpfen, dass die PEPP-Käufe wegen des sich bessernden Konjunkturausblicks zurückgefahren werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53178958-ezb-lane-daempft-erwartungen-fuer-ratssitzung-im-september-015.htm
Abkehr von Krisenhilfen: EZB-Ratsmitglied Olli Rehn: Im September wird diskutiert – Im Fokus das umfangreiche Anleihe-Kaufprogramm PEPP – Auch in 2021Q3 umfangreiche Anleihekäufe – PEPP läuft noch bis Ende März 2022 weiter – FAZ, 15.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Finnlands Notenbankchef Olli Rehn wahrscheinlich im September über eine Abkehr von den billionenschweren Corona-Krisenhilfen beraten. „Es ist wahrscheinlich, dass wir zu einem Zeitpunkt, meine Annahme ist September, über den Weg nach vorne diskutieren werden“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Dienstag. Dabei hat Rehn vor allem das umfangreiche Anleihen-Kaufprogramm PEPP im Blick. Dieses ist eine der wichtigsten Waffen der Währungshüter im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie.
Es sei gegenwärtig aber auch wichtig, eher auf Nummer sicherzugehen, sagte Rehn. Es gelte, auch künftig günstige Finanzierungsbedingungen zu gewährleisten. Rehn fügte hinzu, das insgesamt auf 1,85 Billionen Euro angelegte PEPP-Programm werde noch mindestens bis Ende März 2022 laufen. Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung beschlossen, trotz der sich abschwächenden Pandemie und steigender Inflationszahlen vorerst an ihrem ultralockeren Kurs festzuhalten.
Die Euro-Wächter entschieden, dass die Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP auch im nächsten Quartal deutlich umfangreicher ausfallen sollen als zum Jahresstart.
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ezb-ratsmitglied-olli-rehn-zur-abkehr-von-krisenhilfen-17390207.html
Hans Bentzien: Lagarde: EZB am Wochenende vom 19./20.6. bei Strategiediskussion gut vorangekommen – Im Vorfeld geplanter Strategieüberprüpfung: vertiefte informelle Diskussionen über die künftige geldpolitische Strategie – Themen: Definition und Messung von Preisstabilität und ihr zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation – DJN, 20.6.2021
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Wochenende vertiefte informelle Diskussionen über die künftige geldpolitische Strategie geführt und ist dabei nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde „gut vorangekommen“. Laut Mitteilung der EZB trafen sich die Ratsmitglieder vom 18. bis 20. Juni im Taunus in der Nähe Frankfurts zu ihrer jährlichen Klausurtagung. Es war das erste persönliche Treffen seit März 2020.
„Die Klausurtagung konzentrierte sich darauf, die Diskussionen über die Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB voranzutreiben“, teilte die EZB mit. Zu den Themen der Überprüfung gehörten demnach unter anderem die Definition und Messung von Preisstabilität, der zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation.
„Es war gut, sich wieder einmal persönlich zu treffen, und die hügelige Landschaft des Taunus war ideal, um nach Monaten, in denen wir uns nur digital getroffen haben, wieder in Kontakt zu kommen“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Ich freue mich, dass wir auf unserer Klausurtagung ausführliche Gespräche führen konnten und bei der Konkretisierung unserer künftigen geldpolitischen Strategie gut vorangekommen sind.“
Der EZB-Rat wird das Ergebnis der Strategieüberprüfung nach der formellen Beschlussfassung bekannt geben. Lagarde hatte kürzlich gesagt, sie hoffe, dass dies in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein werde. Analysten vermuten, dass die EZB spätestens Ende Jahres über die Zukunft des Pandemiekaufprogramms PEPP entscheiden und bis dahin ihre geldpolitische Strategie aktualisiert haben will
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53196701-lagarde-ezb-am-wochenende-bei-strategiediskussion-gut-vorangekommen-015.htm
COMMENT: Als wunderschöne gediegene und abgelegene Treffpunkte sind das Kronberger Schlosshotel, aber auch das Hotel Kempinski zwischen Falkenstein und Kronberg oder – kleiner, aber ausreichend groß – der Sonnenhof in Königstein zu nennen. Aber nichts Genaues weiß ich zum Ort des Treffens des EZB-Rates derzeit nicht. Königstein im Taunus war in den 1950er und 1960er Jahren Treffpunkt für Aussprachen deutscher Top-Politiker. Vorteil eines Treffens im Taunus ist die Kühle; Frankfurt am Main wäre hitzemäßig die Hölle gewesen oder man hätte die künstliche Atmosphäre klimatisierter Räume in Kauf genommen. Motto: verkühle dich einmal täglich – und stecke die anderen mit Corona an.
Hans Bentzien: Lagarde: Häufigere EZB-Strategieprüfungen mit Amtszeit der Präsidentschaft abstimmen – Lagarde stellt Periode von fünf Jahren in Frage: Strategieüberprüfung grundlegend, daher nicht zu häufig durchführen – DJN, 14.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde im Falle häufigerer Strategieprüfungen darüber nachdenken, diese mit den Amtszeiten der Präsidenten abzustimmen. „Meine persönliche Meinung ist, dass, wenn man dies alle fünf Jahre macht, es eine Zeit gibt, in der ein neuer Präsident kommt und er oder sie für die ersten fünf Jahre seiner oder ihrer Amtszeit fast festsitzt.“ Stattdessen könnte man es auf die Präsidentschaft abstimmen. „Auf diese Weise wird im ersten Jahr jeder Präsidentschaft mit der Umsetzung der vorherigen Strategie fortgefahren, während eine neue Überprüfung in Gang gesetzt wird“, sagte sie.
Allerdings sagte Lagarde auch, sie sei nicht sicher, ob es das wirklich alle fünf Jahre gemacht werden sollte. „Wir haben uns da noch nicht festgelegt.“ Strategieprüfungen seien so etwas wie ein „konstitutioneller Moment“, in dem über den Weg, den Anker, die Instrumente, die Beziehung der Geldpolitik mit der Fiskalpolitik, mit der Finanzstabilität, nachgedacht werde. „Es ist wirklich in gewisser Weise grundlegend, deshalb sollte man das nicht zu häufig machen müssen“, sagte sie.
Zu der Frage, wann die Ergebnisse der laufenden Strategieprüfung veröffentlicht würden, sagte Lagarde: „Ob es am Ende des Sommers oder im Herbst ist, ist weniger wichtig als die Qualität der Überprüfung und der solide Konsens.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53138891-lagarde-ezb-strategiepruefungen-mit-praesidentschaft-abstimmen-015.htm
Hans Bentzien: EZB/Panetta: Bargeldnachfrage steigt trotz sinkender Barzahlungen – Private sichern sich in Krisensituationen ab: Banknoten gefragt – Umfrage: Mitte 2020 nutzten 40 Prozent Bargeld seltener – DJN, 15.6.2021
Die Nachfrage nach Euro-Banknoten ist nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta in der Corona-Pandemie gestiegen, obwohl Bargeld zugleich seltener als Zahlungsmittel eingesetzt wurde. Panetta sagte, vermutlich hielten die Menschen mehr Bargeld, um sich gegen Unsicherheit zu schützen.
Seit Anfang 2020 ist das Bargeldvolumen, das bei Zentralbanken und Geschäftsbanken im Euroraum eingelagert wird, laut Panetta um 20 bis 25 Prozent gesunken. Eine Umfrage ergab Mitte 2020, dass rund 40 Prozent der Befragten Bargeld seltener nutzten als zuvor.
Zugleich stieg jedoch die Nachfrage nach Euro-Banknoten zwischen März 2020 und Mai 2021 um 190 Milliarden Euro – das sind 550 Euro pro Kopf. „Verglichen mit dem durchschnittlichen Volumen der vorangegangenen fünf Jahre wurden im Frühjahr 2020 bis zu 4 Prozent mehr Euro ausgegeben“, sagte Panetta. In der zweiten Phase der Lockdowns erhöhte sich der Abstand zum ursprünglich erwarteten Wachstumspfad bis Ende 2020 auf 8 Prozent.
„Eine mögliche Erklärung für dieses scheinbare Paradoxon – steigende Nachfrage nach Banknoten bei gleichzeitigem Rückgang der Barzahlungen – ist, dass sich die Menschen während der Krise dem Bargeld als Instrument zur Bewältigung der Unsicherheit zuwandten“, sagte der EZB-Direktor.
Untersuchungen zeigten, dass zu Beginn der Pandemie die Verbraucher – insbesondere jene mit geringem Einkommen – ihre Ausgaben einschränkten und ihre Bestände an liquiden Mitteln erhöhten. Bargeld sei der liquideste Vermögenswert für diejenigen, die ihre erhöhte Liquiditätspräferenz befriedigen wollten.
Panetta wies zugleich darauf hin, dass bereits vor der Pandemie nur rund 20 Prozent der ausgegeben Banknoten aktiv zu Zahlungszwecken innerhalb des Euroraums eingesetzt worden seien. „Der überwiegende Teil des Bargelds, etwa eine Billion Euro, wird als Vermögen gehalten und nur sporadisch für Zahlungen verwendet oder zirkuliert außerhalb des Euroraums“, sagte er.
Die Zukunft des Bargelds sieht Panetta vor diesem Hintergrund – auch für den Fall der Einführung eines digitalen Euro – nicht gefährdet.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53156805-ezb-panetta-bargeldnachfrage-steigt-trotz-sinkender-barzahlungen-015.htm
Hans Bentzien: Enria/Bankenaufsicht: EZB berät am 23. Juli über Ausschüttungsverbot – Empfehlung zum Dividendenausschüttungs- und Aktienrückkaufsstopp wurde von den meisten Banken eingehalten – Verbot soll „kein permanentes Instrument im Werkzeugkasten“ der Bankenaufsicht werden – DJN, 15.6.2021
Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht will nach den Worten ihres Chefs, Andrea Enria, im Juli über eine Aufhebung des Ausschüttungsverbots für Banken beraten. „Wir haben das im Aufsichtsrat (der Bankenaufsicht) am 23. Juli auf dem Tisch“, sagte Enria in einer Konferenz. Danach werde man die Entscheidung bekannt machen.
Die EZB hatte die Banken aufgerufen, als Gegenleistung für regulatorische Erleichterungen auf die Ausschüttung von Dividenden und auf Aktienrückkäufe zu verzichten. Daran hatten sich die meisten Banken gehalten, obwohl die EZB nicht die juristische Befugnis hat, ein Verbot auszusprechen.
Enria sagte, eine solche Einschränkung könne die EZB nur vorübergehend aussprechen – „es sollte kein permanentes Instrument in unserem Werkzeugkasten werden“. Die aktuellen Beschränkungen gelten noch bis Ende September.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155205-enria-ezb-beraet-am-23-juli-ueber-ausschuettungsverbot-015.htm
Patricia Kowsmann: EZB-Vorschlag: Großbanken müssen Vorstandssitze mit Frauen besetzen zur Hebung der Effektivität der Unternehmensführung – Nur 8 Prozent der Vorstandsvorsitzenden europäischer Kredit- und Investmentinstitute Frauen – Nur ein Fünftel der Positionen in den Führungsgremien der größten europäischen Banken von Frauen besetzt – Unterschiedliche Gleichstellungsgesetze in den europäischen Ländern als Hürde – DJN, 15.6.2021
Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Geschlechtervielfalt als Kriterium für die Zulassung von Bankvorständen und Führungskräften einführen, ein Schritt, der weiteren Druck auf einen Sektor ausüben würde, in dem die große Mehrheit der Führungspositionen immer noch von Männern besetzt ist.
Die Bankenaufsicht der EZB, die die größten Kreditinstitute der Eurozone beaufsichtigt, erklärte am Dienstag, dass, obwohl „Vielfalt in der Führung seit langem als entscheidend für eine effektive Unternehmensführung anerkannt ist“, die Zahlen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zeigen, dass nur 8 Prozent der Vorstandsvorsitzenden europäischer Kredit- und Investmentinstitute Frauen sind.
Die Behörde fügte hinzu, dass nur ein Fünftel der Positionen in den Führungsgremien der größten europäischen Banken von Frauen besetzt sind, und obwohl das europäische Recht von den Banken verlangt, eine Diversitätspolitik zu haben, würden dies weniger als zwei Drittel tun. Die neuen Kriterien sollen verwendet werden, wenn die Aufsichtsbehörde neue oder aktuelle Vorstandsmitglieder oder Führungskräfte überprüft, ein Prozess, der als „Fit-and-Proper“-Bewertung bekannt ist.
„Wann immer die Ziele nicht erreicht werden, werden wir Empfehlungen aussprechen, um solche Ungleichgewichte zu beheben“, schrieben Elizabeth McCaul, Mitglied des EZB-Aufsichtsrats, und ein Kollege in einem Meinungsbeitrag, der auf der Website der Aufsichtsbehörde veröffentlicht wurde. „Wenn es offensichtliche Verstöße gegen Diversitätsstrategien gibt, müssen wir die Banken möglicherweise dazu verpflichten, diese Strategien einzuhalten“, fügten sie hinzu.
McCaul selbst ist eine von elf Frauen im 34-köpfigen Aufsichtsgremium der EZB, das sich aus Vertretern der EZB und der nationalen Bankenaufsichtsbehörden in der Eurozone zusammensetzt. Der geldpolitische Arm der EZB hat nur zwei Frauen, einschließlich Präsidentin Christine Lagarde, in seinem 25-köpfigen EZB-Rat, der größtenteils aus nationalen Zentralbankgouverneuren besteht.
Eine Herausforderung für die EZB ist, dass die europäischen Länder unterschiedliche Gesetze zu diesem Thema haben. In Deutschland hat das Parlament kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das große Unternehmen dazu zwingt, mindestens eine Frau in ihren Vorständen zu haben. In Frankreich gibt es Quoten für Aufsichtsräte, die Unternehmen beaufsichtigen, aber nicht für Vorstände, die sich um das Tagesgeschäft der Unternehmen kümmern.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53153769-ezb-vorschlag-grossbanken-muessen-vorstandssitze-mit-frauen-besetzen-015.htm
- DEUTSCHLAND
Coronakrise – Für den Fall des Notfallendes: Weidmann fordert baldiges Ende der Krisen-Hilfen – Bedingung: gefestigte Wirtschaftserholung – Älteres APP-Programm nicht zum Abferdern eines auslaufenden PEPP-Programmes heranziehen – Keine Einstimmigkeit im EZB-Rat bezüglich PEPP: Weidmann bedauert beschleunigtes Aufkaufprogramm im nächsten Quartal – Inflation nicht sichtbar: überschießende Lohnforderungen dafür derzeit nicht gegeben – DJN, 17.6.2021
FRANKFURT (Dow Jones)–Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält ein baldiges Ende der EZB-Anleihekäufe über das Krisenprogramm PEPP für geboten. „Wenn der Notfall vorüber ist, für den das PEPP geschaffen wurde, muss es beendet werden,“ sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Voraussetzung für eine Normalisierung der Geldpolitik ist aus Sicht von Weidmann eine gefestigte wirtschaftliche Erholung und ein Auslaufen der wesentlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Hiermit rechnet er 2022.
„Ich gehe derzeit davon aus, dass wir im nächsten Jahr keine ungewöhnliche Unterauslastung der Kapazitäten mehr haben werden – und zwar auch dann, wenn wir die geldpolitischen Notfallmaßnahmen zurückfahren.“ Eine Erhöhung des älteren APP-Programms, um ein Auslaufen von PEPP abzufedern, lehnt Weidmann ab. „Die beiden Programme haben unterschiedliche Zwecke, und ich würde sie nicht derart verzahnen.“
Auf seiner Sitzung in der vergangenen Woche hatte der EZB-Rat beschlossen, dass die Anleihekäufe im Rahmen von PEPP auch im nächsten Quartal deutlich umfangreicher ausfallen sollen als zum Jahresbeginn. Weidmann ließ durchblicken, dass er eine Reduktion bevorzugt hätte. „In der anschließenden Pressekonferenz klang ja an, dass es auch Stimmen gab, das Tempo im Sommer zu drosseln“, sagte er. „Ich bin durchaus optimistisch, dass wir bei der Krisenbewältigung vorankommen und dann die Käufe vorsichtiger dosieren können“
Der Bundesbank-Präsident erwartet trotz der zuletzt stärker gestiegenen Preise keine dauerhaft hohe Inflation. „Aus unserer Sicht ist der starke Preisanstieg in Deutschland vorübergehend, und es deuten sich in der mittleren Frist keine zu hohen Raten an.“ Eine hartnäckig überhöhte Inflation würde laut Weidmann unter anderem überschießende Lohnabschlüsse voraussetzen. „Dafür haben wir derzeit keine Anhaltspunkte.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53181132-weidmann-fordert-baldiges-ende-der-krisen-hilfen-015.htm
Hans Bentzien: Buba: Basel 3 hebt Eigenkapitalanforderungen deutscher Banken um 8% – Für größere Banken Anhebung um 22 Prozent – Basel 3 noch nicht in EU-Recht gegossen – Regulatorische Entlastung kleiner Banken bei konstanten Anforderungen an deren Kapital- oder Liquiditätsausstattung – DJN, 14.6.2021
Die Eigenkapitalanforderungen an Kreditinstitute in Deutschland werden sich nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank durch die Implementierung des Eigenkapitalstandards Basel 3 unterschiedlich stark erhöhen. Der im Vorstand der Bundesbank für Bankenaufsicht zuständige Joachim Wuermeling sagte bei einer Veranstaltung im München, die Kapitalanforderungen für den deutschen Bankenmarkt dürften bis 2028 um etwa 8 Prozent steigen. Für größere Banken sei im Durchschnitt ein Anstieg um 22 Prozent abzusehen.
Laut Wuermeling rechnet die Eba damit, dass die Mindestkapitalanforderungen für jene deutschen Institute, die in ihrer Stichprobe enthalten sind, bis 2028 um 26 Prozent steigen. „Die Eba rechnet aber unter äußert konservativen Annahmen, Bundesbank und BaFin schätzen für die deutsche Stichprobe, dass die Mindestkapitalanforderungen um 22 Prozent steigen“, sagte Wuermeling laut veröffentlichtem Redetext.
Jenseits der Eba-Stichprobe, wo kleine Banken dominieren, die beispielsweise keine internen Modelle zur Berechnung ihrer Risiko-Aktiva benutzen, sind die Anforderungen viel geringer. Daher ergibt sich laut Bundesbank in diesem Szenario ein Anstieg von nur 12 Prozent. Aber auch diese 12 Prozent sind, wie Wuermeling sagt, „nicht in Stein gemeißelt“. „Betrachtet man weitere aktuell in Brüssel für die Umsetzung diskutierte Faktoren, schätzen wir, dass die Kapitalanforderungen für den deutschen Bankenmarkt am Ende nur um etwa 8 Prozent steigen dürften.“
Wuermeling wies darauf hin, dass der Vorschlag für die Umsetzung von Basel 3 in europäisches Recht noch nicht vorliege. „Dennoch gibt es Umsetzungsszenarien, deren Auswirkungen wir abschätzen können“, sagte er.
Wuermeling zufolge sollen außerdem die vielen kleinen Banken in Deutschland regulatorisch entlastet werden. Die Bundesbank habe rund 80 Prozent von ihnen (ca 1.170) als „small and non complex institutions“ (SNCI) klassifiziert. „Diese Liste ist Startpunkt für einige regulatorische Erleichterungen, die den SNCI gewährt werden“, sagte Wuermeling. Die Institute müssten künftig weniger Offenlegungsanforderungen erfüllen.
Zudem komme für sie die vereinfachte Liquiditätsmessgröße (Net Stable Funding Ratio – NSFR) zur Anwendung. „Der wesentliche Unterschied im Vergleich zur vollständigen NSFR besteht in weniger Datenpunkten“, erläuterte Wuermeling und fügte hinzu: „All die Erleichterungen sind rein operativ. Wir schrauben nicht an den Anforderungen der Kapital- oder Liquiditätsausstattung der kleinen Banken.“
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53143762-buba-basel-3-hebt-eigenkapitalanforderungen-deutscher-banken-um-8-015.htm
Hans Bentzien: Wuermeling: Deutsche Banken konnten Negativzins 2020 mindestens kompensieren dank Konditionsanpassungen im Einlagengeschäft – Weitergabe von Negativzinsen und andere Zinsanpassungen – DJN, 14.6.2021
Die deutschen Kreditinstitute haben die Wirkungen des negativen Satzes für Überschusseinlagen nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling im vergangenen Jahr ausgleichen können. Wuermeling sagte laut Redetext bei einer Veranstaltung in München: „Erste Analysen unserer Daten deuten darauf hin, dass die Banken ihre nach den TLTRO verbliebene Belastung durch die Negativzinsen in der Einlagefazilität im Jahr 2020 mindestens kompensieren konnten.“ Dies geschehe durch Konditionsanpassungen im Einlagengeschäft – berücksichtigt würden dabei nicht nur die Weitergabe von Negativzinsen, sondern auch andere Zinsanpassungen.
Laut Wuermeling verblieb den Banken 2020 ein Nettozinsaufwand von 1 Milliarde Euro aus dem negativen Einlagenzins. 2019 war noch ein Zinsüberschuss von 82 Milliarden Euro angefallen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53143764-wuermeling-deutsche-banken-konnten-negativzins-2020-mindestens-kompensieren-015.htm
Hans Bentzien: Höhepunkt kommt erst: Deutsche Banken derzeit mit weniger notleidenden Krediten als erwartet – Statt erwarteten 45 Milliarden Euro nur 33 Milliarden Euro – Zeitverzögerte Krise: Volumen der notleidenden Kredite für 2022 bei 47 Milliarden Euro erwartet – Ausfallswahrscheinlichkeiten werden zu gering eingeschätzt – DJN, 15.6.2021
Die Welle notleidender Kredite (Non-performing Loans – NPL) infolge der Corona-Pandemie fällt bisher kleiner als von deutschen Banken erwartet aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) unter Risikomanagern der größten Institute. Das von der BKS und der Frankfurt School of Finance erhobene NPL-Barometer sank in der Februar-Umfrage auf 0,25 Punkte, nachdem es in der Umfrage von Mai/Juni 2020 auf 0,42 (zuvor: minus 0,02) angezogen hatte.
„Das NPL-Volumen war 2020 auf 45 Milliarden Euro geschätzt worden, geworden sind es nur 33 Milliarden“, sagte Christoph Schalast, Professor für M&A an der Frankfurt School of Finance, bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. Für 2021 werde nun ein NPL-Volumen von 40,6 Milliarden Euro erwartet, für 2022 sind es 46,7 Milliarden. In den Banken werde der Höhepunkt der NPL-Welle jetzt für 2022 und teilweise für 2023 erwartet. „Wir haben hier eine Krise, die sehr stark zeitverzögert funktioniert“, sagte Schalast.
Er wies zudem darauf hin, dass es eine „intrinsische Motivation“ gebe, den Zeitpunkt der Anerkennung eines Kredits als notleidend möglichst weit hinauszuschieben – „insbesondere, und dazu neigt man immer, wenn man irgendwie die Hoffnung hat, dass die Sache vielleicht doch noch gut ausgeht“, so Schalast. Es gebe die Neigung, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls als geringer einzuschätzen, als sie tatsächlich sei.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155810-deutsche-banken-mit-weniger-notleidenden-krediten-als-erwartet-015.htm
USA
Astrid Dörner: „Es könnte sich herausstellen, dass die Inflation höher ist und länger anhält, als wir erwarten.“: US-Notenbank-Chef Jerome Powell stellt zwei Zinsschritte bis Ende 2023 in Aussicht und erwartet höhere Inflation – Die US-Notenbank lässt ihren Leitzins unverändert, bereitet die Märkte aber auf eine Abkehr der ultralockeren Geldpolitik vor. Fed-Chef Powell schraubt zudem die Inflationserwartung nach oben – Unicredit-Experten: gefühlte Inflation liegt bei 4,1 Prozent – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING & FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 16./17.6.2021
Vielleicht glauben Sie auch, die Preise seien in Wahrheit viel höher als offiziell angegeben. In diesem Fall können Sie Ökonomen der Großbank Unicredit in den Zeugenstand rufen. Die gewichten in ihren Modellen jene Waren besonders stark, die wie Lebensmittel oder Benzin oft gekauft werden. Aktuelles Ergebnis: eine „gefühlte Inflation“ von 4,1 Prozent – der höchste Wert seit neun Jahren.
Weil aber auch die tatsächliche Inflation ansteigt, hat die US-Notenbank nun vielsagend erklärt, die Debatte über ein Zurückfahren der extrem lockeren Geldpolitik habe begonnen. Die Fed hält zwar nach ihrer Sitzung die Zinsen weiter in der Kelleretage – zwischen 0,00 und 0,25 Prozent –, sie macht aber auch klar, für 2023 von zwei Zinsanhebungen um insgesamt einen halben Prozentpunkt auszugehen. Auf die Weissager von Washington reagierte die Wall Street ebenfalls sofort mit Kursrückgängen. *** Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bereitet die Märkte auf eine Kursänderung vor. Da sich die Wirtschaft schnell von der Pandemie erhole, würden die Währungshüter nun „darüber nachdenken, die Anleihekäufe zurückzufahren“, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Washington. Das ist ein wichtiges Signal. Powell war in den vergangenen Wochen immer wieder dafür kritisiert worden, zu lange an der ultra-lockeren Geldpolitik festzuhalten, die die Fed seit Beginn der Pandemie eingeführt hat. – Auch zeigte sich Powell deutlich offener, was die künftige Entwicklung der Preise angeht. „Die Veränderungen in der Nachfrage können im Zuge der Öffnung der Wirtschaft stark sein und sich schnell bemerkbar machen“, gab der Fed-Chef auf einer Pressekonferenz zu bedenken. Das würde sich auch auf die Preise auswirken, wie in den USA bereits an verschiedenen Stellen bemerkbar ist. *** die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bereitet die Märkte auf eine Kursänderung vor. Da sich die Wirtschaft schnell von der Pandemie erhole, würden die Währungshüter nun „darüber nachdenken, die Anleihekäufe zurückzufahren“, sagte Fed-Chef Jerome Powell in Washington. Das ist ein wichtiges Signal. Powell war in den vergangenen Wochen immer wieder dafür kritisiert worden, zu lange an der ultra-lockeren Geldpolitik festzuhalten, die die Fed seit Beginn der Pandemie eingeführt hat. –
Auch zeigte sich Powell deutlich offener, was die künftige Entwicklung der Preise angeht. „Die Veränderungen in der Nachfrage können im Zuge der Öffnung der Wirtschaft stark sein und sich schnell bemerkbar machen“, gab der Fed-Chef zu bedenken. Das würde sich auch auf die Preise auswirken, wie in den USA bereits an verschiedenen Stellen bemerkbar ist. *** Egal ob Marktexperte Mohamed El-Erian, der Chef von Morgan Stanley, James Gorman, oder Starinvestor Paul Tudor Jones: Alle haben in den vergangenen Tagen Druck auf Jerome Powell gemacht. Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) müsse endlich abrücken von seiner Überzeugung, dass der starke Anstieg der Inflation in den USA nur vorübergehend sei, sondern langfristig auf der Wirtschaft lasten könnte. – Statt zu lange abzuwarten, müsse die Fed damit anfangen, ihre Anleihekäufe zu reduzieren. So würde sie vermeiden, dass die Wirtschaft überhitzt und dass ein zu drastisches Eingreifen der Fed zu einer Rezession führen würde. – Die Botschaft ist angekommen bei Powell. Die Notenbanker hätten bei ihrer Tagung in dieser Woche angefangen, über eine Reduzierung der Anleihekäufe zu diskutieren, erklärte er. Das ist ein wichtiges Signal für Investoren, und es ist höchste Zeit, dass die Fed mit den Diskussionen beginnt.
QUELLE (jeweils ZAHLPFLICHT):
https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/us-notenbank-fed-stellt-zwei-zinsschritte-bis-ende-2023-in-aussicht-und-erwartet-hoehere-inflation/27293950.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-fed-chef-powell-haelt-sich-alle-tueren-offen/27294850.html
Max Borowski: Höchstpreise schrecken Käufer: ab US-Holzpreis bricht in Rekordtempo ein – UN erwartet höhere Holzbringung – n-tv, 14.6.2021
Baustellen stehen teils still, Autowerke halten die Bänder an, Lebensmittel werden teurer: Nach der Pandemie sind viele Produkte und Rohstoffe knapp, die Preise explodieren regelrecht. Doch es gibt Gegenkräfte am Markt. Die zeigen jetzt etwa beim Holzpreis in den USA ihre Wirkung.
Mikrochips, Industriemetalle, Gummi, Schrauben: Von Rohstoffen bis zu industriellen Vorprodukten sind viele Waren auf dem Weltmarkt in den vergangenen Monaten knapp geworden. Lieferzeiten werden immer länger, Preise schießen in die Höhe mit teils dramatischen Folgen für Unternehmen und private Kunden. Ein Produkt, bei dem sich diese Entwicklung besonders heftig niederschlug mit spürbaren Konsequenzen, ist Rohholz, insbesondere auf dem größten Häusermarkt der Welt, den USA. Dort verfünffachte sich der Holzpreis innerhalb eines Jahres.
*** UN erwartet höhere Ernte ***
US-amerikanische Sägemühlenbetreiber, deren Kapazität in den vergangenen Monaten der entscheidende Flaschenhals war, haben ihre Produktion inzwischen etwas ausgeweitet und Investitionen in neue, größere Anlagen angekündigt. Gleichzeitig zeigte sich die Nachfrageseite auf dem Holzmarkt flexibler, als zunächst angenommen worden war. Käufer seien von den extremen Preisen abgeschreckt worden und hätten Bestellungen in der Hoffnung auf ein größeres Angebot zu einem späteren Zeitpunkt aufgeschoben. Das zeigte sich in den vergangenen Wochen auch bei der Bautätigkeit in den USA, die deutlich zurückgegangen war, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Marktteilnehmer.
So berichtet ein Holzhändler aus Massachusetts, dass zuletzt viel Holz von den Sägewerken zum Kauf angeboten worden sei. Die Käufer hätten aber offenbar keine Dringlichkeit verspürt. Der Finanzanalyst CIBS konstatierte, dass Kunden derzeit „an der Seitenlinie“ abwarteten und nur das Nötigste kauften. Trotz der jüngsten Korrektur erwarten die Analysten allerdings keineswegs, dass die Preise schnell wieder auf ihr Vor-Corona-Niveau fallen. Angesichts der erwarteten weiter starken Nachfrage auf dem Häusermarkt dürfte sich der Holzpreis zwischen Rekordhoch und dem alten Niveau einpendeln, sagte Analyst Scott Reaves vom Beratungsunternehmen Domain Timber Advisors Bloomberg.
Auch auf anderen angespannten Märkten könnte sich bald ein neues Gleichgewicht einstellen, wenn Käufer durch zu hohe Preise abgeschreckt werden oder die Anbieter die Produktion erweitern. So prognostiziert etwa die UN-Organisation für Nahrungsmittel und Landwirtschaft für die kommende Saison höhere Ernten und damit mittelfristig eine Entspannung für die zuletzt stark gestiegenen Preise für die wichtigsten Nahrungsmittelrohstoffe. Bei anderen Waren kommen allerdings andere Faktoren hinzu, die eine schnelle Anpassung des Angebots an die gestiegene Nachfrage behindern, darunter die begrenzten Kapazitäten der Containerschifffahrt für den Transport etwa von den zum großen Teil in Asien angesiedelten Elektronikproduzenten zu deren Kunden in Europa oder Nordamerika.
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/US-Holzpreis-bricht-in-Rekordtempo-ein-article22618030.html
SIEHE DAZU:
Mangel an Chips, Gummi, Holz „Außer in Kriegszeiten nie in so einer Situation“ – n-tv, 13.6.2021
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Ausser-in-Kriegszeiten-nie-in-so-einer-Situation-article22613740.html
USA: Stärkster Zuwachs seit 2010: Erzeugerpreise steigen im Vorjahresvergleich deutlich um +6,6 Prozent – stärkster Zuwachs seit Erhebungsbeginn – Inflationserwartungen werden angeheizt – dpa-AFX, 15.6.2021
Der Preisauftrieb in den USA bleibt stark. Im Mai stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das war nicht nur stärker als der von Analysten erwartete Anstieg von im Schnitt 6,2 Prozent. Auch war es der stärkste Zuwachs seit Beginn der Aufzeichnungen gegenüber dem Vorjahresmonat im Jahr 2010, wie das Ministerium erklärte.
Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten, um 0,8 Prozent. Auch dieser Zuwachs fiel stärker aus als erwartet.
Für die Kernrate wurde im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 5,3 Prozent gemeldet, die höchste Rate seit August 2014. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise in der Kernrate – ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie – verglichen mit dem Vormonat um 0,7 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert.
Der jüngste Schub bei den Produzentenpreisen spiegelt viele Faktoren wider, darunter durcheinander geratene Lieferketten, verlängerte Lieferzeiten, höhere Transportkosten und ein grassierender Material- und Arbeitskräftemängel sowie die Erholung der Energie- und Rohstoffpreise.
Die Daten dürften die Inflationserwartungen weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Verbraucherpreise waren im Mai um 5 Prozent gestiegen und damit deutlich stärker als von der Fed angestrebt. Zwar ist die Entwicklung auch durch statistische Effekte getrieben. Allerdings treten im Welthandel derzeit zahlreiche Probleme auf, die die Preise von Vorprodukten und Rohstoffen steigen lassen. Die Fed erachtet die Probleme jedoch als temporär und will geldpolitisch nicht reagieren.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155231-usa-erzeugerpreise-steigen-deutlich-staerkster-zuwachs-seit-erhebungsbeginn-016.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155244-us-erzeugerpreise-steigen-im-mai-staerker-als-erwartet-015.htm
USA: Frühindikatoren des Conference Board steigen wie erwartet – Zusammengesetzter Indikator stieg bereits im April – dpa-AFX, 17.6.2021
Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im Mai wie erwartet verbessert. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren stieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet. Bereits im April waren die Frühindikatoren nach revidierten Zahlen mit diesem Tempo gestiegen. Zunächst war für den April ein Anstieg von 1,6 Prozent ermittelt worden.
Der Sammelindex setzt sich aus zehn Indikatoren zusammen. Dazu zählen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Neuaufträge in der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen. Die Indikatoren geben einen Eindruck über den Zustand der US-Wirtschaft.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53180199-usa-fruehindikatoren-steigen-wie-erwartet-016.htm
Philly-Fed-Index im Juni wenig verändert, aber Subindex für Auftragseingang bildet sich schwächer, Beschäftigungssubindex stärker ab – DJN, 17.6.2021
Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia ist im Juni im Großen und Ganzen stabil geblieben. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank leicht auf 30,7 Punkte von 31,5 im Mai. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von 30,0 erwartet.
Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.
Schwächer entwickelte sich der Subindex für den Auftragseingang, er fiel auf 22,2 Punkte von 32,5 im Vormonat. Dagegen stieg der Subindex für die Beschäftigung auf 30,7 Punkte von 19,3 im Vormonat.
Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53179183-philly-fed-index-im-juni-wenig-veraendert-015.htm
New Yorker Konjunkturindex fällt im Juni stärker als erwartet – Indices für Ordereingang und Beschäftigung sanken – DJN, 15.6.2021
Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juni etwas stärker gesunken als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf 17,4. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 22,9 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 24,3 gelegen.
Mit dem erneuten Dämpfer fiel der Indexwert auf das Niveau vom März zurück.
Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.
Die Indexkomponente für den Ordereingang fiel im Juni auf 16,3 (Vormonat: 28,9). Der Subindex für die Beschäftigung sank auf 12,3 (13,6).
Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155081-new-yorker-konjunkturindex-faellt-im-juni-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155026-usa-stimmung-in-der-new-yorker-industrie-truebt-sich-weiter-ein-016.htm
SIEHE DAZU: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html
Murat Sahin: US-Industrieproduktion im Mai auf Monatssicht um +0,8 Prozent gestiegen – Basiseffekt: Anstieg im Jhresvergleich um +16,3 Prozent – Starker Anstieg auch für die Produktion im verarbeitenden Gewerbe: Vormonatsplus 0,9 Prozent, Jahresplus 18,3 Prozent – DJN, 15.6.2021
Die Industrie in den USA hat im Mai ihre Produktion ausgeweitet. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,6 Prozent prognostiziert.
Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 75,2 Prozent von 74,6 im Vormonat. Ökonomen waren von 75,1 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat blieb die Auslastung unverändert bei 74,6 Prozent.
Die Industrieproduktion war im April um revidiert 0,1 (vorläufig: 0,5) Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wurde im Mai 16,3 Prozent mehr produziert.
Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,9 Prozent verzeichnet nach minus 0,1 Prozent. Die Jahresrate lag bei plus 18,3 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155812-us-industrieproduktion-im-mai-gestiegen-015.htm
Martin Lüscher: Der Chart des Tages – US-Einzelhandel deutlich über dem langjährigen Trend: annualisiertes Wachstum für die vergangenen zwei Jahre bei 10 Prozent – Finanz & Wirtschaft, 17.6.2021
Auf den ersten Blick sieht die Entwicklung im amerikanischen Detailhandel enttäuschend aus. Im Mai ging der Umsatz gegenüber dem Vormonat 1,3% zurück. Die Auguren rechneten im Mittel mit einem Minus von 0,8%.
Auf den zweiten Blick relativiert sich die Enttäuschung aber gewaltig. Der Einzelhandelsumsatz vom Mai 2021 notiert 18% über dem Niveau von vor der Pandemie.
Entsprechend liegt der aktuelle Wert deutlich über dem langfristigen Trend. Während der Umsatz vor der Pandemie jährlich 3,5% stieg, resultierte über die vergangenen zwei Jahre ein annualisiertes Wachstum von 10%.
QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2077/
GRAPHIK (siehe auch die folgende Meldung): https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/fredgraph-1-640×385.png
Sarah Chaney Cambon: Umsätze der US-Einzelhändler im Mai schwächer als erwartet – Lieferkettenstörungen als Ursache – DJN, 15.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/fredgraph-1-640×385.png
Die US-Einzelhändler haben im Mai einen größeren Rückgang der Umsätze erlitten als erwartet. Unterbrechungen in den Lieferketten und die Wiedereröffnung von Geschäften führten zu einer Verlagerung der Konsumausgaben von Waren zu Dienstleistungen. Die gesamten Umsätze der Branche fielen um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens nur mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.
Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, sanken die Umsätze ohne Kfz um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie dagegen einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.
Für den April gab das Ministerium einen Anstieg von revidiert 0,9 (vorläufig: 0,0) Prozent für die Gesamtrate an. Für die Umsätze ex Kfz wurde jetzt eine Stagnation (vorläufig: minus 0,8 Prozent) gemeldet.
Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.
Allerdings war die Entwicklung im April deutlich positiver als zunächst berichtet. Damals waren die Umsätze um revidierte 0,9 Prozent gestiegen, nachdem zunächst nur eine Stagnation berichtet worden war. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat ergibt sich ein deutliches Plus von 27,7 Prozent. Im Mai 2020 war der Einzelhandel stark durch die Corona-Krise belastet worden.
Die Umsätze ohne die schwankungsanfälligen Erlöse aus Autoverkäufen sanken im Mai zum Vormonat um 0,7 Prozent. Analysten hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Auch hier war die Entwicklung im Vormonat deutlich besser als zunächst berichtet.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155002-umsaetze-der-us-einzelhaendler-im-mai-schwaecher-als-erwartet-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155025-usa-einzelhandelsumsaetze-sinken-staerker-als-erwartet-016.htm
USA: Baugenehmigungen und -beginne enttäuschen, wenig Zunahem bei neu begonnenen Wohnungsbauten – Expertenerwartungen wurden für beide Parameter enttäuscht – dpa-AFX, 16.6.2021
Die Entwicklung in der US-Bauwirtschaft blieb im Mai hinter den Erwartungen zurück. Während die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten weniger als erwartet zulegte, ging die Zahl der Baugenehmigungen überraschend deutlich zurück.
Die Baubeginne stiegen im Monatsvergleich um 3,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten allerdings im Schnitt einen Anstieg um 3,9 Prozent erwartet. Zudem war der starke Rückgang im April mit revidierten 12,1 Prozent noch kräftiger als zunächst ermittelt ausgefallen (minus 9,5 Prozent).
Die Baugenehmigungen, die den Baubeginnen zeitlich vorauslaufen, gaben im Mai um 3,0 Prozent zum Vormonat nach. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Bereits im April waren die Genehmigungen um revidierte 1,3 Prozent gefallen (zunächst plus 0,3 Prozent).
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53167355-usa-baugenehmigungen-und-beginne-enttaeuschen-016.htm
Nach Revision für die Vorwoche nach unten: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen wider Erwarten – Negligeable Erhöhung der Zahl der Arbeitslosenempfänger – DJN, 17.6.2021
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 12. Juni wider Erwarten zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 37.000 auf 412.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 360.000 vorhergesagt.
Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 375.000 von ursprünglich 376.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 8.000 auf 395.000.
In der Woche zum 5. Juni erhielten 3,518 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 1.000.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53179129-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-steigen-wider-erwarten-015.htm
Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
CHINA
Sylvia Walter: Der Chart des Tages – Kein Platz für Jeans: Container-Frachtkosten steigen rapide – Ungeliebte Inflation wird in witer Jahreshälte Thema bleiben – Finanz & Wirtschaft, 16.6.2021
GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/shipping-costs.png
Selbst wenn die Finanzmärkte die neuesten Inflationszahlen aus den USA und China mit einem Schulterzucken quittiert haben, die Diskussion über die Teuerung wird auch die zweite Jahreshälfte dominieren.
In China haben die Produzentenpreise im Vorjahresvergleich um 9% zugelegt. Jahrzehntelang exportierte das Reich der Mitte disinflationäre Tendenzen, nun beschäftigt sich die Debatte zunehmend mit der Frage, ob es die globale Teuerung anheizt.
Dabei spielen die Frachtkosten für Schiffladungen eine grosse Rolle. Die Preise befinden sich seit geraumer Zeit auf einem Höhenflug. Vor kurzem musste der Hafen von Yantian teilweise geschlossen werden aufgrund eines erneuten Anstiegs von Coronainfektionen. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die dadurch entstandenen Störungen mehr zusätzlichen Preisauftrieb auslösen werden als die Blockade des Suezkanal im März.
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2076/
Corona ist nicht unser einziges Problem: Containerhafen Yantian, einer der umtriebigsten Häfen der Welt, liegt Corona-bedingt lahm – FRÜHDENKER / Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.6.2021
Die Auswirkungen könnten dramatischer sein als bei der Blockade des Suezkanals: Aufgrund strikter Corona-Maßnahmen ist der Verkehr im Containerhafen Yantian vor der chinesischen Metropole Shenzhen zur Hälfte lahmgelegt.
Stillstand: Das Yantian Container Terminal ist nach Schanghai, Singapur und Ningbo die Nummer vier der geschäftigsten Containerhäfen der Welt. Hier lagen zuletzt 84 Frachter für Tage und Wochen auf Reede. Unternehmen warten teils wochenlang auf Waren.
Teuer: Die dadurch entstehenden Verzögerungen werden teuer – möglicherweise noch teurer als während der Blockade des Suezkanals durch den Containerriesen Evergiven und die Corona-Verzögerungen in den amerikanischen Häfen. Grund: Die chinesischen Handelswege von und nach Asien, Europa und Richtung USA sind allesamt beeinträchtigt.
Deutschland: Auch die deutsche Wirtschaft muss mit Auswirkungen rechnen. Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Probleme in den internationalen Lieferketten hierzulande vor allem auf die Industrieproduktion auswirken werden. Das Münchner Ifo-Institut teilte am Mittwoch mit, wegen der globalen Lieferengpässe nur noch mit 3,3 statt den noch im März angenommenen 3,7 Prozent Wachstum für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr zu rechnen. An diesem Donnerstag veröffentlichen auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Institut für Weltwirtschaft Konjunkturprognosen für 2021 und 2022.
QUELLE: nicht verlinkbar
China: Einzelhandel und Industrie entwickeln sich schwächer als erwartet – dpa-AFX, 16.6.2021
In China sind die Umsätze im Einzelhandel im Mai nicht so stark gestiegen wie erwartet. Der Einzelhandelsumsatz habe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,4 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt am Mittwoch in Peking mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 14,0 Prozent gerechnet. Im April waren die Umsätze noch deutlich stärker um 17,7 Prozent gestiegen.
Schwächer als erwartet fielen auch die Zuwächse der Industrieproduktion und der Investitionen in Sachanlagen aus. Die Produktion in der Industrie verzeichnete im Mai einen Anstieg zum Vorjahresmonat um 8,8 Prozent. Hier hatte die Prognose bei 9,2 Prozent gelegen. Bei den Investitionen in Sachanlagen betrug der Zuwachs 15,4 Prozent, während Analysten einen Anstieg um 17 Prozent erwartet hatten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53162518-china-einzelhandel-und-industrie-entwickeln-sich-schwaecher-als-erwartet-016.htm
Andrea Thomas (WSJ): Chinesische Direktinvestitionen in Europa fallen 2020 auf 10-Jahres-Tief – Befürchtung des Unternehmens-Aufkaufs durch China nicht eingetreten – Trotz attraktiven Industriestandorts: Pandemiefolgen, chinesische Kapitalabluss-Hemmnisse, europäische Restriktionen hemmen chinesische Investitionen – Deutschland von China vor allen anderen bevorzugt – EU-China-Streitereien könnten chinesische Investitionsneigungen künftig vermehrt stören – DJN, 16.6.2021
China hat im vergangenen Jahr einer Studie zufolge deutlich weniger in Europa investiert als im Jahr zuvor. Auch im ersten Quartal 2021 setzte sich diese Entwicklung fort, ergab eine gemeinsame Studie des Mercator Institute for China Studies (MERICS) und der Rhodium Group.
Insgesamt hätten sich Befürchtungen als unbegründet erwiesen, dass die Corona-Pandemie zu einem chinesischen Aufkauf von notleidenden Vermögenswerten führen werde.
Aufgrund der Pandemie und den höheren Hürden für ausländische Direktinvestitionen sank das Volumen der abgeschlossenen chinesischen M&A-Projekte 2020 gegenüber 2019 um 45 Prozent von 11,7 auf 6,5 Milliarden Euro. Damit erreichten sie ein 10-Jahres-Tief. Neu-Investitionen, sogenannte Greenfield Investments, erreichten hingegen mit einem Volumen von 1,3 Milliarden den höchsten Stand seit 2016.
„Europa bleibt ein attraktiver Investitionsstandort, aber die anhaltenden Störungen durch die Pandemie, hohe Hürden für Kapitalabflüsse aus China und größere regulatorische Hindernisse in Europa tragen weiter dazu bei, dass chinesische Investitionen sich auf einem niedrigeren Niveau bewegen“, erklärte MERICS. Die angespannten und sich verschlechternden Beziehungen zwischen der EU und China könnten für chinesische Investoren in Zukunft zusätzlichen Gegenwind bringen.
Mehr als die Hälfte der chinesischen Direktinvestitionen entfielen auf Deutschland, Großbritannien und Frankreich, wobei der Zufluss an Investitionen ins Vereinigte Königreich um 77 Prozent fiel. Polen war aufgrund einer großen Akquisition zudem ein wichtiger Empfänger von chinesischen Direktinvestitionen.
Weltweit erreichten die chinesischen Investitionen im vergangenen Jahr mit 25 Milliarden Euro ein 13-Jahres-Tief und ein Rückgang um 45 Prozent von 2019.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53166067-chinesische-direktinvestitionen-in-europa-fallen-2020-auf-10-jahres-tief-015.htm
GROSSBRITANNIEN
Virulente Delta-Variante bedingt höchsten Tageswert an Corona-Neuinfektionen seit Februar – Hohe bekannte Inzidenz und gleich hoch eingeschätzte Dunkelziffer dafür – Geplantes Restriktionsende auf 19. Juli verschoben – Beschleunigtes Impfprogramm geplant – dpa-AFX, 16.6.2021
Die Delta-Variante des Coronavirus treibt die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien weiter deutlich in die Höhe. Am Mittwoch meldeten die Behörden 9055 neue Fälle – das waren etwa 1380 mehr als am Vortag und der höchste Tageswert seit Februar. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die noch Anfang Mai unter 20 lag, stieg mittlerweile wieder auf deutlich mehr als 70 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.
Wie schnell sich das Virus derzeit ausbreitet, zeigt die Gesamtzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage: 55 216 Fälle zwischen dem 10. und 16. Juni bedeuten ein Plus von fast einem Drittel im Vergleich zur Vorwoche. Experten gehen zudem von einer Dunkelziffer in etwa gleicher Höhe aus. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen nahm im Wochenvergleich sogar um 40 Prozent zu.
Wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante hat Premierminister Boris Johnson die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in England um vier Wochen verschoben. Die Regierung mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht, will die bisher gelockerten Regeln aber nicht zurücknehmen und nun spätestens am 19. Juli alle Restriktionen beenden. Bis dahin soll das Impfprogramm noch einmal Fahrt aufnehmen. Bisher wurden 57,8 Prozent der Erwachsenen die für den vollen Schutz notwendigen zwei Impfdosen verabreicht.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53169660-grossbritannien-hoechster-wert-an-corona-neuinfektionen-seit-februar-016.htm
Großbritannien: Einzelhändler verlieren im Mai überraschend an Umsatz – Hintergrund: Lockerungen bedingen vermehrte Bar- und Restaurant-Besuche, Lebensmittelhandel verliert nach kräftigem Anstieg im April deutlich – Einzelhändler-Umsatz insgesamt steigt dank Basiseffekt um 25 Prozent – Online-Umsätze überwiegen – dpa-AFX, 18.6.2021
Der Einzelhandel in Großbritannien hat im Mai einen überraschenden Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Gegenüber April seien die Erlöse um 1,4 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 1,5 Prozent erwartet.
Das ONS erklärt den Rückgang vor allem mit der Aufhebung von Corona-Beschränkungen, die zu vermehrten Besuchen von Bars und Restaurants geführt hätten. Im Gegenzug seien weniger Lebensmittel eingekauft worden. Die Umsätze der Nahrungsmittelbranche seien dementsprechend um 5,7 Prozent gefallen.
Der Rückgang der Gesamterlöse im Mai folgt auf einen kräftigen Anstieg im April. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Umsätze im Mai stark um fast ein Viertel. Dies ist eine Gegenreaktion auf den Umsatzeinbruch während der ersten Corona-Welle. Der Anteil von Online-Käufen sei weiter deutlich höher als vor der Pandemie, allerdings tendenziell rückläufig.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53185427-grossbritannien-einzelhaendler-verlieren-umsatz-016.htm
SCHWEIZ
Matthias Benz und Kolleg*innen: Starker Aufschwung: Die Schweizer Wirtschaft hat das Vorkrisenniveau wieder erreicht – Experten: erst 2022 wird Wirtschaft den Vor-Corona-Pfad wieder vollständig aufgenommen haben – Lockerungsschritte beflügeln – Neue Zürcher Zeitung, 15.6.2021
Der wirtschaftliche Aufschwung in der Schweiz ist in vollem Gang. Dies hatte sich bereits seit einigen Wochen abgezeichnet, nun bestätigen es die Konjunkturexperten des Bundes.
In ihren Prognosen gehen sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandprodukt, BIP) bereits jetzt kräftig wächst und dass die Aussichten für den Rest des Jahres gut bleiben. Im Jahr 2021 dürfte das Schweizer BIP um 3,6 Prozent zunehmen. Für 2022 wird ebenfalls mit einem weiteren Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet.
Die Schweizer Wirtschaft erholt sich mithin schneller als noch vor einigen Monaten erwartet. Entsprechend haben die Bundesökonomen ihre Prognosen nach oben angepasst.
Positiv gewirkt haben die Lockerungsschritte in der Schweiz, die den Menschen wieder mehr Konsummöglichkeiten gegeben haben. Dazu kommt, dass das internationale Geschäft bereits seit einigen Monaten ausgezeichnet läuft. Die exportorientierte Industrie stösst in Asien und in den USA auf eine grosse Nachfrage nach ihren Gütern.
Der Aufschwung hat eine solche Dynamik entwickelt, dass das Schweizer BIP in diesen Wochen wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben dürfte. Darauf deutet ein Echtzeit-Indikator für die wöchentliche Wirtschaftsaktivität des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hin. Anfang Juni hat die Wirtschaftsleistung wohl das Vor-Corona-Niveau um rund 1 Prozent überschritten.
Damit ist allerdings die Krise noch nicht vollständig überwunden. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Wirtschaft wieder auf den Wachstumspfad aufschliessen wird, den sie ohne Corona-Krise genommen hätte. Laut den Seco-Ökonomen dürfte dies gegen Mitte 2022 soweit sein.
Für die guten Aussichten ist es zentral, dass der Kurs der Lockerungen fortgeführt werden kann. Dann dürfte die Erholung gegen den Herbst hin an Breite gewinnen, weil auch darbende Branchen wie das Gastgewerbe oder die Veranstaltungsbranche wieder normal arbeiten können.
Bei einer weiteren Entspannung der Pandemielage dürfte zudem im Jahr 2022 der Welthandel aufblühen und der internationale Tourismus schrittweise zurückkehren. Allerdings bleiben die Risiken gross. Falls neue Virusvarianten die Lage nochmals verschärfen sollten, könnte dies den Aufschwung abwürgen. Hingegen ist auch ein noch stärkerer Boom denkbar, wenn es weltweit zu Nachholeffekten kommen sollte.
Schweizer Gastronomie: Deutlich höhere Umsätze nach der Öffnung
Dank dem jüngsten Öffnungsschritt ist die Schweizer Gastronomie zurück im Geschäft. Ein positives Bild der Lage zeigen Echtzeitdaten zum Konsum, die vom Projekt «Monitoring Consumption Switzerland» seit Beginn der Corona-Krise erhoben werden.
In der ersten Woche nach der Öffnung der Restaurant-Innenräume (31. Mai bis 6. Juni) erhöhten sich die Umsätze von Gaststätten und Cafés drastisch. Auch in der zweiten Woche (7. bis 13. Juni) wurde rege konsumiert. Laut den Daten liegen die Umsätze nun ungefähr auf dem Niveau von vergangenem Sommer, als das Coronavirus weit weg schien. …
*** Mobilität: Die Schweizer bewegen sich wieder recht normal ***
In manchen Bereichen sind die Schweizer in den vergangenen Wochen zu einer ziemlich normalen Mobilität zurückgekehrt. Besonders in der Freizeit bewegen sie sich wieder recht ungezwungen. Die Freizeitmobilität hat jüngst verschiedentlich das Vorkrisenniveau übertroffen, etwa über Auffahrt und Pfingsten. …
QUELLE: https://www.nzz.ch/wirtschaft/coronavirus-und-die-wirtschaft-daten-in-echtzeit-zeigen-erholung-ld.1561501
EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE
Andreas Kißler (WSJ): Coronakrise mit neuem Fragezeichen: Ausbreiten der Delta-Variante soll auch Thema bei EU-Gipfel sein – EU-Beziehung zu Russland und Türkei – Diskurs im inklusiven Gipfel-Format: Fortschritte im Bereich Banken und Kapitalmarktunion – DJN, 18.6.2021
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) wollen bei ihrem Gipfel am Donnerstag und Freitag kommender Woche auch über die neuen Herausforderungen bei der Coronavirus-Pandemie durch die Delta-Variante sprechen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, er sei „ganz sicher“, dass bei den Beratungen über die Corona-Pandemie auch „das Ausgreifen der Delta-Variante“ ein Thema sein werde.
Bei dem Gipfel sollen auch die Beziehungen zur Türkei und zu Russland erörtert sowie über die wirtschaftliche Erholung in den EU-Ländern gesprochen werden. „Im Anschluss an die Beratungen im März werden sie sich noch einmal mit den EU-Türkei-Beziehungen befassen, wie die seit März vorangeschritten sind“, sagte Seibert. „Sie werden die strategische Diskussion zu den EU-Russland-Beziehungen führen“, betonte Seibert zudem. Grundlage hierfür sei ein Bericht der EU-Kommission und des Außenbeauftragten.
Danach soll es bei einem Euro-Gipfel im so genannten „inklusiven Format“ mit allen 27 Staats- und Regierungschefs nach seinen Angaben vorrangig um Fortschritte in den Bereichen Bankenunion und Kapitalmarktunion gehen. Am Donnerstagmorgen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Beginn der Gipfelberatungen eine Regierungserklärung im Bundestag zu dem Gipfel abgeben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53189462-ausbreiten-der-delta-variante-soll-auch-thema-bei-eu-gipfel-sein-015.htm
Anna Hirtenstein: Neueste Entwicklung betreffend Emission der NextGenerationEU -Anleihe (NGEU): EU lässt mehrere Banken wieder zu Anleiheemissionen zu – Liste der entlasteten Banken: JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Nomura, Unicredit und Credit Agricole – Mit Geldstrafen sanktionierte Banken – DJN, 18.6.2021
Beim Anleiheemissionsprogramm der Europäischen Union sind mehrere Banken wieder zugelassen worden. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie die Sperre gegen einige Institute, die sie zuvor von Anleiheemissionen ausgeschlossen hatte, aufgehoben.
JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Nomura, Unicredit und Credit Agricole sind unter den Banken, die an künftigen Anleihetransaktionen wieder teilnehmen dürfen, wie ein EU-Vertreter mitteilte.
Die EU hatte am Dienstag erstmals eine zehnjährige sogenannte NextGenerationEU-Anleihe (NGEU) im Volumen von 20 Milliarden Euro aufgelegt. Dabei hatte sie einige der weltgrößten Kreditinstitute von dem Programm ausgeschlossen. Sie verwies auf Fälle, in denen Banken von den Behörden wegen der Teilnahme an Kartellen auf dem Anleihe- und dem Währungsmarkt bestraft wurden.
Die Banken, die jetzt wieder teilnehmen dürfen, seien am Freitag informiert worden, teilte die EU-Kommission mit. Der weitere Ausschluss an künftigen EU-Anleiheemissionen sei nicht gerechtfertigt.
Im laufenden Jahr beabsichtigt die EU, langfristige Anleihen im Volumen von 80 Milliarden Euro aufzulegen. Damit soll der Wiederaufbaufonds der EU finanziert werden. Geplant ist ferner die Ausgabe von kurzlaufenden Wertpapieren im Umfang von etlichen Milliarden. Bis Ende 2026 sollen im Rahmen von NGEU 800 Milliarden Euro bei den Investoren eingesammelt werden.
JP Morgan und Bank of America lehnten eine Stellungnahme ab. Einige der anderen Banken reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.
Die EU bezog sich bei dem Ausschluss der Banken auf vier Kartelle, die 2019 und 2021 bestraft wurden. Nomura und Unicredit mussten dieses Jahr 130 bzw 69 Millionen Euro für eine illegale Zusammenarbeit bei Staatsanleihen in der EU zahlen. Die Bank of America wurde mit 12,6 Millionen Euro zur Kasse gebeten, weil sie Preise bei Staatsanleihen koordiniert hat. Auf Credit Agricole entfielen knapp 4 Millionen Euro.
Die Deutsche Bank war Teil eines Anleihekartells. Gegen sie wurde gemäß der Kronzeugenregelung aber keine Strafe verhängt. Von der Emission wurde sie dennoch ausgeschlossen.
2019 bestrafte die EU eine Gruppe Banken, darunter Barclays, JP Morgan und Citigroup, mit 1,07 Milliarden Euro für die Manipulation des Währungsmarktes. Händler der Banken hatten sensible Informationen und Handelspläne in Chats ausgetauscht. Auch andere Banken waren an diesen Kartellen beteiligt, hatten sich aber nicht um eine Teilnahme an den Anleihetransaktionen der EU beworben.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53192657-eu-laesst-mehrere-banken-wieder-zu-anleiheemissionen-zu-015.htm
COMMENT: Sanktionen und Restriktionen hin oder her. Nun geht es um das Auftreiben von Geldern und damit Kapitalgebern für die Jumbo-hoch-3-Anleihe der EU, genannt NextGenerationEU-Anleihe (NGEU). Es soll ein Anleihevolumen von 20 Milliarden Euro emittiert werden. Vor knapp 20 Jahren rangierten Anleihen mit einem Emissionsvolumen von um die 5 Milliarden Euro als Jumbo-Anleihen. Welche Entwicklung! Um möglichst viele Käufer für die NextGeneration-Anleihe zu finden, braucht es möglichst viele seriöse Emittenten – oder zumindest solche, die mit dem Anstrich der Seriosität nachweislich umsatzstark operieren: Saubermänner und Sauberfrauen in Nadelstreifenanzügen. So wurden quasi über Nacht von EU-Gnaden sündige Banken zu weißen Schafen. Und die Moral von der Geschicht‘? Moral ist keine Wertgröße, geht es ums große Geld – und um kapitalstarke Kapitalgeber. Die Keule wartet allerdings schon hinterm Rücken: Vermögens- und Erbschaftssteuer stehen hoch im Kurs des Diskurses. Wait and see, drink a cup of tea: welch‘ interessantes Doppelspiel!
Anna Hirtenstein: Emission der NextGenerationEU-Anleihe (NGEU) im Volumen von 20 Milliarden Euro: EU schloss mehrere Großbanken von Anleiheemissionen aus – Betroffen sind u.a.: Barclays, JP Morgan, Nomura, Unicredit, Bank of America, Citigroup und Credit Agricole – DJN, 15.6.2021
Nicht alle Banken dürfen beim Anleiheemissionsprogramm der Europäischen Union mitmischen. Die EU hat einige der weltgrößten Kreditinstitute von dem massiven Programm ausgeschlossen. Sie verweist auf jüngere Fälle, in denen Banken von den Behörden wegen der Teilnahme an Kartellen auf dem Anleihe- und dem Währungsmarkt bestraft wurden.
Bei den ausgeschlossenen Banken handelt es sich unter anderem um Barclays, JP Morgan, Nomura, Unicredit, Bank of America, Citigroup und Credit Agricole, wie ein EU-Vertreter sagte.
Die Europäische Kommission prüfe, ob „die Primärhändler, die der Verletzung von Kartellrichtlinien für schuldig befunden wurden, ausreichende Zugeständnisse gemacht haben, um diese Praktiken zu beenden“, heißt es in einer Stellungnahme. Bis das abgeschlossen ist, würden diese Institute nicht zu den einzelnen syndizierten Transaktionen zugelassen.
JP Morgan, Nomura, Citigroup und Bank of America lehnten eine Stellungnahme ab. Die anderen Banken reagierten unmittelbar nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.
Die EU hat am Dienstag erstmals eine zehnjährige sogenannte NextGenerationEU-Anleihe (NGEU) im Volumen von 20 Milliarden Euro aufgelegt. Im laufenden Jahr beabsichtigt die EU, langfristige Anleihen im Volumen von 80 Milliarden Euro aufzulegen. Damit soll der Wiederaufbaufonds der EU finanziert werden. Geplant ist ferner die Ausgabe von kurzlaufenden Wertpapieren im Umfang von etlichen Milliarden. Bis Ende 2026 sollen im Rahmen von NGEU 800 Milliarden Euro bei den Investoren eingesammelt werden.
Die EU bezieht sich bei dem Ausschluss der Banken auf vier Kartelle, die 2019 und 2021 bestraft wurden. Nomura und Unicredit mussten dieses Jahr 130 bzw 69 Millionen Euro für eine illegale Zusammenarbeit bei Staatsanleihen in der EU zahlen. Die Bank of America wurde mit 12,6 Millionen Euro zur Kasse gebeten, weil sie Preise bei Staatsanleihen koordiniert hat. Auf Credit Agricole entfielen knapp 4 Millionen Euro.
2019 bestrafte die EU eine Gruppe Banken, darunter Barclays, JP Morgan und Citigroup, mit 1,07 Milliarden Euro für die Manipulation des Währungsmarktes. Händler der Banken hatten sensible Informationen und Handelspläne in Chats ausgetauscht. Auch andere Banken waren an diesen Kartellen beteiligt, hatten sich aber nicht um eine Teilnahme an den Anleihetransaktionen der EU beworben.
BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, DZ Bank, HSBC und Morgan Stanley waren an der EU-Emission am Dienstag als Lead Manager beteiligt. Danske Bank und Banco Santander fungierten als Co-Lead-Manager.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53157024-eu-schliesst-mehrere-grossbanken-von-anleiheemissionen-aus-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): Finanzminister der Europäischen Union (EU) blicken auf Freitag: Deutsches Finanzministerium sieht EU-Aufbaufonds gut im Zeitplan – 23 Länder haben ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne bereits vorgelegt – Im Fokus: wirtschaftliche Erholung in Europa, Umsetzung des EU-Wiederaufbauplanes, Stärkung der Banken-Union, Vorbereitung des 20G-Treffens Mitte Juli u.a. – Globale Mindessteuer im Blick – Kreise – DJN, 16.6.2021
Die Finanzminister der Europäischen Union (EU) wollen den Schwerpunkt ihres Treffens am Freitag in Luxemburg laut deutschen Regierungskreisen auf die Umsetzung des EU-Aufbaufonds legen, zu denen die meisten Länder bereits ihre nationalen Programme bei der EU-Kommission in Brüssel vorgelegt haben.
Eine hochrangige Offizielle aus dem Bundesfinanzministerium betonte in Berlin, „dass wir entgegen mancher Befürchtung und ganz so, wie wir es immer gehofft haben, beim Aufbaufonds in einem hervorragenden Zeitplan liegen auf europäischer Ebene“. 23 Länder hätten bereits ihre Aufbau- und Resilienzpläne vorgelegt, die Kommission habe schon für Portugal und Spanien ihre Bewertungen fertig und vier weitere sollten bald folgen. Gebe der Ministerrat ein positives Votum ab, könnten dann bereits Mittel fließen.
Laut ihrer Agenda planen die Finanzminister konkret eine Debatte über die wirtschaftliche Erholung in Europa und die Umsetzung des EU-Wiederaufbauplans. Außerdem soll das Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) vorbereitet werden, bei dem am 9. und 10. Juli in Venedig endgültig eine globale Mindeststeuer verabredet werden soll. Themen sind auch Mehrwertsteuerausnahmen für bestimmte Produkte, Krypto-Assets und die Stärkung der Bankenunion.
Die Bankenunion soll laut den Angaben aus Berlin sowohl Thema bei den Finanzminister der gesamten EU als auch am Donnerstag in der Eurogruppe sein. „Bei der Eurogruppe wird maßgeblich die Weiterentwicklung der Bankenunion auf der Tagesordnung stehen“, sagte die Offizielle. Man arbeite bereits seit vielen Monaten an einem Kompromiss, und die entscheidenden Stellschrauben seien „sehr klar identifiziert“, sagte ein anderer hochrangiger Vertreter des Ministeriums. „Wir wollen eine Einigung haben“, betonte er. Jedoch werde es am Donnerstag und Freitag wohl noch nicht in Richtung einer Einigung gehen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53167800-finanzministerium-sieht-eu-aufbaufonds-gut-im-zeitplan-kreise-015.htm
Andreas Plecko: Inflation im Euroraum steigt im Mai auf 2,0 Prozent auf Jahressicht – Jahres-Kernteuerung von 0,7 Prozent auf 1,0 Prozent angestiegen – DJN, 17.6.2021
Die Inflation in der Eurozone hat im Mai deutlich angezogen. Angetrieben durch die Energiepreise, erhöhten sich die Verbraucherpreise im Mai binnen Jahresfrist um 2,0 Prozent. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit – wie von Volkswirten erwartet – ihre erste Schätzung vom 1. Juni. Im April hatten die Lebenshaltungskosten um 1,6 Prozent zugelegt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Diese Marke wurde allerdings seit Jahren verfehlt. Die EZB rechnet damit, dass der aktuelle Preisanstieg nur vorübergehend und nicht nachhaltig ist und sich schon 2022 wieder abschwächt.
Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, stieg im Mai ebenfalls, allerdings auf einem eher niedrigen Niveau. Diese Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) erhöhte sich auf 1,0 von 0,7 Prozent; bei der ersten Schätzung war ein Anstieg auf 0,9 Prozent gemeldet worden. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.
Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Mai in der Gesamtrate um 0,3 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,2 Prozent. Die vorläufigen Daten wurden damit – wie von Volkswirten erwartet – bestätigt.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53176173-inflation-im-euroraum-steigt-im-mai-auf-2-0-prozent-015.htm
SIEHE DAZU TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53176174-tabelle-eu-verbraucherpreise-mai-nach-laendern-015.htm
Industrie in der Eurozone im April stärker erholt als erwartet – DJN, 14.6.2021
Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im April stärker gesteigert als erwartet. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, wuchs die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
Die Aussichten für den Industriesektor in der Eurozone sind positiv, da die Beschleunigung der Impfprogramme hilft, die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen zu überwinden und die Nachfrage anzukurbeln. Allerdings beeinträchtigen Lieferengpässe die Produktion in einigen Sektoren, vor allem in der Automobilindustrie, und diese Belastungen werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres nicht vollständig abklingen, sagen Ökonomen.
Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 39,3 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einer Steigerung um 37,4 Prozent gerechnet. Der außerordentlich hohe Anstieg beruht auf dem Vergleich mit den außergewöhnlich niedrigen Daten im April 2020, als die Wirtschaft inmitten der öffentlichen Gesundheitskrise in weiten Teilen zum Stillstand kam.
Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im April um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 38,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53140236-industrie-in-der-eurozone-im-april-staerker-erholt-als-erwartet-015.htm
Keine Inflation in Sicht: Wachstum der Euroraum-Arbeitskosten verlangsamt sich stark – Niedrige Lohnnebenkosten durch Steuererleichterungen und staatliche Subventionen bedingt – DJN, 16.5.2021
Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum hat sich im ersten Quartal 2021 stark verlangsamt. Nach Mitteilung von Eurostat lagen die Arbeitskosten um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals, nachdem sie im vierten Quartal 2020 um 2,8 Prozent zugelegt hatten. Die Kosten für Löhne und Gehälter pro Stunde erhöhten sich im ersten Quartal auf Jahressicht um 2,2 (viertes Quartal: 3,5) Prozent. Die Lohnnebenkosten sanken dagegen um 0,9 (plus 0,8) Prozent. Ursache der niedrigeren Lohnnebenkosten waren laut Eurostat Steuererleichterungen und Subventionen, die die Regierungen den Unternehmen in der Corona-Krise gewährten. Die Arbeitskosten sind eine wichtige Einflussgröße der Inflation.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53164101-wachstum-der-euroraum-arbeitskosten-verlangsamt-sich-stark-015.htm
Hans Bentzien: Nach drei Jahren währenden Rückgängen: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im April – Handels- und Kapitalbilanz jeweils mit positivem Saldo – Kapitalbilanz gespalten: Plus bei Direktinvestitionen, Minus bei Portfolioinvestitionen in Form von Aktien und Anleihen – DJN, 18.6.2021
Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April erstmals nach drei Rückgängen in Folge wieder gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 23 (März: 18) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss erhöhte sich auf 27 (24) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 207 (202) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 180 (178) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 8 (8) Milliarden Euro positiv.
Die Bilanz der Primäreinkommen wies einen Saldo von plus 1 (minus 2) Milliarden Euro auf, der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 13 (12) Milliarden Euro.
Bei der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis April 2021 ein positiver Saldo von 371 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis April 2020 waren es 133 Milliarden gewesen. Bei den Direktinvestitionen ergaben sich in diesem Zeitraum Nettokapitalzuflüsse von 130 (187) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen Nettokapitalexporte von 841 (21) Milliarden Euro.
Über Aktien flossen netto 245 Milliarden Euro ab, nachdem im Vorjahreszeitraum 152 Milliarden zugeflossen waren. Über Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 596 (173) Milliarden Euro.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53187064-euroraum-leistungsbilanzueberschuss-steigt-im-april-015.htm
Daniel Michaels, Andrew Restuccia und Doug Cameron: Jahrelanger Handelsstreit beendet: USA und EU setzen Boeing-Airbus-Streit aus – Strafzölle werden für fünf Jahre ausgesetzt – DJN, 15.6.2021
Die USA und die Europäische Union haben sich darauf geeinigt, ihren Handelsstreit über staatliche Subventionen für Boeing und Airbus auszusetzen. Das sei ein Zeichen für Entspannung in den Handelsbeziehungen, sagten Regierungsbeamte beider Seiten. Das Abkommen würde die Strafzölle, die von der Welthandelsorganisation genehmigt wurden, für fünf Jahre aussetzen, sagte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai zu Reportern.
Eine viermonatige Aussetzung der Zölle, die bereits in Kraft ist, wird ab dem 11. Juli verlängert werden. „Dieses Abkommen erlaubt es uns, eine neue Seite in diesem langjährigen Streit aufzuschlagen“, sagte Tai und fügte hinzu, dass die USA das Abkommen als ein Modell für die Lösung künftiger Streitigkeiten mit der EU ansehen. …
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53154100-usa-und-eu-setzen-boeing-airbus-streit-aus-015.htm
Daniel Michaels und Catherine Stupp: EU und USA vor Einigung im Boeing-Airbus-Handelsstreit – Kreise – DJN, 15.6.2021
Die Europäische Union und die USA stehen nach Angaben von Diplomaten kurz vor einer Einigung zur Beilegung ihres 17-jährigen Handelsstreits über Subventionen für Boeing und Airbus SE. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte vor dem Gipfeltreffen von EU und USA, sie sei „sehr positiv“, dass am heutigen Dienstag eine Einigung verkündet werde.
US-Präsident Joe Biden trifft am Mittag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Brüssel zusammen, um auch über Handelsfragen zu sprechen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen berichtet, dass die im März vereinbarte Friedensfrist im Boeing-Airbus-Streit über den 11. Juli hinaus verlängert wird.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53151692-eu-und-usa-vor-einigung-im-boeing-airbus-handelsstreit-kreise-015.htm
FRANKREICH
Frankreich: Inflation steigt auf höchsten Stand seit Ende 2018 – dpa-AFX, 15.6.2021
Höhere Energiepreise treiben die Inflation in Frankreich weiter an. Im Mai stiegen die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Es ist die höchste Inflationsrate seit Ende 2018. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau im Mai um 0,3 Prozent – etwas schwächer als zunächst ermittelt.
Wesentlicher Grund für den Preisauftrieb sind höhere Energiepreise. Die Entwicklung geht vor allem auf den scharfen Preiseinbruch in der ersten Corona-Welle vor einem Jahr zurück. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Energiepreise im Mai um 11,7 Prozent. Demgegenüber schwächte sich der Preisauftrieb im Dienstleistungssektor ab. Die Preise für Lebensmittel und industriell gefertigte Güter gingen sogar leicht zurück.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53150084-frankreich-inflation-steigt-auf-hoechsten-stand-seit-ende-2018-016.htm
ITALIEN
Italien / HVPI: Inflation stabil bei 1,2 Prozent – Geldentwertung nimmt im Monatsvergleich leicht ab – dpa-AFX, 15.6.2021
In Italien hat sich die Inflation entgegen ersten Zahlen nicht beschleunigt. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Mai wie im Vormonat um 1,2 Prozent auf Jahressicht gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung hatte eine Rate von 1,3 Prozent ergeben. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise leicht um 0,1 Prozent.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53151148-italien-inflation-stabil-bei-1-2-prozent-016.htm
Matthias Rüb, Rom: Italiens erloschene Leidenschaft für China – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.6.2021
Niemand im Kreis der Staats- und Regierungschefs der G7 in Cornwall habe Roms Beteiligung am chinesischen Projekt der „Neuen Seidenstraße“ ausdrücklich angesprochen, sagte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi nach dem Ende des Gipfels vor der Presse. Das war offenbar auch gar nicht nötig. Denn die in der Abschlusserklärung zum Ausdruck gebrachte kritische Haltung der G-7-Industriestaaten gegenüber Peking „spiegelt unsere eigene wider“, versicherte Draghi. Und fügte hinzu: „China ist eine Autokratie, die sich nicht an multilaterale Regeln hält und nicht die Weltsicht der Demokratien teilt.“
Beim Umgang mit einem solchen Regime müssten sich demokratische Regierungen wie jene der G-7-Staaten an drei Prinzipien halten: Zusammenarbeit, Wettbewerb und Offenheit. Wenn nicht alles täuscht, ist auf der Grundlage dieser drei Pfeiler die im März 2019 vereinbarte Teilnahme Italiens – als erstem und bisher einzigem G-7-Mitglied – am chinesischen Projekt der „Neuen Seidenstraße“ allenfalls noch in reduzierter Form möglich: begrenzte wirtschaftliche Zusammenarbeit, harter politischer und geostrategischer Wettbewerb und offene [Positionen].
QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/neue-seidenstrasse-draghi-will-projekt-mit-china-ueberpruefen-17389249.html
DEUTSCHLAND – FRANKREICH
Andrea Thomas (WSJ): Merkel und Macron im Gespräch über Rückkehr zum Stabilitätspakt in nächsten Jahren – Rückkehr zur bis 2023 ausgesetzten Defizitregel „erst in Jahren“ – Merkel: „Vor-Pandemieniveau wirtschaftlich zu erreichen, möglichst schnell.“ – Macron: Wachstum und Jobs an erster Stelle – DJN, 18.6.2021
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geben der wirtschaftlichen Erholung Europas Vorrang über eine Diskussion zur Wiedereinsetzung des Europäischen Stabilitätspakts. Erst in Jahren werde man über eine Rückkehr zu den Defizitregeln, die bis 2023 ausgesetzt sind, sprechen.
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin sagte Merkel, alle in der Europäischen Union seien sich darüber einig, dass der Stabilitätspakt, der den Staaten Grenzen bei der Verschuldung setzt, zurzeit ausgesetzt sei angesichts der außergewöhnlichen Folgen der Corona-Pandemie.
„Wir sind uns auch einig, dass wir nicht beliebig viele Schulden machen können über die Jahre, sondern dass wir vor allen Dingen Kraft für Investitionen auch brauchen“, so Merkel. „Über die Rückkehr zum Stabilitätspakt und die Frage, wie darüber diskutiert wird, wird man in den nächsten Jahren sprechen. Jetzt geht es erst mal darum, das Vor-Pandemieniveau wirtschaftlich zu erreichen, möglichst schnell.“
Das Wiederaufbauprogramm der Europäischen Union, mit dem hunderte Milliarden an Euro in die Wirtschaft gepumpt werden, ermögliche es Europa, in die Zukunft zu investieren, so die CDU-Politikerin.
*** Macron gibt Wachstum und Jobs Priorität ***
Macron sagte, die Aussetzung des Stabilitätspakts bis 2023 zeigt, dass man gemeinschaftlich Verantwortung übernommen und schnell reagiert habe angesichts der außergewöhnlichen Krise.
„Die Priorität ist jetzt keine Debatte über den Stabilitätspakt“, erklärte Macron. „Die Priorität ist, den Wiederaufbauplan, den wir gemeinsam beschlossen haben vor einem Jahr, umzusetzen und die richtigen Investitionen zu tätigen, die es uns ermöglichen werden, zukünftiges Wachstum zu schaffen.“
Es gehe darum, auf den Wachstumspfad zurückzukehren und Arbeitsplätze zu schaffen.
Frankreich favorisiert eine [wohl gemein: keine!] der Schuldenregeln. Merkels CDU setzt sich hingegen für eine Reaktivierung des Stabilitätspakts ein.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53193007-merkel-gespraeche-ueber-rueckkehr-zum-stabilitaetspakt-in-naechsten-jahren-015.htm
DEUTSCHLAND
Andreas Plecko u.a.: Deutsche HVPI-Inflation steigt im Mai deutlich auf 2,4 Prozent – Nationale Inflationsrate steigt um 0,5% auf 2,5 Prozent – Energieprodukte und CO2-Abgabe als Treiber – DJN, 15.6.2021
Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai deutlich zugenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 2,4 (Vormonat: 2,1) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit – wie von Volkswirten erwartet – ihre vorläufige Schätzung vom 31. Mai. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,3 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.
Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Für den Euroraum strebt die EZB mittelfristig knapp 2 Prozent an und rechnet für die nächsten Monate mit einem weiteren Anstieg des Inflationsdrucks. Dieser dürfte allerdings auf Sonderfaktoren beruhen und daher vorübergehend sein. Die EZB sieht die Inflation ausweislich ihrer jüngsten Stabsprojektionen 2023 bei nur 1,4 Prozent.
Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Die jährliche Inflationsrate betrug 2,5 (2,0) Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.
Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich im Mai überdurchschnittlich um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Preise für Energieprodukte lagen dabei 10,0 Prozent höher. Neben einem Basiseffekt kam auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe zum Tragen. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich um 1,5 Prozent.
Seit Anfang 2021 ist eine Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid (CO2) fällig, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Das treibt die Energiepreise nach oben. Ein zweiter Preistreiber: Die in der Corona-Krise für ein halbes Jahr gesenkte Mehrwertsteuer ist seit Januar wieder auf ihrem alten Niveau.
Nach zeitweise negativen Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte 2020 hat die Teuerung in Deutschland seit Beginn des laufenden Jahres stetig angezogen. Im März hatte die Rate bei 1,7 Prozent gelegen, im April waren es dann schon 2,0 Prozent. Von April auf Mai 2021 stiegen die Verbraucherpreise nach Angaben des Bundesamtes um 0,5 Prozent./ben/DP/bgf
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53149656-deutsche-hvpi-inflation-steigt-im-mai-deutlich-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53149632-deutschland-energie-heizt-teuerung-an-inflation-im-mai-bei-2-5-prozent-016.htm
Deutschland – Nach vorausgelaufenen stärkeren Zuwächsen im Mai höchster Zuwachs seit Herbst 2008: Erzeugerpreise steigen im Jahresvergleich weiter auf 7,2 Prozent – Experten-Erwartungen für Mai übertroffen – Wegen Lieferkettenproblemem: Vorleistungsgüter mit deutlichen Preisanstiegen – Massiv im Aufwind recycelte Metalle und Schrott – Holz und Stahl steigen auf Jahressicht um ein Drittel – Energiepreise – dpa-AFX, 18.6.2021
Der Preisauftrieb in Deutschland gewinnt weiter an Stärke. Auf Herstellerebene stieg das Preisniveau im Mai im Jahresvergleich um 7,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der höchste Zuwachs der Erzeugerpreise seit Oktober 2008. Im April hatte die Rate bei 5,2 Prozent gelegen und im März bei 3,7 Prozent.
Analysten hatten zwar mit einem stärkeren Anstieg der Erzeugerpreise gerechnet. Sie waren im Mittel aber nur von einer Rate von 6,4 Prozent ausgegangen. Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Produzenten für Waren erhalten oder bezahlen müssen, um 1,5 Prozent. In dieser Betrachtung ist der Zuwachs mehr als doppelt so stark wie erwartet.
Besonders deutliche Preiszuwächse gab es laut Statistikamt bei Vorleistungsgütern. Metallische Sekundärrohstoffe, also recycelter Schrott, war knapp 70 Prozent teurer als vor einem Jahr. Holz und Metalle verteuerten sich ebenfalls kräftig. Die Preise von Roheisen und Stahl stiegen um ein Drittel.
Die Entwicklung ist Folge zahlreicher Störungen in den internationalen Lieferketten und anderer Engpässe auf der Angebotsseite. Das Statistikamt nennt darüber hinaus die steigende Nachfrage etwa nach Stahl und Holz im In- und Ausland sowie steigende Eisenerzpreise.
Neben Vorleistungsgütern legten auch die Energiepreise deutlich zu. Dies geht zum einen auf die stark gefallenen Preise während der ersten Corona-Welle vor einem Jahr zurück. Hinzu kommt die seit Jahresbeginn geltende CO2-Abgabe.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53185426-deutschland-erzeugerpreise-steigen-weiter-staerkster-anstieg-seit-2008-016.htm
Treibhausgasneutralität bis 2045 Klimaschutz als Miet-Preistreiber gefürchtet – Die angestrebte Klimaneutralität beinhaltet verschärfte Vorgaben für Gebäude – n-tv, 16.6.2021
Der Anstieg der Mieten in Deutschlands Städten birgt sozialen Sprengstoff. Durch die Ziele im geplanten Klimaschutzgesetz könnten in den nächsten Jahren auf Mieter und Vermieter immense Mehrkosten zukommen. Ein Verband warnt nun vor einer Verschärfung der Lage.
Die deutsche Wohnungswirtschaft fordert angesichts der befürchteten hohen Kosten des Klimaschutzes mehr Geld vom Bund, um den Anstieg der Mieten zu bremsen. Der Spitzenverband GdW plädiert für eine „Klima Plus“-Förderung zusätzlich zu den bisherigen Bundeszuschüssen. „Um die extrem ambitionierten Klimaziele beim Wohnen sozial verträglich umsetzen zu können, brauchen wir ein neues, langfristiges Versprechen für bezahlbare Mieten“, sagt GdW-Präsident Axel Gedaschko.
Hintergrund ist das geplante Klimaschutzgesetz, eines der letzten Vorhaben der Großen Koalition in der zu Ende gehenden Wahlperiode. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent sinken, bis 2040 um mindestens 88 Prozent, bis 2045 soll volle Klimaneutralität erreicht sein. Das beinhaltet auch verschärfte Vorgaben für Gebäude. Der Bundestag muss das Gesetz noch verabschieden, wesentliche Änderungen der grundsätzlichen Ziele sind aber nicht zu erwarten.
*** Tausende Wohnungen müssen saniert werden ***
Der bayerische Wohnungsverband VdW geht davon aus, dass allein im Freistaat 20.000 Wohnungen pro Jahr saniert werden müssten, um diese Vorgaben zu erreichen. Auf den Bund hochgerechnet wäre das dann eine sechsstellige Zahl. Bundesweit vertritt der GdW rund 3000 Wohnungsunternehmen mit rund sechs Millionen Wohnungen. Darunter sind viele Genossenschaften und kommunale Unternehmen mit vergleichsweise günstigen Mieten. „Es muss gefördert werden, was gefordert wird“, sagt Gedaschko dazu. „Nur so lässt sich verhindern, dass der preiswerte Wohnraum in Deutschland künftig systematisch wegsaniert wird.“
Das „Klima Plus“-Konzept hat drei Bestandteile: Mieter sollen nach einem Umbau am Gebäude und unter Einberechnung der dann niedrigeren Heizkosten maximal 50 Cent Miete pro Quadratmeter mehr zahlen müssen. Der zweite Schritt sieht eine Art neuer Mietpreisbindung vor: Vermieter sollen für einen „sehr langen Zeitraum“ auf eine Begrenzung der maximal erlaubten Erhöhung von Bestandsmieten verpflichtet werden. Und der dritte Schritt beinhaltet für Wohnungsunternehmen Erleichterungen und weniger Bürokratie bei den Vorschriften für Energieerzeugung und -verbrauch. (ntv.de, sbl/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Klimaschutz-als-Miet-Preistreiber-gefuerchtet-article22623697.html
Auftragsbestand der deutschen Industrie im April auf Rekordwert – DJN, 17.6.2021
Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im April den elften Monat in Folge gestiegen und hat seinen höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Januar 2015 erreicht. Der Grund dafür ist, dass die Auftragseingänge sich stärker entwickelten als die Umsätze. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Auftragsbestand um 2,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei erhöhten sich die offenen Aufträge aus dem Inland um 2,4 Prozent, der Bestand an Auslandsaufträgen stieg um 3,2 Prozent.
Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragsbestand im April saison- und kalenderbereinigt um 11,4 Prozent höher.
Die Reichweite des Auftragsbestands betrug im April 7,0 (März: 7,1) Monate. Selbst wenn die Auftragseingänge abrupt stoppen würden, könnten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes im Durchschnitt für diese Zeitspanne weiter produzieren.
Besonders gut gefüllt sind die Auftragsbücher bei den Herstellern von Investitionsgütern. Bei ihnen reicht der Auftragsbestand 9,5 Monate. Bei denen von Vorleistungsgütern liegt die Reichweite nur bei 3,9 Monaten, bei den Herstellern von Konsumgütern nur bei 3,1 Monaten.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53173853-auftragsbestand-der-deutschen-industrie-im-april-auf-rekordwert-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): DIW hebt deutsche Wachstumsprognose leicht an: 2021e +3,2 Prozent, 2022e +4,3 Prozent – Immer Mehr Menschen geimpft und sinkende Indizdenzen sorgen für beginnende Wirtschaftsnormalisierung – Langer Weg zur Erholung: Pandemie könnte dennoch für Rückschläge sorgen – DJN, 17.6.2021
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet mit 3,2 Prozent für dieses und 4,3 Prozent für nächstes Jahr ein etwas höheres Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) als noch im Frühjahr. „Nach langen coronabedingten Lockdowns erwacht die deutsche Wirtschaft nach und nach aus ihrem Winterschlaf“, erklärte das Institut in Berlin. Mitte März hatte das DIW ein Wachstum von 3,0 Prozent für 2021 und 3,8 Prozent für 2022 vorhergesagt.
Da immer mehr Menschen geimpft seien und die Infektionszahlen fielen, könnten viele Branchen wieder auf einen normaleren Geschäftsbetrieb hoffen, allen voran die gebeutelten Dienstleister etwa in der Kultur- und Veranstaltungsbranche und die Reiseveranstalter, erklärte das Institut in seiner neuen Prognose. Die Industrie, die besser durch die vergangenen Monate gekommen sei als während des ersten Lockdowns im Vorjahr, werde hingegen durch die sich zuspitzende Knappheit von Rohstoffen und anderen Vorleistungsgütern gebremst.
Die Erhöhung der Prognose sollte laut DIW „aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Weg bis zur Bewältigung der Pandemiefolgen weit ist und immer wieder mit Rückschlägen gerechnet werden muss“. Bis zum Jahresende dürften seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland rund 230 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren gegangen sein. Beziehe man mit ein, dass die Wirtschaftsleistung ohne die Pandemie in diesem Zeitraum wahrscheinlich um etwa 2,5 Prozent gewachsen wäre, summiere sich der Gesamtschaden sogar auf etwa 350 Milliarden Euro – rund 10 Prozent des BIP.
Die wirtschaftliche Entwicklung bleibe vorerst durch die Corona-Pandemie bestimmt. Zum einen müsse davon ausgegangen werden, dass die Infektionszahlen im Zuge der Lockerungen und möglicher neuer Virusmutationen zumindest regional und vorübergehend wieder steigen. Neuerliche Einschränkungen, um das Pandemiegeschehen unter Kontrolle zu halten, seien dann zu erwarten. Hinzu komme, dass zunehmend Pandemiefolgen eine Rolle spielten, die nicht unmittelbar auf das Infektionsgeschehen zurückzuführen seien. Zum einen sei die Produktion wichtiger Rohstoffe heruntergefahren worden, zum anderen habe sich die Nachfrage teils drastisch verschoben.
*** Arbeitslosigkeit geht zurück ***
Nachdem die Insolvenzmeldepflicht nicht länger ausgesetzt ist, erwartet das DIW nun mehr Insolvenzen von Unternehmen. „In den nächsten Monaten werden viele Unternehmen wohl doch noch den Weg zum Amtsgericht antreten müssen“, erklärte das Institut. Dies könnte den Arbeitsmarkt noch merklich belasten. Bis dato sei er aber gut durch die Krise gekommen. Die Zahl der Arbeitslosen soll laut der Prognose auf 2,666 Millionen in diesem und 2,327 Millionen im kommenden Jahr sinken, was Arbeitslosenquoten von 5,8 und 5,1 Prozent entspricht.
Das helfe dem privaten Konsum, der auch durch die im Prognosezeitraum insgesamt moderate Inflation gestützt werde. Sie werde mit 2,7 Prozent 2021 zwar vorübergehend höher ausfallen, schon 2022 aber auf 1,8 Prozent sinken, sodass es „keinen Grund zur Sorge vor gesamtwirtschaftlichen Gefahren durch stark steigende Preise gibt“. Für die privaten Konsumausgaben veranschlagt das DIW ein Plus von 0,8 Prozent dieses und 8,3 Prozent kommendes Jahr und für die Ausrüstungsinvestitionen Steigerungen um 9,9 Prozent und 4,7 Prozent. Die Exporte nehmen demnach dieses Jahr um 10,1 Prozent zu und nächstes um 6,6 Prozent, die Importe wachsen um 10,6 Prozent und 10,0 Prozent.
„All das steht aber auf wackligen Beinen, solange die Corona-Pandemie nicht nachhaltig eingedämmt ist“, warnte das DIW. In dieser Situation schon bald zu ausgeglichenen öffentlichen Haushalten zurückzukehren, wäre „verfrüht“ – trotz eines gesamtstaatlichen Defizits von knapp 161 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Denn neben den Pandemiefolgen seien auch strukturelle Veränderungen wie die demografische Wende und der Umbau zu einer klimaschonenderen Wirtschaft zu bewältigen.
„Die deutsche Wirtschaft wird voraussichtlich einen guten Sommer erleben, aber sie ist noch nicht über den Berg“, erklärte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Rückschläge seien jederzeit möglich, vor allem ab dem Herbst. Die Politik müsse sich jetzt vorbereiten, um vergangene Fehler wie eine unklare Kommunikation und eine teils nicht transparente Vorgehensweise dann nicht zu wiederholen. „Der bevorstehende Wahlkampf und so manche Forderungen und Ansichten sollten nicht in die Irre führen“, mahnte er. Es wäre beispielsweise nicht angemessen, jetzt auf einer schnellen Rückkehr zur schwarzen Null zu beharren – und es sei „unredlich, vor der angeblich großen Inflation zu warnen“.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53176175-diw-hebt-deutsche-wachstumsprognose-leicht-an-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): IfW: Selbsttragender Aufschwung in Deutschland mit 2021e + 3,9 Prozente, 2022e +4,8 Prozent – Preissteigernde Produktionshemmnisse bremsen Aufschwung – Gute Auftragslage gedämpft durch Lieferengpässe – Aufgestaute Kaufkraft treibt Wirtschaft, aber auch Preise an – Unterjährige Teuerung bis zu 4 Prozent möglich, im Gesamtjahr milder mit 2021e + 2,6 Prozent, 2021e +1,9 Prozent – Teuerung: nächste Eurokrise droht – DJN, 17.6.2021
Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat in seiner jüngsten Konjunkturprognose die Erwartung angehoben und sieht nun für 2021 einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,9 anstatt 3,7 Prozent und für 2022 um 4,8 Prozent. „Die deutsche Wirtschaft erholt sich kräftig und dürfte im dritten Quartal wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen“, erklärte das Kieler Institut. „Der Aufschwung in Deutschland ist selbsttragend“, hob IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths hervor. „Es besteht keinerlei Anlass zu weiteren Konjunkturprogrammen, zumal die in der Krise gewährten Hilfen noch nachwirken.“
Produktionshemmnisse ständen einem noch stärkeren Aufschwung im Wege, was die Preise treibe. Mit dem Abklingen der Pandemie dürften vor allem der Handel und kontaktintensive Dienstleistungen wie das Hotel- und Gastronomiegewerbe von einem Erstarken der privaten Konsumausgaben profitieren, die 2021 um 2,4 Prozent und 2022 um 8,2 Prozent zulegen dürften. Die Erholung in der Industrie sei dagegen trotz sehr guter Auftragslage momentan durch Lieferengpässe gehemmt, die sich erst nach und nach auflösen dürften, wodurch erst gegen Ende des Jahres neuer Schub entstehe.
„Der deutsche Konjunkturkessel steht unter Dampf. Eine durch aufgestaute Kaufkraft und staatliche Konjunkturprogramme zusätzlich angefachte Nachfrage trifft auf ein auch durch Lieferengpässe limitiertes Angebot“, konstatierte Kooths. Alles in allem ständen die Zeichen auf kräftige Expansion. Dies treibe aber dort die Preise, wo Produktionskapazitäten noch nicht mit der anziehenden Nachfrage Schritt halten könnten.
Unterjährig könnten die Teuerungsraten bis zu 4 Prozent erreichen. Im Gesamtjahr 2021 dürfte die Inflation 2,6 Prozent und 2022 dann 1,9 Prozent betragen. Bei den privaten Haushalten hätten sich in der Pandemie 200 Milliarden Euro Kaufkraft aufgestaut, von denen sich aber wohl nur ein kleiner Teil in nachholenden Käufen entladen werde. „Greifen die Konsumenten stärker auf ihr Finanzpolster zurück, wird das die Inflation noch weiter befeuern“, warnte Kooths. Hierin liege kurzfristig die größte Gefahr für die Preisstabilität.
*** Nächste Eurokrise könnte drohen ***
„Wir werden uns an höhere Teuerungsraten gewöhnen müssen, selbst wenn die Sondereffekte der Pandemie vorbei sind“, erklärte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr. „Auch weil die Europäische Zentralbank nicht durch höhere Zinsen gegensteuern kann, ohne die Stabilität in hoch verschuldeten Ländern wie Italien zu gefährden.“ Laufe die Inflation tatsächlich aus dem Ruder und zwinge die EZB zum Handeln, „steht uns die nächste Eurokrise ins Haus“.
Die kräftige Erholung der deutschen Wirtschaft helfe auch dem Arbeitsmarkt auf die Sprünge. Die Arbeitslosenquote dürfte von 5,8 Prozent 2021 auf 5,3 Prozent 2022 sinken und damit fast wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen. Die öffentlichen Haushalte dürften am Jahresende ein Minus von über 175 Milliarden Euro verbuchen, fast 5 Prozent in Relation zum BIP. Deutschlands Schuldenstand steige damit auf 70 Prozent. Im nächsten Jahr dürfte das Defizit dann auf gut 52 Milliarden Euro und damit 1,4 Prozent des BIP zurückgehen und der Schuldenstand auf 67 Prozent sinken.
Die Exporte dürften 2021 um 11,2 Prozent zulegen, 2022 dann um 5,8 Prozent. Deutschlands Leistungsbilanzsaldo geht nach den Berechnungen des IfW bis 2022 auf 6,4 Prozent zurück, auch weil sich die Importe deutlich verteuern. Die Unternehmensinvestitionen erholen sich demnach zügig und steigen um 4,3 Prozent 2021 und 5,2 Prozent 2022. Besonders die Bauwirtschaft sei gegenwärtig aber durch Materialengpässe limitiert, die sich vor allem in höheren Preisen niederschlügen.
Kooths betonte, in der Pandemie habe der Infektionsschutz wirtschaftlich auf die Bremse gedrückt, während der Staat fiskalisch Vollgas gegeben habe. Bereits das Lockern der Bremse sorge „nun für einen Kick-Start der Binnenwirtschaft“, und die Industrie kämpfe nach dem kräftigen Aufholspurt seit Jahresbeginn mit Lieferengpässen. „Um eine Überhitzung zu verhindern, sollte die Geld- und Finanzpolitik spätestens im kommenden Jahr den Fuß vom Gas nehmen“, mahnte der IfW-Konjunkturchef.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53176329-ifw-selbsttragender-aufschwung-in-deutschland-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): RWI: Deutsche Konjunktur nimmt wieder Fahrt auf: Wachstum 2021e+3,7 Prozent, 2022e +4,7 Prozent – Gering sinkende Arbeitslosenquote von 2021e 5,8 Prozent auf 2022e 5,7 Prozent – Relativ „schwache“ Inflation erwartet: 2021e 2,5 Prozent, 2022e 1,9 Prozent – Öffentliche Haushalte fallen von 160 Mrd 2020e auf 68 Mrd 2021e – Lieferengpässe bremsen, Dienstleistungserholung beflügelt – Erfolgreiche Pandemiebekämpfung als Erholungsfaktor – Zunahme der Konsumnachfrage bereits in 2021Q2e – DJN, 17.6.2021
Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr leicht von 3,6 auf 3,7 Prozent erhöht. Für das kommende Jahr geht es von einem Plus von 4,7 Prozent statt 3,0 Prozent aus, teilte das Institut in Essen mit. Die Arbeitslosenquote dürfte dieses Jahr 5,8 Prozent und im kommenden Jahr 5,2 Prozent betragen. Die Inflation dürfte in diesem Jahr bei 2,5 Prozent liegen, im kommenden Jahr bei 1,9 Prozent. Die Defizite der öffentlichen Haushalte dürften in diesem Jahr und 2022 nach den Berechnungen der Ökonomen voraussichtlich 160 respektive 68 Milliarden Euro betragen.
„Die Erholung von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie findet vor allem in diesem Jahr statt“, erklärte das Institut. Das BIP werde das Vorkrisenniveau voraussichtlich zum Ende dieses Jahres erreichen. Insbesondere in den Dienstleistungsbereichen habe nach den Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen eine Erholung eingesetzt, die der Konjunktur Impulse geben dürfte. Hingegen sei zu erwarten, dass das Produzierende Gewerbe zunächst noch durch die zunehmenden Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten ausgebremst werde.
„Die Konjunktur in Deutschland nimmt im Zuge der Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen wieder Fahrt auf“, sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. Hierfür sei derzeit vor allem die Erholung in den Dienstleistungsbereichen verantwortlich. „Wirtschaftsleistung und privater Konsum dürften bis zum Jahresende das Vorkrisenniveau erreichen.“
Mit den inzwischen gesunkenen Infektionszahlen und den sehr weitreichenden Lockerungen sei zu erwarten, dass die private Konsumnachfrage bereits im zweiten Quartal wieder deutlich steigt. Zum Jahreswechsel dürfte dann das Vorkrisenniveau überschritten werden. Am Arbeitsmarkt dürfte im weiteren Verlauf des Jahres die Zahl der Menschen in Kurzarbeit rasch zurückgehen und bereits im dritten Quartal das Vorkrisenniveau erreichen. Die Arbeitslosenquote dürfte im aktuellen Jahr leicht auf 5,8 Prozent sinken. 2022 dürfte sie dann deutlich auf 5,2 Prozent zurückgehen.
Die Verbraucherpreise seien seit Beginn dieses Jahres deutlich angestiegen und dürften zunächst hoch bleiben. Bedeutend für die Preisentwicklung im Prognosezeitraum dürfte vor allem sein, dass durch die Lieferengpässe bei einigen Rohstoffen und Vorprodukten die Preise dieser Güter zum Teil erheblich angestiegen seien. Das gelte insbesondere für die Großhandelspreise für Rohstoffe und Vorprodukte, wie Erze, Metalle sowie Roh- und Schnittholz.
Diese Engpässe dürften nur allmählich beseitigt werden, der durch sie ausgelöste Preisdruck mit abnehmender Wirkung noch bis Ende des Jahres bestehen bleiben. Für dieses Jahr erwartet das RWI daher im Durchschnitt eine Inflationsrate von 2,5 Prozent. Im kommenden Jahr dürfte die Teuerung durchschnittlich 1,9 Prozent betragen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53176176-rwi-deutsche-konjunktur-nimmt-wieder-fahrt-auf-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): IMK: Wirtschaftsboom fast 20 Mal wahrscheinlicher als Rezession – Prognose: Konjunkturaufschwung nimmt mit zunehmender Durchimpfungsrate an Breite und Stärke zu – Hoher Nachfragerückstau der Privathaushalte – DJN, 16.6.2021
Die Erholung der deutschen Wirtschaft von der Coronavirus-Krise setzt sich fort, die Aussichten auf einen sehr kräftigen Aufschwung in diesem Jahr haben sich zuletzt weiter verbessert. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Wahrscheinlichkeit für ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum, die der Indikator als „Boomwahrscheinlichkeit“ ausweise, sei aktuell fast 20 Mal so hoch wie das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft demnächst in eine Rezession geraten könnte, hob das Institut hervor.
Konkret zeigt der Indikator für den Drei-Monats-Zeitraum von Juni bis Ende August eine mittlere Boomwahrscheinlichkeit von 71,3 Prozent an, während die Rezessionswahrscheinlichkeit nur 3,7 Prozent beträgt. Im Vergleich zum Mai sei die Boomwahrscheinlichkeit um 5,6 Prozentpunkte gestiegen und die Rezessionswahrscheinlichkeit um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Die statistische Streuung im Indikator, ein Maß für die Unsicherheit von Wirtschaftsakteuren, hat um einen Prozentpunkt auf 4,2 Prozent zugenommen, bleibt aber auf einem historisch niedrigen Niveau. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator zeigt laut IMK „grün“.
Die Ökonomen betonten, die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators stützten die Prognose, dass der Konjunkturaufschwung in Deutschland mit zunehmender Zahl geimpfter Personen an Breite und Stärke gewinnen werde. Denn neben dem schon seit längerem sehr starken Außenhandel lege mit zunehmender Lockerung der Auflagen zum Infektionsschutz auch die Binnennachfrage deutlich zu. „Dabei wird insbesondere der private Konsum aufgrund eines gewaltigen Nachholbedarfs eine hohe Dynamik entfalten“, sagte IMK-Konjunkturexperte Peter Hohlfeld.
Wichtigster Faktor für die weitere Aufhellung der konjunkturellen Aussichten sei in den vergangenen Wochen die verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Von den Finanzmärkten kämen eher positive, aber nicht ganz einheitliche Signale. Dass die Industrieproduktion nach den aktuellsten verfügbaren Daten im April leicht zurückgegangen sei, bremse den Aufwärtstrend des Indikators nur geringfügig. Temporäre Lieferengpässe bei einigen Rohstoffen und Mikrochips als Ursache dafür dürften nach Analyse des IMK im weiteren Jahresverlauf nachlassen.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53163977-imk-wirtschaftsboom-fast-20-mal-wahrscheinlicher-als-rezession-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): Ifo senkt deutsche BIP-Prognose 2021 von 3,7 Prozent auf 3,3 Prozent ab – Prognoseanhebung für 2022 um 1,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent – Inflation 2021e +2,6 Prozent, 2022e auf 1,9 Prozent – Boom bei Konsumausgaben für 2022e mit +7,2 Prozent – Ausrüstungsinvestitionen hoch im Kurs mit +8,6 Prozent, 2022e +6,8 Prozent – Sinkende Arbeitslosenquoten: 2021e +5,8 Prozenht, 2022e +5,2 Prozent – Lockere Geldpolitik wird vorerst bleiben – Öffentlicher Haushalt mit grö0erem Finanzierungsloch 2021e von 150,4 Mrd. Euro (2020: 149,2 Mrd Euro), das 2022e stark auf 49,6 Mrd zusammenschrumpft – 2021e+2022e: Exporte-Zuwächse +10,4 und +5,6 Prozent, Importe +11,4 Prozent und +7,3 Prozent – Unter kritscher EU-Marke von 6 Prozent: deutscher Leistungsbilanzüberschuss sinkt von 231 über 206 auf 184 Milliarden Euro oder von 7,0 über 5,8 auf 4,9 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung – DJN, 16.6.2021
Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2021 gesenkt, die Vorhersage für 2022 aber deutlich angehoben. Die Ökonomen erwarten für dieses Jahr nun 3,3 Prozent Wachstum und damit 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im März. Dafür erhöhten sie ihre Vorhersage für das kommende Jahr um 1,1 Punkte auf 4,3 Prozent. „Kurzfristig dämpfend wirken vor allem die Engpässe bei der Lieferung von Vorprodukten“, erklärte der Leiter der Ifo-Prognosen, Timo Wollmershäuser.
„Die an sich kräftige Erholung, ausgelöst durch die Öffnungen, verschiebt sich etwas weiter nach hinten, als wir noch im Frühjahr erwartet hatten“, fügte er hinzu. Die Kosten der Corona-Krise für die Jahre 2020 bis 2022 beliefen sich auf 382 Milliarden Euro. Dabei werde angenommen, dass die deutsche Wirtschaft in der Zeit mit durchschnittlich 1,2 Prozent im Jahr gewachsen wäre.
Nach der Prognose werden die privaten Konsumausgaben 2021 um 1,6 Prozent und 2022 um 7,2 Prozent zulegen. Die Ausrüstungsinvestitionen erhöhen sich demnach dieses Jahr um 8,6 Prozent und nächstes um 6,8 Prozent. Mit der kräftigen Erholung dürfte die Zahl der Kurzarbeiter, die noch 2,3 Millionen im Mai betrug, rasch sinken und kommendes Jahr ihr Vorkrisenniveau erreichen, das bei etwa 100.000 lag. Die Zahl der Arbeitslosen dürfte auf 2,649 Millionen in diesem und 2,405 Millionen im kommenden Jahr sinken, was Arbeitlosenquoten von 5,8 Prozent und 5,2 Prozent entspricht.
Die Inflationsrate wird sich nach der Prognose vorübergehend beschleunigen, von plus 0,6 Prozent beim deutschen Verbraucherpreisindex (VPI) im vergangenen Jahr auf plus 2,6 Prozent in diesem. Dazu trügen vor allem höhere Energiepreise und die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer bei. Die Kerninflationsrate dürfte bei 2,1 Prozent liegen. Danach flache sich der Anstieg der Verbraucherpreise wieder ab auf plus 1,9 Prozent im Jahre 2022, für die Kerninflationsrate werden 1,7 Prozent angenommen.
*** Kein Anziehen geldpolitischer Zügel ***
Die Geldpolitik dürfte im Prognosezeitraum nach Erwartung der Ifo-Forscher „die Finanzierungsbedingungen weiterhin günstig halten, ohne jedoch neue Impulse setzen zu können“. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe zuletzt ihre Ansicht bekräftigt, dass es sich bei dem jüngsten Inflationsanstieg nur um ein temporäres Phänomen handeln dürfte und daher ein Anziehen der geldpolitischen Zügel nicht bevorsteht.
Bei einer etwaigen Straffung dürften zunächst die Anleiheankäufe im Rahmen des Programms PEPP zurückgefahren werden. So würden die Leitzinsen der EZB wohl auf absehbare Zeit an ihrer Untergrenze verharren. Im Prognosezeitraum dürften die Zinsen an den Kredit- und Kapitalmärkten im Einklang mit der wirtschaftlichen Erholung und steigenden Inflationserwartungen moderat anziehen. So dürfte sich die Umlaufrendite zehnjähriger Bundesanleihen bald wieder im positiven Bereich bewegen.
Das Finanzierungsloch des Staates weitet sich im Wahljahr 2021 laut der Prognose zunächst noch geringfügig auf 150,4 Milliarden Euro aus – von 149,2 im vergangenen Jahr. Im kommenden Jahr werde es voraussichtlich auf 49,6 Milliarden Euro zurückgehen. Das hänge aber vom Wahlergebnis ab, erklärte das Institut.
Der Außenhandel wird laut Ifo deutlich zulegen. Die Konjunkturforscher prognostizieren für die Exporte Zuwächse von 10,4 und 5,6 Prozent, die Importe sollen um 11,4 Prozent und 7,3 Prozent steigen. Daher schrumpfe der viel kritisierte Überschuss der deutschen Leistungsbilanz von 231 über 206 auf 184 Milliarden Euro – 7,0 und 5,8 sowie 4,9 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung. Damit läge er erstmals seit Jahren unter der Marke von 6,0 Prozent, die die EU für kritisch hält.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53163469-ifo-senkt-deutsche-bip-prognose-2021-hebt-prognose-fuer-2022-an-015.htm
Andreas Kißler (WSJ): IWH: Konjunkturaussichten im Sommer günstig – BIP 2021e +3,9 Prozent, 2022e + 4 Prozent – Lockerungen beflügeln insbesondere Dienstleistungsbranchen – Privatkonsum dürfte in kommenden Monaten stark anziehen – Ausrüstungsnvestitionen im Aufwind – Leferkettenprobleme als Bremse – Restrisiko: neuerliche Pandemie-Restriktionen – DJN, 15.6.2021
Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 3,9 Prozent und im Jahr 2022 um 4,0 Prozent zunehmen wird. „Im Sommer sind die konjunkturellen Aussichten in Deutschland günstig“, erklärten die Ökonomen. „Weil die Pandemie auf dem Rückzug ist, dürften die Restriktionen, die die Aktivität in vielen Dienstleistungsbranchen behindert haben, nach und nach aufgehoben werden, und es ist mit einem kräftigen Schub bei den privaten Käufen zu rechnen.“
Im Sommer 2021 expandiere die weltwirtschaftliche Produktion kräftig. Allerdings sei die Weltindustrieproduktion zuletzt nicht mehr weiter gestiegen. Dies liege an vielerlei Engpässen bei der Produktion und an fehlenden Transportkapazitäten. Höhere Preise, zumal für Rohstoffe, hätten die Inflationsraten zuletzt deutlich steigen lassen. Die Geldpolitik bleibe aber, ebenso wie die Finanzpolitik, in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften expansiv.
In Deutschland werde der private Konsum im Zuge der Normalisierung des Wirtschaftslebens in den kommenden Monaten stark anziehen. „Davon profitieren insbesondere der Einzelhandel, das Gastgewerbe und andere Anbieter von Freizeitaktivitäten.“ Erwartet wird ein Zuwachs des privaten Konsums 2021 um 2,4 Prozent und 2022 um 7,4 Prozent. Von der Auslandsnachfrage nach Produkten des Verarbeitenden Gewerbes kämen ebenfalls kräftige Impulse.
*** Kapazitäten Ende 2022 wieder normal ausgelastet ***
Für die Ausrüstungsinvestitionen sehen die Ökonomen dieses Jahr ein Plus von 11,4 Prozent und nächstes von 6,3 Prozent. Allerdings bremsten auch in Deutschland Lieferengpässe im Verarbeitenden Gewerbe das Expansionstempo. Es dürfte nach Einschätzung des IWH bis Ende 2022 dauern, bis die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten wieder normal ausgelastet sind. Für die Exporte sieht das IWH dieses Jahr einen Zuwachs von 11,1 Prozent und kommendes von 6,7 Prozent und für die Importe Steigerungen um 12,0 Prozent und 9,2 Prozent.
Die Beschäftigungslage werde sich schon im zweiten Quartal 2021 leicht verbessern, und die registrierte Arbeitslosigkeit nehme im Verlauf des Jahres 2021 weiter ab. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt nach der Prognose 2022 auf 2,592 Millionen und 2023 auf 2,301 Millionen, was Arbeitslosenquoten von 5,7 Prozent und 5,0 Prozent entspricht.
Die Teuerung werde auch in den nächsten Monaten vor allem wegen Basiseffekten beim Erdölpreis deutlich oberhalb der Marke von 2 Prozent liegen. Weil die Finanzpolitik im Jahr 2021 nochmals expansiv ausgerichtet sei, steige das gesamtstaatliche Budgetdefizit trotz wirtschaftlicher Erholung von 4,5 Prozent in Relation zum BIP auf 5,1 Prozent. Im Jahr 2022 gehe es deutlich auf 1,4 Prozent zurück.
„Ein Abwärtsrisiko für die Konjunktur in Deutschland ist die Möglichkeit, dass sich das Leben zu einem Zeitpunkt normalisiert, zu dem die Herdenimmunität noch nicht erreicht ist und die Pandemie in der Folge im Sommer noch einmal aufflammt“, sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller. „Dadurch könnte der Aufholprozess erneut verzögert werden.“ Zudem könnten Lieferengpässe das Verarbeitende Gewerbe noch stärker belasten. Ein Aufwärtsrisiko stelle die Möglichkeit dar, dass ein größerer Teil der in der Krise angesparten Einkommen verausgabt werde. Höhere Produktionszuwächse und eine stärkere Preisdynamik wären die Folge.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53152725-iwh-konjunkturaussichten-im-sommer-guenstig-015.htm
Deutscher Einzelhandelsumsatz für April nach unten revidiert – Umsatzplus von 7,2 Prozent auf Jahressicht – DJN, 15.6.2021
Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im April schwächer entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 6,8 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt nur ein Rückgang von 5,5 Prozent gemeldet worden.
Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 7,2 Prozent höher.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155514-deutscher-einzelhandelsumsatz-fuer-april-nach-unten-revidiert-015.htm
Hans Bentzien u.a.: Bundesnotbremse lässt deutschen Gastgewerbeumsatz im April sinken – Fast minus 70% geringerer Umsatz im Vergleich zum Februar 2020 – Hotel, Beherbungsbetriebe, Gastronomie und Caterer litten nach schwacher Belebung im März weiter – April: auch Produktion und Einzelhandel insgesamt sanken, geringer Exportanstieg – DJN(dpa-AFX, 18.6.2021
Der Umsatz im Gastgewerbe Deutschlands ist zu Beginn des zweiten Quartals deutlich zurückgegangen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er gegenüber dem Vormonat März um 6,3 Prozent und lag um 24,2 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Das Niveau von Februars 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, wurde um 68,9 Prozent verfehlt.
Damit setzt sich die Reihe schwacher Konjunkturdaten für das zweite Quartal fort. Auch Einzelhandelsumsätze (minus 6,5 Prozent) und Produktion (minus 1,0 Prozent) waren im April gesunken. Für die Exporte wurde hingegen ein Anstieg von 0,3 Prozent gemeldet. Die Unternehmensumfragen für Mai zeigten das Bild einer Wirtschaft, dessen Dienstleistungssektor wieder zu wachsen beginnt, während der Boom in der Industrie von Materialknappheit gedämpft wird.
Im Bereich der Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen setzte sich die positive Entwicklung des Vormonats im April nicht fort: Der reale Umsatz sank um 10,8 Prozent – „Ursächlich für den Rückgang dürften die ‚Bundesnotbremse‘ und das Beherbergungsverbot zu touristischen Zwecken, auch über Ostern, sein“, merkten die Statistiker an. Gegenüber April 2020, als der Umsatz drastisch eingebrochen war, stieg der reale Umsatz allerdings um 32,8 Prozent.
Auch die Gastronomie wurde im April durch die weitreichenden Corona-Schutzmaßnahmen ausgebremst: Der reale Umsatz fiel im Vormonatsvergleich um 5,5 und lag um 22 Prozent über Vorjahresniveau. Innerhalb der Gastronomie stieg der Umsatz der Caterer um 2,6 Prozent auf Monats- und um 17,1 Prozent auf Jahressicht.
In nominaler Betrachtung gab es nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ein Minus von 6,5 Prozent.
Im Vergleich zum April 2020, dem ersten voll von der Pandemie in Deutschland betroffenen Monat, lagen die Umsätze im Gastgewerbe real um 24,2 Prozent und nominal um 27,9 Prozent höher. Die Branche ist jedoch weiterhin weit entfernt vom Vorkrisenniveau: Die Umsätze im April blieben real um 68,9 Prozent unter dem Niveau des Februars 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.
QUELLEN:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53185758-bundesnotbremse-laesst-deutschen-gastgewerbeumsatz-im-april-sinken-015.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53185544-deutschland-corona-einschraenkungen-bremsen-erholung-im-gastgewerbe-016.htm
Nach außerordentlich starkem März: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschand fällt im April stark – DJN, 15.6.2021
Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im April gegenüber dem Vormonat stark gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 29.637 Wohnungen genehmigt. Das waren 22,9 Prozent weniger als im außerordentlich starken März. Für den Zeitraum Januar bis April ergab sich ein Anstieg um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im April 25.449 Wohnungen genehmigt. Dies waren 25,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser ist um 43,0 Prozent, für Zweifamilienhäuser um 33,3 Prozent gesunken.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53149727-zahl-der-baugenehmigungen-in-deutschand-faellt-im-april-stark-015.htm
Andrea Thomas (WSJ), Chun Han Wong: Deutsche Industrie besorgt über chinesisches Gesetz gegen Sanktionen – EU-China-Investitionsabkommens liegt derzeit auf Eis – DJN, 15.6.2021
Die deutsche Industrie zeigt sich besorgt über das neue chinesische Gesetz gegen ausländische Sanktionen. Wirtschaftliche Aktivitäten drohten zum Minenfeld zu werden. Das Gesetz komme zur Unzeit, erklärte Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, forderte, dass Europa die Naivität gegenüber China ablegen und mit Gegenmaßnahmen reagieren müsse.
Der BDI betonte, die Ratifizierung des EU-China-Investitionsabkommens liege bereits auf Eis, nachdem China Sanktionen gegen EU-Parlamentarier und Think Tanks erhoben habe. Besser als Drohgebärden wäre es, wenn die chinesische Regierung mehr konstruktive Elemente in den Dialog mit ihren Handelspartnern einbrächte.
„Anstatt auf Deeskalation zu setzen, schafft die chinesische Regierung neue Unsicherheit. Das schadet Chinas Ruf als Investitionsstandort und Handelspartner“, sagte Niedermark. „Anstatt rechtliche Klarheit zu garantieren, wird das Gesetz zum Damoklesschwert für jedes Unternehmen, das in und mit China Geschäfte macht. Alle Aktivitäten im Ausland, die im Widerspruch mit Chinas wirtschaftlichen und politischen Interessen stehen, werden dadurch zum Minenfeld erklärt.“ Leidtragende wären die Unternehmen, die immer Gefahr liefen, zwischen die Mühlsteine zu geraten.
Zuvor ist in China ein neues Gesetz in Kraft getreten, das der Regierung mehr Instrumente gegen ausländische Sanktionen in die Hand gibt. Es ist eine Antwort auf Maßnahmen der USA und Europa, Peking in Bereichen wie Menschenrechten, Handel und Technologie unter Druck zu setzen. …
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53152152-deutsche-industrie-besorgt-ueber-chinesisches-gesetz-gegen-sanktionen-015.htm
Andrea Thomas (WSJ): Ifo gegen Rückverlagerung von Produktion nach Deutschland, gegen staatliche Eingriffe in Lieferketten – Alternative: Bezugsquellen international diversifizieren, Vertiefung des EU-Binnenmarktes, Stärkung der WHO – Offene Weltmärkte garantieren deutschen Wirtschaftserfolg – Export der deutschen Wertschöpfung ins Ausland hoch – Aufbau strategischer Reserven erhöhen Versorugungssicherheit – Integrationspotenzial bei grenzüberschreitendem Warenverkehr opimaler gestalten – Schaffung eines vollständig integrierten europäischen Marktes für digitale Leistungen bedeutsam – DJN, 15.6.2021
Das Ifo Institut ist gegen eine allgemeine Rückverlagerung von Produktion nach Deutschland und gegen staatliche Eingriffe in Lieferketten. Als Alternative schlägt das Münchner Institut vor, die Bezugsquellen der deutschen Wirtschaft international vielfältiger zu machen. Dazu müssten der EU-Binnenmarkt vertieft und die Welthandelsorganisation gestärkt werden.
Das Ifo betonte, die deutsche Volkswirtschaft profitiere wie kaum eine andere von offenen Weltmärkten. Denn deutsche Bruttoexporte enthielten einen Anteil von 21 Prozent an ausländischer Wertschöpfung. Bei China seien es nur 17 Prozent, bei den USA 9 Prozent.
Auch würden knapp über 30 Prozent der deutschen Wertschöpfung ins Ausland exportiert, für die deutsche Industrie liege dieser Wert sogar bei rund 60 Prozent. Dabei entfalle allein auf die Nachfrage anderer EU-Länder 20 Prozent der gesamten industriellen Wertschöpfung in Deutschland, 9 Prozent auf die USA und 6 Prozent auf China. Der Rest der Welt schlage mit 25 Prozent zu Buche.
„Eine allgemeine Rückverlagerung von Lieferketten würde zu enormen Einkommensverlusten führen“, erklärte Ifo-Ökonomin Lisandra Flach. „Daher sollte der Staat sich mit Eingriffen in die Gestaltung von Lieferketten grundsätzlich zurückhalten.“
Eingriffe sollten auf Basis von klaren Kriterien vorgenommen werden und rechtskonform mit den Regeln der Welthandelsorganisation sein. Strategische Freihandelsabkommen wie das zwischen der Europäischen Union und Mercosur böten die Möglichkeit, Handelskosten zu verringern und die Abhängigkeiten von einzelnen Ländern zu verringern.
Der Aufbau von strategischen Reserven auf nationaler oder europäischer Ebene oder Verträge mit Unternehmen über entsprechende Reservekapazitäten könnten zudem kostengünstige Wege darstellen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten, so Flach. Der EU komme eine bedeutsame Rolle zu, denn 67 Prozent der importierten Waren, die aus fünf oder weniger Zuliefererländern bezogen würden, stammten aus anderen EU-Staaten.
Daher gelte es, den gemeinsamen EU-Binnenmarkt zu stärken, mahnte das Ifo. Vor allem bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen sei das Integrationspotential längst nicht ausgeschöpft. Häufig stünden mangelnde Harmonisierung, Defizite bei der Umsetzung von EU-Recht oder bürokratische Hürden einer wirtschaftlichen Integration im Weg. Ein besonderes Augenmerk sollte zudem auf die Schaffung eines vollständig integrierten europäischen Marktes für digitale Leistungen gelegt werden.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53150901-ifo-gegen-rueckverlagerung-von-produktion-eingriffe-in-lieferketten-015.htm
Tourismus: „Wir schaffen es kaum“ Urlauber überrennen Tui – n-tv, 16.6.2021
Nach den langen Einschränkungen im Kampf gegen Corona zieht es die Menschen in den Urlaub. Der weltgrößte Reiseveranstalter Tui kann nach eigenen Angaben die Anfrage kaum bewältigen. Die verkleinerte Flugzeug-Flotte wird komplett im Einsatz sein. Berichte über eine Kapitalerhöhung weist das Unternehmen zurück.
Beim weltweit größten Reisekonzern Tui steigen die Buchungen am Heimatmarkt Deutschland dank gelockerter Corona-Auflagen seit Wochen kräftig an. „Wir schaffen es kaum, der starken Nachfrage Herr zu werden“, sagte der Chef von Tui Deutschland, Marek Andryszak. Seit Mai liege die Zahl der Buchungen sogar über dem Niveau der Vergleichswochen im Vorkrisenjahr 2019. TUI Deutschland biete im Sommer 75 Prozent der Kapazität von vor zwei Jahren an. Gefragt seien vor allem Mallorca, Kreta und Urlaubsziele an der türkischen Riviera. Sobald es Klarheit über die Reisemöglichkeiten gebe, schnellten die Anfragen in die Höhe. …
Mit der ersten Reisewelle an Ostern nach Mallorca und nach Griechenland seien weder in Deutschland noch an den Urlaubsorten die Corona-Fallzahlen gestiegen, erklärte Andryszak. „Der organisierte Tourismus mit hohen Standards beim Testen trägt nicht zum Ausbreiten der Pandemie bei.“
Die kritische Diskussion in der Öffentlichkeit über den kleinen Mallorca-Reiseboom hätten die Buchungen rasch versiegen lassen. Dass die Bundesregierung dann eine Testpflicht für heimkehrende Flugreisende einführte, sei dagegen hilfreich gewesen, weil der psychologische Druck auf die sonnenhungrigen Kunden nachgelassen habe.
Testpflicht für Heimkehrer
Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben die die Testpflicht für Flugreisende aus dem Ausland bis Mitte September verlängert. Hintergrund ist vor allem die Sorge vor dem Einschleppen von Virus-Varianten. Die Unsicherheit darüber habe sich bisher nicht auf die Erholung des Reisegeschäfts bei TUI ausgewirkt, erklärte das Unternehmen.
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Urlauber-ueberrennen-Tui-article22624434.html
27 Prozent weniger als 2020 Deutsche Rüstungsexporte stark gesunken – n-tv, 16.6.2021
Nach Ungarn liegt Ägypten auf Platz zwei der Hauptexportländer der deutschen Rüstungsindustrie. Die Bundesregierung rechtfertigt die Genehmigung damit, dass die Güter nicht zur Repression der Bürger geeignet sind. Insgesamt zeigt der Exportbericht für 2020 einen Rückgang der Geschäfte um 27 Prozent.
Nach einem Rekord 2019 sind die Exportgenehmigungen für deutsche Rüstungsgüter im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel zurückgegangen. Das geht aus dem Rüstungsexportbericht für 2020 hervor, den das Bundeskabinett am Mittwoch billigte. Danach erlaubte die Regierung die Ausfuhr von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 5,82 Milliarden Euro – 27 Prozent weniger als die 8,015 Milliarden Euro im Vorjahr.
Die Zahlen hatte das Wirtschaftsministerium bereits Anfang des Jahres bekanntgegeben. Mit dem 140 Seiten starken Exportbericht kommt die Regierung ihrer Pflicht nach, eine gewisse Transparenz über die Geschäfte der deutschen Rüstungsindustrie und über Rüstungslieferungen der Bundeswehr ins Ausland zu schaffen. Spitzenreiter unter den Empfängerländern war erneut Ungarn mit einem Exportvolumen von 838,4 Millionen Euro. Dahinter folgten Ägypten (763,8), Israel (582,4) und die USA (510,0). Vor allem die Lieferungen an Ägypten sind wegen der Menschenrechtslage in dem mit harter Hand regierten Land, aber auch wegen der Verwicklung in den Jemen-Krieg umstritten.
Das Wirtschaftsministerium wies darauf hin, dass 99 Prozent der genehmigten Lieferungen an Ägypten für die Seestreitkräfte bestimmt seien. Dazu zählten U-Boote und Patrouillenboote. Diese Güter eigneten sich nicht für interne Repression oder für den Einsatz im Jemen-Konflikt, sagte eine Sprecherin. „Leistungsfähige Seestreitkräfte liegen im legitimen verteidigungspolitischen Interesse Ägyptens und auch im internationalen Interesse der Küsten- und Seewegsicherung.“
*** Starke Schwankungen in der Statistik ***
Die Exportgenehmigungen der Bundesregierung waren zwischen 2016 und 2018 kontinuierlich gesunken, 2019 dann aber sprunghaft gestiegen. Da einzelne Geschäfte im hohen dreistelligen Millionenbereich oder im Extremfall sogar Milliardenbereich liegen können, unterliegt die Statistik starken Schwankungen.
Gestiegen ist 2020 der Anteil der Exporte in Länder, die nicht der EU oder Nato angehören oder diesen Ländern gleichgestellt sind wie Japan und Australien. Etwa die Hälfte der genehmigten Lieferungen (50,1 Prozent) ging in diese sogenannten Drittstaaten, 2019 waren es 44,1 Prozent. Exporte in diese Länder sind besonders umstritten, weil einige davon in Konflikte verwickelt sind oder bestimmte Menschenrechtsstandards verletzen. (ntv.de, mau/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutsche-Ruestungsexporte-stark-gesunken-article22624244.html
Bestellboom in der Corona-Krise: 63 Pakete pro Haushalt im Pandemiejahr – n-tv, 16.6.2021
Noch nie haben sich die Deutschen so viel nach Hause liefern lassen wie in der Corona-Zeit. Die Paketdienste rechnen mit noch mehr Sendungen in diesem Jahr. Ein Zurück wird es nach Erwartung der Branche nicht geben.
Von Mousepads über Gartenmöbel bis zu Kochzutaten: Paketauto um Paketauto eilt durch die Wohnviertel, ein Heer von Zustellern schleppt Kartons in die Häuser. 63 Pakete je Haushalt waren es im Schnitt 2020, fast dreimal so viele wie vor zehn Jahren. Der Paketberg ist allein im vergangenen Jahr um rund elf Prozent auf 4,05 Milliarden Sendungen gewachsen. Vier Prozent Plus waren erwartet worden. Doch es hatte niemand mit der Pandemie gerechnet, die geschlossene Läden und Schulen, Homeoffice und Video-Unterricht brachte.
In diesem Jahr werden weitere 320 Millionen Pakete zusätzlich erwartet. „Die Menschen konnten nicht reisen und haben sich ihre Terrassen und Gärten schöner gestaltet“, sagt Marten Bosselmann, Chef des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik (BIEK). Nie zuvor hätten die Zusteller so viele Pools und Gartenmöbel gebracht. Die Pakete waren sperriger, wenn auch nicht unbedingt schwerer, wie Klaus Esser sagt, Autor der Branchenstudie des BIEK.
*** Herkulesaufgabe für Paketdienste ***
Wachstumstreiber sind demnach die Privathaushalte, die mehr als die Hälfte der Pakete bestellt haben. Um 18,6 Prozent gingen die Zahlen nach oben. Das Wachstumstempo hat sich mehr als verdoppelt. Vor allem Online-Einkäufe treiben die Zahlen. Zunehmend bestellen die Deutschen auch im Ausland.
Die Menschen haben sich ans Bestellen gewöhnt. In diesem Jahr sollen die privaten Paketbestellungen um zehn Prozent zulegen. Was eigentlich erst 2025 vorgesehen war, erwartet der Verband nun schon im kommenden Jahr: 4,7 Milliarden Sendungen. Auch Branchenprimus DHL rechnet nach der Pandemie mit Zuwächsen von fünf bis sieben Prozent. Denn inzwischen kaufen die Kunden nicht nur neue Fernseher, Kleidung und Bücher online, sondern zunehmend auch Waren des täglichen Bedarfs, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) beobachtet.
Auf dem Höhepunkt der dritten Corona-Welle vor Ostern gaben in einer Befragung das Instituts für Handelsforschung Köln 43 Prozent der Befragten an, dass sie nun Dinge online kaufen, für die sie normalerweise in die Geschäfte gehen. Je stärker sich das Virus ausbreitete, desto höher stieg der Wert. 83 Milliarden Euro flossen laut BEVH 2020 ins Online-Shopping, 15 Prozent mehr als im Vorjahr.
Die Paketdienste sprechen von einer Herkulesaufgabe – die sie gerne besser vergütet hätten. Aber dafür ist die Konkurrenz zu groß. Die Dienste fürchten zudem, dass in Großstädten auch Lebensmittel-Lieferdienste wie Gorillas oder Flink ins Paketgeschäft einsteigen. (ntv.de, sbl/dpa)
QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/63-Pakete-pro-Haushalt-im-Pandemiejahr-article22624144.html
Ifo-Präsident Fuest warnt vor Vermögensteuer – Abschreckung von Investoren im In- und Ausland zugunsten eines Umverteilungseffektes zu sehr hohem Preis – DJN WOCHENEND ÜBERBLICK, 21.6.2021
Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat vor der Wiedereinführung der Vermögensteuer nach der Bundestagswahl gewarnt. „Dieser Schritt wäre ein deutliches Signal an Investoren im In- und Ausland, nicht in Deutschland zu investieren. Es würde ein Umverteilungseffekt erreicht – aber zu einem sehr hohen Preis“, sagte Fuest im Interview mit der Wirtschaftswoche. Mehreinnahmen aus der Vermögensteuer stünden Verluste aus dem Rückgang anderer Steuereinnahmen gegenüber.
QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53198406-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-19-und-20-juni-2021-015.htm
Christoph Schäfer: Studie zu Geld und Sozialneid : Nur jeder vierte Deutsche will reich sein – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.6.2021 (aktualisierte Fassung)
us Goethes „Faust“ wissen wir: „Nach Golde drängt / Am Golde hängt / Doch alles!“ Repräsentative Umfragen in sieben Staaten belegen nun allerdings, dass dem nicht so ist. In Auftrag gegeben hat sie der Reichtumsforscher Rainer Zitelmann. Sie sind Bestandteil seiner Studie über die „Einstellung zu Reichen“, die in der Juni-Ausgabe der britischen Fachzeitschrift Economic Affairs erscheint. An den Umfragen nahmen in allen Staaten jeweils mindestens 1000 Personen teil. In Deutschland befragte das Institut Allensbach, in den anderen Ländern das Unternehmen Ipsos Mori. Für die F.A.Z. hat Zitelmann die Studie um zusätzliche Daten erweitert.
Demnach geben in Deutschland 26 Prozent der Männer an, dass es ihnen persönlich wichtig oder sogar sehr wichtig ist, reich zu sein. Als Reichtum wird in der Studie definiert, wenn jemand zusätzlich zu seinem Haus noch mehr als eine Million Euro besitzt. Unter Frauen ist der Anteil der Materialisten deutlich geringer; von ihnen ist nicht mal jeder Fünften (18 Prozent) wichtig oder sehr wichtig, reich zu sein.
Dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt sich in allen untersuchten Staaten. Auch in Italien, den USA, Schweden, Spanien, Frankreich und Großbritannien streben mehr Männer nach dem großen Geld als Frauen. „Man kann lange darüber diskutieren, warum das so ist, aber es ist eine Tatsache, dass Frauen seltener reich werden wollen als Männer“, sagt der promovierte Soziologe und Historiker. „Das sieht man auch an den Zugriffszahlen großer Finanzportale – die werden auch seltener von Frauen gelesen.“
Einen deutlichen Unterschied gibt es allerdings nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen den Altersgruppen. Den Befragten unter 30 Jahren ist es viel wichtiger, reich zu werden, als denjenigen über 60 Jahren. In Deutschland will mit 32 Prozent etwa jeder Dritte in der Gruppe der Jüngeren reich werden, unter den Älteren ist es nicht mal jeder Siebte (14 Prozent). Auch dieses Muster ist in allen Staaten gleich, nur in Spanien ist das Bedürfnis bei den Älteren minimal höher.
*** Nur 3 Prozent aller Deutschen halten Reiche für ehrlich ***
Studienautor Zitelmann findet es logisch, dass mehr Jüngere als Ältere nach Geld streben: „Grundschulkinder wollen noch Pilot werden oder Astronaut, die haben noch Träume.“ Mit fortschreitendem Alter würden diese Ziele dann aber meist heruntergesetzt. „Und wer es mit 60 Jahren noch nicht geschafft hat, reich zu werden, der hat weniger Hoffnung, dass es in den verbleibenden 20 Jahren noch klappt.“
Generell, zeigt die Studie, schreiben viele Befragte reichen Menschen schlechte Eigenschaften zu. So glauben nur 3 Prozent aller Deutschen, dass Reiche „ehrlich“ sind. In Schweden sind es 6 Prozent, in Spanien und Italien sogar nur einer von hundert. Demgegenüber halten 49 Prozent der Deutschen reiche Menschen für „gierig“. In Italien sind es 33 Prozent, in Schweden 32 Prozent.
Allerdings fallen die Antworten darauf, welche Eigenschaften Reiche haben, viel positiver aus, wenn der Antwortende einen reichen Menschen persönlich kennt. Dann halten zum Beispiel nicht mehr 3, sondern 42 Prozent der Deutschen einen Vermögenden für „ehrlich“. Die Umfrageergebnisse bestätigen eine wesentliche Erkenntnis aus der Vorurteilsforschung: Menschen, die Angehörige von Minderheiten (seien es Reiche, Schwarze, Homosexuelle oder Muslime) persönlich kennen, beurteilen sie oft viel positiver als jene, die Minderheiten nur aus den Medien kennen.
Im Durchschnitt jedoch ist Sozialneid in Deutschland deutlich festzustellen. 51 Prozent plädieren dafür, dass „Reiche nicht nur hohe, sondern sehr hohe Steuern bezahlen“ sollen. Für „nicht übermäßig hohe Steuern“ sprechen sich nur 32 Prozent aus. Jeder dritte Deutsche stimmt sogar Aussagen zu wie jener, dass die Steuern für Millionäre selbst dann stark erhöht werden sollten, wenn er persönlich keinen Vorteil davon hätte. In Frankreich ist die Zahl jener, die in der Studie zur Gruppe der „Neider“ gezählt werden, noch einen Prozentpunkt höher, in den USA (20 Prozent) und Großbritannien (18 Prozent) hingegen deutlich niedriger. Sind die Deutschen also ein Volk der Neider? „Das Glas kann man hier halb voll oder halb leer sehen“, antwortet Zitelmann. „Unter den sieben befragten Nationen war der Neid aber nur in Frankreich noch höher.“
*** „Ach wir Armen“ ***
Für das schlechte Image der Reichen sind vor allem zwei Gründe verantwortlich. Ein ganz wesentlicher ist der Glaube an die sogenannte Nullsummentheorie. In dieser Vorstellung kämpfen Schichten gegeneinander um ein vorhandenes Vermögen: Wenn ein Reicher einen Euro mehr bekommt, wird er einem Armen gleichzeitig aus der Tasche gezogen. Das Gegenteil davon ist die Annahme, dass eine Gesellschaft insgesamt nach vorne kommen kann – die einzelnen Bürger nur eben unterschiedlich schnell.
In der Wirtschaftswissenschaft wird meist China als ein Beispiel dafür angeführt, dass der Kuchen auch insgesamt größer werden kann. In der Bevölkerung aber ist der Glaube an ein Nullsummenspiel weit verbreitet. Der Aussage „Je mehr die Reichen haben, desto weniger bleibt für die Armen übrig“ stimmen 51 Prozent der Italiener und der Spanier, 49 Prozent der Franzosen und 48 Prozent der Deutschen zu. In Großbritannien (36 Prozent) und den USA (34 Prozent) sind die Werte deutlich geringer.
Übrigens geht die bekannte Zeile „Nach Golde drängt / Am Golde hängt / Doch alles!“ noch weiter. Das Ende wird nur oft unterschlagen. Der Dichterfürst schloss mit: „Ach wir Armen!“
QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/reichtum-und-geld-nur-jeder-vierte-deutsche-will-reich-sein-17387520.html
ÖSTERREICH
STATISTIK AUSTRIA
Baukosten im Mai 2021 weiter gestiegen
Sommerurlaubsreisen 2019-2021: Urlaub in Österreich und Italien beliebt
QUELLE: http://www.statistik.at
Inflation steigt im Mai 2021 auf 2,8% – Statistik Austria, 17.6.2021
Die Inflationsrate für Mai 2021 lag laut Statistik Austria bei 2,8% (April 2021: 1,9%). Ausschlaggebend dafür waren deutliche Preisschübe, insbesondere bei Treibstoffen, aber auch bei Nahrungsmitteln, Möbeln und Bekleidungsartikeln. Der Indexstand des Verbraucherpreisindex 2020 (VPI 2020) lag im Mai 2021 bei 102,1. Gegenüber dem Vormonat April 2021 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,3%
„Die erhöhte Inflation von derzeit 2,8% lässt sich hauptsächlich auf die sehr niedrigen Treibstoff- und Energiepreise vor einem Jahr zurückführen, die sich mittlerweile wieder erholt haben. Davon betroffen ist insbesondere der Bereich Verkehr, der im Mai 2021 mit einem Preisanstieg von 5,3% erstmals seit Oktober 2018 wieder stärkster Preistreiber im Jahresvergleich war. In den kommenden Monaten wird die preistreibende Wirkung der nunmehr erholten Treibstoff- und Energiepreise allerdings geringer ausfallen“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.
Ohne Ausgaben für Verkehr und Wohnen hätte die Inflation 1,5% betragen
Der Preisanstieg für Verkehr (durchschnittlich +5,3%) beeinflusste die Inflationsrate mit +0,73 Prozentpunkten. Damit waren Verkehrsausgaben erstmals seit Oktober 2018 wieder stärkster Preistreiber im Jahresvergleich. Ausschlaggebend dafür war die Entwicklung der Treibstoffpreise (Mai: +20,8%; Einfluss: +0,65 Prozentpunkte; April: +12,7%; Einfluss: +0,44 Prozentpunkte). Reparaturen privater Verkehrsmittel kosteten um 4,1% mehr (Einfluss: +0,07 Prozentpunkte). Neue Kraftwagen verteuerten sich um 2,8% (Einfluss: +0,06 Prozentpunkte). Flugtickets hingegen verbilligten sich um 20,5% (Einfluss -0,09 Prozentpunkte).
Wohnung, Wasser, Energie verteuerte sich durchschnittlich um 3,0% (Einfluss: +0,58 Prozentpunkte). Mieten stiegen insgesamt um 3,9% (Einfluss: +0,21 Prozentpunkte). Die Haushaltsenergie verteuerte sich durchschnittlich um 4,9% (Einfluss: +0,19 Prozentpunkte). Dazu trugen höhere Preise für Strom (+5,2%; Einfluss: +0,10 Prozentpunkte) sowie für Heizöl bei (+19,6%; Einfluss: +0,09 Prozentpunkte). Die Preise für Gas stiegen um 1,4% und jene für feste Brennstoffe um 0,5%. Fernwärme hingegen verbilligte sich um 0,9%. Die Instandhaltung von Wohnungen kostete durchschnittlich um 3,0% mehr (Einfluss: +0,17 Prozentpunkte).
Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen deutlich (durchschnittlich +1,8%; Einfluss: +0,20 Prozentpunkte), merklich stärker als im April (+0,2%; Einfluss: 0,03 Prozentpunkte). Die Nahrungsmittelpreise allein verteuerten sich insgesamt um 1,9% (Einfluss: +0,19 Prozentpunkte), merklich kraftvoller als zuletzt (April: +0,3%; Einfluss: +0,02 Prozentpunkte). Hauptverantwortlich dafür war insbesondere die Preisentwicklung für Fleisch (Mai: +3,6%, Einfluss: +0,08 Prozentpunkte; April: -1,0%, Einfluss: -0,02 Prozentpunkte). Die Preise für Gemüse stiegen um 4,5% (Einfluss: +0,05 Prozentpunkte). Verteuerungen zeigten sich auch bei Brot und Getreideerzeugnissen (+1,4%) sowie bei Obst (+2,6%). Fisch hingegen verbilligte sich deutlich (-3,8%), die Preise für Milch, Käse und Eier sanken kaum (-0,6%). Alkoholfreie Getränke verteuerten sich insgesamt um 1,1%.
Für Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses musste merklich mehr bezahlt werden (durchschnittlich +2,9%; Einfluss: +0,19 Prozentpunkte), nach einem moderaten Plus von 1,3% im April (Einfluss: +0,09 Prozentpunkte). Vor allem teurere Wohnmöbel trugen dazu bei (Mai: +4,3%; Einfluss: +0,11 Prozentpunkte; April: +0,8%, Einfluss: +0,02 Prozentpunkte).
Bekleidung und Schuhe kosteten durchschnittlich um 2,4% mehr (Einfluss: +0,11 Prozentpunkte), nachdem sie sich im April preisstabil gezeigt hatten (durchschnittlich 0,0%; Einfluss: 0,00 Prozentpunkte). Ausschlaggebend dafür war die Preisentwicklung für Bekleidungsartikel (Mai: +3,1%; Einfluss: +0,10 Prozentpunkte; April: +0,4%, Einfluss: +0,01 Prozentpunkte).
Nachrichtenübermittlung verbilligte sich durchschnittlich um 2,2% (Einfluss: -0,05 Prozentpunkte). Telefon- und Telefaxdienste wurden um 2,7% günstiger (Einfluss: -0,05 Prozentpunkte).
*** Inflation Mai 2021 gegenüber April 2021: +0,3% ***
Als Hauptpreistreiber im Vergleich zum Vormonat April 2021 erwiesen sich Treibstoffe (durchschnittlich +1,5%; Einfluss: +0,06 Prozentpunkte). Hauptpreisdämpfer im Vergleich zum Vormonat waren Wohnungsmieten (durchschnittlich -0,5%; Einfluss: -0,02 Prozentpunkte).
Teuerung laut harmonisiertem Verbraucherpreisindex liegt im Mai 2021 bei 3,0%
Der Indexstand des auf europäischer Ebene harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI 2015) lag im Mai 2021 bei 111,04. Die harmonisierte Inflationsrate betrug 3,0% und war somit um 0,2 Prozentpunkte höher als jene des VPI. Der Unterschied beruht auf Gewichtungsunterschieden zwischen VPI und HVPI (siehe Informationen zur Methodik). Insbesondere die Preisentwicklung bei Bekleidungsartikeln (höhere Gewichtungsanteile im HVPI als im VPI) ließ den HVPI gegenüber dem VPI ansteigen.
Teuerung beim täglichen Einkauf ebenso hoch wie Gesamtinflation, Wocheneinkauf massiv teurer
Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, stieg im Jahresvergleich um 2,8% (April: +1,7%).
Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand um 6,6% (April: +4,5%).
QUELLE: http://www.statistik.at/web_de/presse/126241.html
IWF: Laut IWF braucht Österreich kein Sparpaket aber eine CO2-Steuer – CO2-Steuer als wichtigste Strukturmaßnahme für Österreichs Wirtschaft – Digitalisierung zweites Mega-Thema – Normalisierung des Staatshaushalts dank Wirtschaftserholung: Verschuldung von 80% BIP-Anteil wird sich in wenigen Jahren selbst reguliert haben – Eigenkapitalbildung unterstützen – OeNB-Chef Holzmann: Maastricht-Kriterien erreichbar durch „Spare in der Not, so hast du in der Zeit“ [sic!, richtig: Spare in der Zeit, so hast du in der Not] – Kurier, 15.6.2021
Der internationale Währungsfonds (IWF) stellt Österreichs Wirtschaft grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus. Auch wenn die Erholung nach der Krise langsamer ausfallen dürfte als in anderen EU-Ländern, brauche Österreich kein Sparpaket, um den Haushalt wieder ins Lot zu bringen, sagte IWF-Vertreter Jeffrey Franks am Dienstagabend in einer Online-Pressekonferenz. Alleine das Auslaufen der Corona-Hilfen und das erwartete Wachstum würden reichen.
„Mittelfristig“ werde das Defizit auf ein Niveau wie vor der Krise fallen – womit Franks eine Neuverschuldung von 0,5 bis 1 Prozent des BIP meint. Das wäre völlig ausreichend für einen stabilen Haushalt, wieder einen Überschuss zu erwirtschaften wäre aus seiner Sicht eine politische Entscheidung, keine ökonomische Notwendigkeit.
Die Verschuldung Österreichs mit etwas über 80 Prozent des BIP klinge zwar hoch, sei aber im Vergleich zu anderen EU-Ländern niedrig. Alleine durch die Verringerung des Defizits in den kommenden Jahren und das Wirtschaftswachstum werde die Verschuldung als Anteil am BIP ab 2023 nachhaltig sinken, das Problem werde sich von selber regulieren.
Dennoch hat Österreichs Wirtschaftspolitik einige Hausaufgaben zu erledigen. Die Vordringlichste aus Sicht von Franks, der die IWF-Mission zur Prüfung der österreichischen Wirtschaft leitete, ist die Einführung einer CO2-Steuer. Wobei Franks betont, dass Österreichs Wirtschaft gut laufe und kein großes Einzelproblem habe. Aber mit einer CO2-Besteuerung könnte Österreich den Umbau der Wirtschaft zu Klimaneutralität vorantreiben und auch in der Zukunft wirtschaftlicher Vorreiter bleiben.
Konkret sprach Franks von eine CO2-Preis von zunächst 25 Euro je Tonne, der langsam auf 100 Euro steigen sollte. Die Einnahmen daraus sollten einerseits für Ausgleichsmaßnahmen für ärmere oder überdurchschnittlich von der Steuer betroffene Menschen, die Finanzierung von Investitionen in „Grüne“ Technologien sowie zur Steuersenkung in anderen Bereichen verwendet werden, um nicht die gesamte Steuerlast zu erhöhen.
Zweites Großthema aus Sicht des IWF – wie schon in einer heute veröffentlichten Wifo-Studie – ist die Digitalisierung der Wirtschaft. Österreich sei da zwar in einzelnen Punkten gut unterwegs, hinke aber in einigen Maßnahmen hinten nach. Dazu gehören der Ausbau schneller Verbindungen, etwa Breitband-Internet, die Nutzung digitaler Dienste und die Integration digitaler Technologien in die Arbeitswelt.
Bei allem Lob für die Corona-Hilfen in Österreich, sei dadurch die ohnehin schon hohe Verschuldung bzw. „das Ungleichgewicht zwischen Schulden und Kapital in Unternehmen“ weiter gewachsen, merkte Franks kritisch an. Der IWF spricht sich für private Kapitalspritzen aus, die von der Regierung unterstützt werden. Dazu könnten staatliche Garantien für Kapitalbeteiligungen oder Investitionen in Firmen zählen – oder komplementär auch die steuerliche Berücksichtigung von Eigenkapital, wie es die Bundesregierung in jüngster Zeit mehrfach vorgeschlagen hat. Damit hätte man ein Gegengewicht zur Steuerbegünstigung von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital, die es in Österreich wie in vielen anderen Ländern derzeit gebe.
Notenbankgouverneur Robert Holzmann sagte in der gemeinsamen Pressekonferenz, er hoffe, die Regierung werde den IWF-Bericht aufmerksam lesen und den einen oder anderen Vorschlag übernehmen. Er könne nur die IWF-Sicht bekräftigen, dass der österreichische Finanzsektor gesund und gut vorbereitet sei, die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.
Auch Holzmann geht davon aus, dass die Schulden auch ohne Sparpaket sinken werden. Schon vor der Krise sei Österreich unterwegs gewesen, die Maastricht-Kriterien bei der Verschuldung (60 Prozent des BIP) zu erreichen. Solange weiter nach dem Prinzip gehandelt werde „Spare in der Not so hast du in der Zeit“ [sic, das Sprichwort heißt korrekt: Spare in der Zeit, so hast du in der Not!] sei er zuversichtlich. Holzmann wies darauf hin, dass die Grünen die CO2-Steuer als zentralen Punkt auf der Agenda hätten. Wenn es der EU noch gelinge, einen Ausgleich über Grenzen hinweg zu etablieren, „dann wären wir in einer guten Position die Zukunft grüner und sicherer zu machen“
QUELLE (ZAHLPFLICHT?): https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-von-innen/laut-iwf-braucht-oesterreich-kein-sparpaket-aber-eine-co2-steuer/401414184
IMF – Austria: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission – IMF, 15.6.2021
Zusammenfasend: Österreich trat mit starken makroökonomischen Indikatoren und einem gesunden Finanzsektor in die Pandemie ein, erlitt aber trotz robuster staatlicher Unterstützungsmaßnahmen einen starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität im Jahr 2020. Für 2021-22 wird eine Erholung erwartet, allerdings in einem etwas langsameren Tempo als in vielen anderen EU-Ländern. Das Haushaltsdefizit ist aufgrund der geringeren Aktivität und der Ausgaben zur Unterstützung der Pandemie sprunghaft angestiegen, aber die Haushaltslage bleibt beherrschbar, wobei das Defizit mittelfristig in die Nähe des Vorkrisenniveaus sinken soll. Das Konjunkturpaket der Regierung konzentriert sich angemessen auf die Ankurbelung von Investitionen, die Ökologisierung der Wirtschaft und die Förderung der Digitalisierung, könnte aber noch erweitert werden, um die Erholung zu unterstützen und Narben zu begrenzen. Österreich hat ehrgeizige Ziele, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, aber es werden zusätzliche Schritte nötig sein, um dieses Ziel in Reichweite zu bringen, einschließlich Kohlenstoffpreisen, mehr Unterstützung für die Verbesserung der thermischen Effizienz von Gebäuden und einen schnelleren Übergang zu sauberem Verkehr. Der Finanzsektor hat den Abschwung gut überstanden, die Rentabilität bleibt positiv und die notleidenden Kredite sind gering. Es wird wichtig sein, weiterhin wachsam zu bleiben, da die Schwäche des Unternehmenssektors die Banken immer noch beeinträchtigen könnte. Maßnahmen zur Stützung des Eigenkapitals von Unternehmen könnten dieses Risiko abmildern und die Erholung erleichtern. *** Austria entered the pandemic with strong macroeconomic indicators and a healthy financial sector but suffered a sharp decline in economic activity in 2020 despite robust government support efforts. A recovery is expected in 2021-22, but at a somewhat slower pace than in many other EU countries. The fiscal deficit jumped due to lower activity and pandemic support spending, but the fiscal situation remains manageable, with the deficit set to fall to near pre-crisis levels in the medium-term. The government’s recovery package appropriately focuses on boosting investment, greening the economy, and fostering digitalization, but it could be expanded further to aid the recovery and limit scarring. Austria has ambitious goals to reduce greenhouse gas emissions, but additional steps will be required to bring that objective within reach, including carbon pricing, more support for improving the thermal efficiency of buildings and a faster transition to clean transport. The financial sector has weathered the downturn well, with profitability remaining positive and non-performing loans low. Continued vigilance will be important, as corporate sector weakness may still affect banks. Corporate equity support measures could mitigate this risk and facilitate the recovery.
QUELLE: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/15/mcs061521-austria-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission?cid=em-COM-123-43243
Plus 10,5 % zum Vorjahr Holz, Sprit, Kunststoff, Stahl als Treiber: Baukosten legen massiv zu – Statistik Austria meldet Anstieg von 10,5 Prozent gegenüber dem ersten Coronakrisen-Mai 2020 und Zuwachs von 3,6 Prozent gegenüber dem Vormonat April – Kleine Zeitung, 15.6.2021
Die Baupreise haben heuer im Mai spürbar angezogen. Die Kosten im Wohnhaus- und Siedlungsbau haben sich gegenüber dem Mai des Vorjahres um 10,5 Prozent erhöht, wie aus aktuellen Daten der Statistik Austria von heute, Dienstag, hervorgeht. Allein gegenüber dem Vormonat April gingen die Preise um 3,6 Prozent in die Höhe.
Die Kosten stiegen auch in sämtlichen Tiefbausparten. Der Straßenbau verteuerte sich im Jahresabstand um 8,6 Prozent (und um 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat), der Brückenbau um 14,8 Prozent (bzw. 4,8 Prozent) und der Siedlungswasserbau um 8 Prozent (bzw. 2,6 Prozent).
Auf die Baukosten wirkten sich laut Statistik Austria in allen Bausparten auch die neuen Kollektivvertragsabschlüsse einiger baurelevanter Branchen wie etwa Bau-, Zimmermeister- und Malergewerbe aus, die mit 1. Mai in Kraft getreten sind. Die Lohnkosten für die Gesamtbaukosten kletterten den Angaben zufolge um 2,5 Prozent nach oben, Baumeisterarbeiten verteuerten sich um 2,9 Prozent.
Starke Preiszuwächse gegenüber dem Mai des Vorjahres zeigten vor allem die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen. Das wurde vor allem im Brückenbau spürbar. Erhebliche Kostensteigerungen gab es den Statistikern zufolge aber auch bei Kunststoffwaren. Ein beträchtlicher Kostentreiber im Wohnhaus- und Siedlungsbau war die Warengruppe Holz. Wesentlich teurer wurden zudem Diesel und Treibstoffe, was sich vor allem auf die Kosten in den Tiefbausparten auswirkte.
QUELLE: https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5994099/Plus-105-zum-Vorjahr_Holz-Sprit-Kunststoff-Stahl-als-Treiber_
Mit Digitalisierung und Dekarbonisierung aus der Krise. WIFO-Studie im Auftrag der OeNB beleuchtet wirtschaftspolitische Hebel zur Forcierung von Investitionen – Wirtschaftsforschungsinstitut, 15.6.2021
Mit dem absehbaren Ende der COVID-19-Pandemie stellt sich die Frage, wie die österreichische Wirtschaftspolitik die Erholung nutzen kann, um den Strukturwandel zu steuern und zu begleiten. Vor diesem Hintergrund untersucht eine Studie des WIFO im Auftrag der Oesterreichischen Nationalbank wirtschaftspolitische Hebel zur Forcierung von Investitionen. Besonderes Augenmerk wird auf die Digitalisierung und die Bewältigung des Klimawandels gelegt.
Investitionen sind zentral für die Gestaltung des Aufholprozesses nach der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Rezession. Diese sind nicht nur wichtige Treiber von Wachstum und Beschäftigung, sondern auch ein Vehikel der Verbreiterung neuer Technologien, die wirtschaftliche Prozesse und Strukturen mitunter tiefgreifend verändern. Dies führt zu folgender Forschungsfrage: Wie kann die öffentliche Hand nach der weiteren Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen Investitionen unterstützen, damit nationale und europäische Zielvorgaben erreicht werden? Eine Studie des WIFO im Auftrag der Oesterreichischen Nationalbank untersucht Ansatzpunkte der Wirtschaftspolitik in zwei Bereichen, die beide eine Querschnittsmaterie darstellen.
- Der „Digitalisierung“, die durch die Nutzung technologischer Neuerungen im IKT-Bereich getrieben wird. Die Studie untersucht die Position Österreichs mittels eines quantitativen Benchmarkings der österreichischen Performance und eine Literaturrecherche.
- Die „Dekarbonisierung“, d. h. das Erreichen der CO2-Neutralität der Wirtschaft und Gesellschaft, ist eine Notwendigkeit, die aus dem menschengemachten Klimawandel folgt. Sie leitet sich aus naturwissenschaftlichen Forschungserkenntnissen ab. Die Hebel wurden anhand einer Stakeholder-Befragung erarbeitet
IM WEITEREN werden beleuchtet: * Hebel zur Förderung von Investitionen in die Digitalisierung * Hebel zur Förderung von Investitionen in die Dekarbonisierung
QUELLEN:
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?content-id=1454619331110&publikation_id=67181&detail-view=yes
(3-Seiten-PDF): https://newsletter.wifo.ac.at/sys/r.aspx?sub=1b6RS3_41IC7d&tid=2-1iuJQs-csIMB&link=rYoh
Nur 44 Prozent der Österreicher wollen im Sommer verreisen – Die Mehrheit davon will laut einer Umfrage der Statistik Austria im Inland urlauben – Wiener Zeitung/APA, 16.6.2021
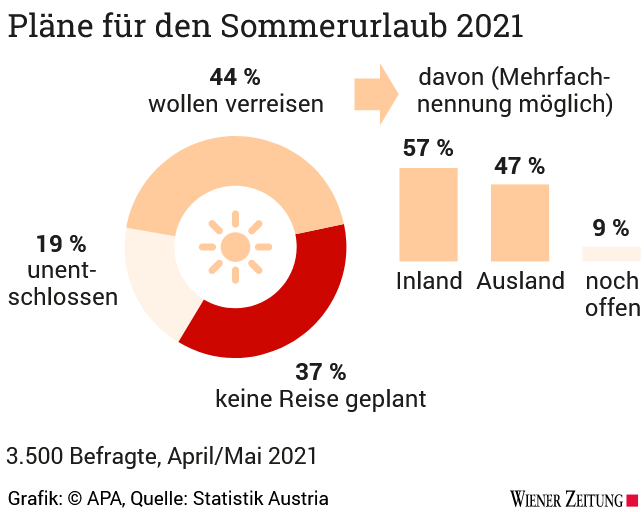
Rund 44 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wollen heuer im Sommer verreisen, das sind gleich viele wie im Vorjahr. Mehr als Hälfte von ihnen (57 Prozent) will dabei im Inland bleiben, 47 Prozent zieht es ins Ausland, zeigt eine Umfrage der Statistik Austria, die im April und Anfang Mai durchgeführt wurde und bei der Mehrfachnennungen möglich waren. Jeder Fünfte in Österreich ist noch unentschlossen, die anderen bleiben daheim.
Menschen in Wien und Tirol wollen überdurchschnittlich häufig im Sommer verreisen, in Wien sind außerdem noch ein Viertel der Befragten unentschlossen. Nach Alter sind Menschen unter 24 leicht überdurchschnittlich reisefreudig, Personen ab 65 deutlich weniger als der Schnitt.
„Die Lockerungen der Reisebeschränkungen dank des Impffortschritts und sinkender Inzidenzen haben die Reiselust in der österreichischen Bevölkerung wieder geweckt“, stellt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas fest.
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108665-Nur-44-Prozent-der-Oesterreicher-wollen-im-Sommer-verreisen.html
KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER
Andreas Breitenfellner, Thomas Zörner: Entwarnung: Die EZB ist weiter auf Kurs – Preisstabilität bleibt im Fokus der Zentralbank, die sich gerade deshalb um die geänderten Rahmenbedingungen durch den Klimawandel sorgt – Wiener Zeitung, 15.6.2021
In seinem jüngsten Gastkommentar riet Christian Ortner: „Statt um die Lufttemperatur im Jahr 2051 sollte sich die EZB lieber um die Inflation kümmern.“ Klar, Journalisten müssen Dinge zuzuspitzen. Wir wollen dennoch hier die Fakten etwas zurechtrücken. Gleich vorweg können wir die Leserinnen und Leser beruhigen: Das Euro-System bleibt „primär der Stabilität des Geldwertes verpflichtet“. Grundlage dafür ist Artikel 127(1) des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).
Der Klimawandel betrifft allerdings selbstverständlich nicht nur den Anstieg der Lufttemperatur, sondern bringt auch weitreichende ökonomische und gesellschaftliche Herausforderungen mit sich. Deshalb widmet sich das Euro-System (EZB und nationale Zentralbanken) in seiner aktuellen Überprüfung der geldpolitischen Strategie auch der Klimafrage als einem unter 13 Themen, neben Digitalisierung, Globalisierung, Produktivitätswachstum, Beschäftigung und eben auch Inflation.
Der Klimawandel kann nämlich sehr wohl Auswirkungen auf die Preisstabilität zeigen. Einerseits können geänderte Umweltbedingungen sowie häufigere Extremwetterphänomene wie Dürren oder Überschwemmungen die Nahrungsmittelproduktion, den Kapitalstock und die Produktivität ganzer Industriezweige beeinträchtigen. Das wiederum ließe stärkere Preisschwankungen oder eine generelle Erhöhung des Preisniveaus erwarten. Andererseits ist die Klimapolitik ein Faktor sogenannter Transformationsrisiken: Eine Stop-and-go-Klimapolitik macht es für Wirtschaftstreibende schwer, ihre Investitionen zu planen, was wachstumsdämpfend wirkt.
Natürlich ist es unklar, wann solche Ereignisse eintreten werden. Deshalb ist es notwendig, die möglichen Auswirkungen auf die Preisniveaustabilität über den üblichen mittelfristigen Horizont hinaus zu analysieren. Die EZB ist aber nicht so „naiv“, eine exakte Prognose bis zur Mitte des Jahrhunderts erstellen zu können. Sie bedient sich vielmehr der Szenarioanalyse, die nur eine Idee von „Was wäre, wenn . . .“ gibt. Wie schnell es jedoch gehen kann, dafür ist der derzeitige (und vermutlich nur vorübergehende) pandemiebedingte Inflationsanstieg ein gutes Beispiel. Man denke nur an die ausgefallene Halbleiterproduktion in Taiwan aufgrund anhaltender Dürre.
*** Negative Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität ***
Der Klimawandel kann zudem negative Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität haben, die ebenfalls unter Beobachtung von Zentralbanken und anderen Finanzaufsichtsorganen steht. Da die Finanzmärkte die Risiken extremer Klimaphänomene und abrupter Klimaschutzmaßnahmen derzeit nur unzureichend eingepreist haben, besteht die Möglichkeit einer destabilisierenden Wirkung starker Kursschwankungen oder unerwarteter Pleiten. Im Zuge dessen könnten nicht zuletzt das Euro-System und damit auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Verluste erleiden.
Es ist manchmal schwer, bei einem so generationsübergreifend existenziellen Thema einen ruhigen Kopf zu behalten, hier sind Notenbankerinnen und Notenbanker nicht ausgenommen. Die extreme Unsicherheit langfristiger Klimaszenarien lässt weder Pessimisten noch Optimisten eindeutig widerlegen. Der Irrtum auf der einen Seite hätte jedoch ungleich katastrophalere Konsequenzen als auf der anderen. Deshalb gilt hier das Vorsorgeprinzip anzuwenden.
OeNB-Gouverneur Robert Holzmann hat im Übrigen in der „Wiener Zeitung“ bereits bemerkt, dass die EZB beim Klimaschutz nicht im Fahrersitz ist. Dort sitzen eigentlich die Fachministerinnen und Fachminster. Ökonominnen und Ökonomen bevorzugen grundsätzlich eine Bepreisung von Treibhausgasemissionen, weil diese beim ursprünglichen Problem mangelnder Kostenwahrheit ansetzt. Vorausschauend umgesetzt, lässt sie den Wirtschaftsakteuren Technologiefreiheit und Planungssicherheit.
Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, Risiken mit geringer Wahrscheinlichkeit – in der Finanzwelt „Schwarze Schwäne“ – nicht zu ignorieren. Dies gilt umso mehr für eine Entwicklung, die prinzipiell absehbar und für eine Institution wie die OeNB relevant ist. Ob und in welchem Ausmaß, wird gerade ausgelotet. Für den sehenden Auges auf uns zuschwimmenden „Grünen Schwan“ rüsten sich die Notenbanken jedenfalls.
DIE AUTOREN:
Andreas Breitenfellner ist Lead Economist in der Auslandsanalyseabteilung der Oesterreichischen Nationalbank. Davor war er in der EU-Kommission in Brüssel sowie in der österreichischen OECD-Vertretung in Paris tätig.
Thomas Zöllner ist Assistenzprofessor für Makroökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und in der Abteilung für die Analyse wirschaftlichert Entwicklungen im Ausland der Oesterreichischen Nationalbank tätig. Er hat unter anderem alsConsultant für die Vereinten Nationen (UNIDO) gearbeitet und war Gastforscher an der Masaryk Universität imn Brünn.
QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/leserservice/newsletter/newsroom-rss-opinion/2108564-Entwarnung-Die-EZB-ist-weiter-auf-Kurs.html